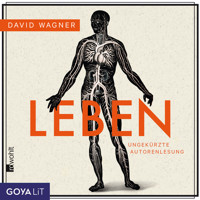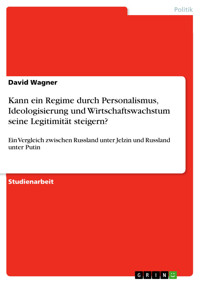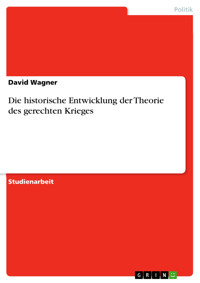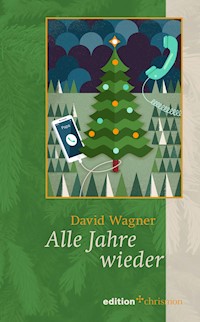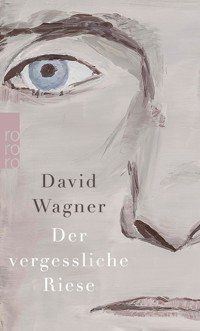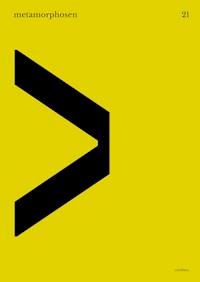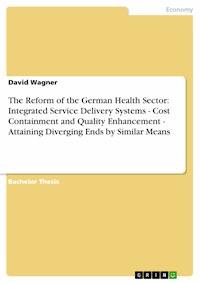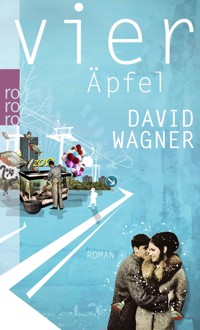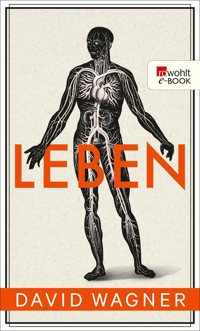Ich serendipitiere
Was habe ich in der letzten Zeit gelesen? Alles liegt hier voller Bücher, und ich erinnere mich an kein einziges. Als ich jünger war, schrieb ich auf, was ich gelesen hatte, ich führte Buch über die Bücher. Ich hatte das völlig vergessen, bis ich, nach einem Umzug, in einem Karton ein Heftchen fand, in dem ich meine Lektüren der Jahre 1987 bis 1990 notiert hatte. »Bibliothek von Babel« hatte ich das Heftchen betitelt, Jorge Luis Borges tauchte dann auch mehrfach auf. Wusste ich damals also schon, dass ich ein vergebliches Unterfangen begonnen hatte? Wusste ich, dass ich mit dem Lesen an kein Ende kommen kann? Oder wollte ich noch alles lesen?
Als ich durch das Heftchen, eigentlich ein Vokabelheft, blätterte, fiel mir auf, wie viel Peter Handke ich gelesen habe. Was hat mich in diesen Jahren so sehr an Handke interessiert? Die tollen Titel? »Der kurze Brief zum langen Abschied«, »Wunschloses Unglück«, »Der Chinese des Schmerzes«, »Die Geschichte des Bleistifts«, »Langsame Heimkehr«. Handkes frühe Titel klingen wie die von Büchern, die man selbst gern geschrieben hätte. Ich habe nur schwache Erinnerungen an das, was ich in ihnen gelesen habe. Trotzdem, das weiß ich seit einiger Zeit, gibt es für mich hin und wieder einen Gefühlszustand beim Unterwegs- und Alleinsein, den ich Peter-Handke-Modus nenne. Dazu gehört es, irgendwo in der Fremde herumzuwandern oder herumzusitzen und sich alles genau anzusehen. Die Fremde erleichtert das Hineingleiten in diesen Zustand, Handke selbst findet ja meist auch erst im Ausland in seinen Text. Zuletzt geriet ich Anfang Mai in den Peter-Handke-Modus, einen Vormittag lang, auf einer sonnigen Bank in Tegnérlunden, einem kleinen, hügeligen Park mitten in Stockholm. Ich sah zwei Hummeln zu, die immer wieder zu den blauen Frühblühern im sehr grünen Gras flogen. Schwedinnen gingen auch durchs Bild.
Ohne in den letzten Jahren jedes Buch von ihm gelesen zu haben, Handke ist immer noch dabei. Mir fällt ein, dass ich ihm vor vielen Jahren, ich war noch auf der Schule, beinahe einmal begegnet wäre. Eine Freundin war au pair in Paris und arbeitete ausgerechnet in dem Vorort, in dem Handke noch heute wohnt. Manchmal sah sie ihn morgens in der Boulangerie, in der sie für ihre Gastfamilie Brot kaufte. Einmal habe ich sie besucht und bin mitgegangen, habe Peter Handke dann aber nicht beim Bäcker getroffen.
Wie kommen die Bücher zu mir? Wie entscheidet sich, wie entscheide ich, wann ich was lese? Es gibt Empfehlungen, es gibt Geschenke. Es gibt die Literaturkritik und die Empfehlungsalgorithmen meines Internet-Buchkaufhauses. Es gibt Bücher, zu denen ich greife, weil gerade kein anderes in Reichweite ist. Und die, von denen ich auf einmal weiß, dass ich sie lesen muss. Unbedingt. So war es eines Morgens, ich war zweiundzwanzig Jahre alt. Ich wachte auf und wusste: Heute muss ich anfangen, »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« zu lesen. Ich fuhr, wie auch sonst fast jeden Tag, nach Dahlem an die Uni und kaufte mir, ich war zuvor schon ein paarmal um sie herumgeschlichen, bei dem Buchhändler vor der Rostlauben-Mensa die geblümt-gemusterte Oktavausgabe von Suhrkamp, zehn Bände in der Kassette, deutsch von Eva Rechel-Mertens. Die mit dem berühmten, an einer Stelle – auf welcher Seite weiß ich nicht mehr – mit der Hand gemalten kleinen d im Druckbild. Es war März, und es roch nach Frühling. Ich fuhr nach Hause, legte mich ins Bett und fing an zu lesen.
Ich lese immer noch, meist den ganzen Tag. Zwischendurch schaue ich vielleicht eineDVD, einen Film, ein paar Folgen einer Serie oder ein Fußballspiel. Die meiste Zeit aber starre ich auf meinen Bildschirm und lese. Ich lese die Tageszeitung im Netz und schaue, obwohl ich versuche, davon loszukommen, ungefähr hundertmal am Tag auf die Seite von Spiegel Online. Ich lese Neuigkeiten auf Twitter und lasse mich von den Links wohin auch immer führen. Ich lese – ich glaube, ich bin süchtig – fast jeden Tag den kompletten Fußballroman im Sportteil des Guardian, lese in ein, zwei Fußballblogs hinein, absurde Technik- und Computerneuigkeiten auf Gizmodo und was El País über denFC Barcelona schreibt. Ich lese den Perlentaucher und klicke mich weiter, lese ein bisschen New York Times, ein bisschen Economist, ich serendipitiere so durchs Netz, den großen Text, der keine Ufer hat.
Ich lese herum und weiß: Das ist auch nur ein großes Ablenkungsmanöver, eine Methode, nicht zu arbeiten und nicht über sich selbst und die Sinnlosigkeit allen Tuns und Treibens nachzudenken. Nachts lese ich dann die neuen Artikel derFAZ, nur um mich am nächsten Tag, wenn sie gedruckt in der Papierzeitung stehen, zu ärgern, dass ich sie schon gelesen habe. Tatsächlich gibt es Tage, an denen ich viel mehr auf meinem Notebook-Bildschirm lese als auf Papier, trotzdem würde auch ich natürlich immer behaupten: Ein ganzes Buch lässt sich nicht am Bildschirm lesen. Das stimmt aber gar nicht. Zumindest das, das ich gerade schreibe, lese ich auf meinem Bildschirm. Ich lese ja alles, was ich schreibe. Ununterbrochen. In dem wunderbaren Roman »Eine Schachtel Streichhölzer« von Nicholson Baker klappt der Erzähler den Bildschirm seines Notebooks deshalb immer halb hinunter. Einerseits, um nicht sehen zu müssen, was er schreibt, andererseits will er vermeiden, dass sein Bildschirm den früh am Morgen noch dunklen Raum erleuchtet, in dem er vor dem Kamin sitzt, um einem einzigen Funken beim Glühen zuzusehen.1
Im Jahr 2004 bekam ich einen Erzählband von Roberto Bolaño zum Geburtstag geschenkt, einem Autor, von dem ich bis dahin noch nichts gehört hatte. »Telefongespräche« hieß das Buch, ich las und war sehr angetan. Ich war angetan, weil die Geschichten auf eine komisch-unterhaltende Art von eher weniger erfolgreichen lateinamerikanischen Schriftstellern erzählten, die sich an Literaturwettbewerben in spanischen Provinzen beteiligten und manchmal kleine Preise gewannen. Damit konnte ich mich identifizieren. Es war nicht schwer, hinter diesen Figuren autobiografisches Material zu erkennen. Bolaño, der Chilene, lebte in Katalonien und versuchte, als Schriftsteller zu überleben. Als ich »Telefongespräche« las, lebte er allerdings schon nicht mehr, er war 2003 – er stand auf der Warteliste für eine Lebertransplantation – an den Komplikationen einer Hepatitis gestorben.
Es ist ziemlich beeindruckend, wie es Bolaño in seinen in sachlich-wilder, oft lakonischer Prosa erzählten Büchern gelingt, Literaten oder − noch schwieriger, weil eigentlich noch langweiliger − sogar Literaturwissenschaftler zu interessanten Helden zu machen. In seinem letzten Roman, dem postum zum Weltbestseller avancierten »2666«, kann er über Hunderte Seiten hinweg für gleich vier Literaturwissenschaftler begeistern, die sich nach einer schier endlosen Reihe von Kongressen tatsächlich auf die Suche nach dem geheimnisvollen deutschen Schriftsteller begeben, von dem sie so besessen sind. Einem Schriftsteller, den niemand je gesehen hat. In seinem anderen großen Roman, dem vielleicht noch höher einzuschätzenden »Die wilden Detektive«, porträtiert Bolaño gleich eine ganze fiktive Schriftstellergruppe, er nennt sie die Realviszeralisten. Das Buch ist eine Schatzkiste, in der viele irre, größtenteils in Mexiko spielende Geschichten liegen, sie alle werden an einem jeweils genau angegebenen Ort zu einer bestimmten Zeit von immer wieder neuen Figuren erzählt. So gibt es aus wechselnden Perspektiven Neuigkeiten auch von Arturo Belano, einem chilenischen Autor, der gegen Ende des Romans in Europa, in Spanien, in der Nähe von Barcelona lebt und nicht gesund ist …2
Andere über sich selbst sprechen zu lassen, diesen Kunstgriff nutzt auch J. M. Coetzee in »Summertime«, dessen deutscher Titel leider »Sommer des Lebens« lautet. Warum habe ich diesen Roman gelesen? Wie kam das Buch zu mir? Mir gefiel ein Ausschnitt, den ich im September 2009 im Harper’s Magazine fand, vorabgedruckt war das Kapitel »Adriana«. Nur weil ich selbst einmal eine mexikanische Freundin gleichen Namens hatte, war ich sehr neugierig. Coetzees Adriana ist Brasilianerin und erzählt einem jungen Biografen, was sie von einem gewissen John Coetzee weiß, einem Mann, dem sie Anfang der siebziger Jahre in Südafrika begegnet war, ohne zu ahnen, dass aus ihm später ein berühmter Schriftsteller werden würde. Der Autor Coetzee, der echte Coetzee, maskiert sich in »Summertime« als sein eigener Biograf − als Biograf einer Person, die auch Coetzee heißt, wie er Schriftsteller ist und während der Hochzeit der Apartheid in Südafrika lebt. Dieser Biograf führt Interviews mit Personen, die ihn damals gekannt haben. Er spricht mit der schon erwähnten Adriana, mit seiner Lieblingscousine, einem Kollegen und einer Nachbarin, mit der er eine kurze Affäre hatte. Von ihnen hört er unverstellte, nackte Wahrheiten. Die verschachtelte Konstruktion ermöglicht die Unbarmherzigkeit, mit der Coetzee seinem Alter Ego gegenübertritt. Die Gesprächspartner berichten gnadenlos von dem unscheinbaren Mann, seiner absurden, zu keinem Zeitpunkt erwiderten Zuneigung, von seiner Unfähigkeit zu tanzen und seiner mangelnden Leidenschaft beim Sex. Seine rücksichtslose Ehrlichkeit macht den Text so ungeheuer gut, seine Gnadenlosigkeit bringt das im Grunde unspektakuläre biografische Material zum Funkeln. »Summertime« zeichnet das Bild eines frauenlosen, unattraktiven, schwermütigen Versagers ohne eigene Wohnung, der darüber nachdenkt, wie er sich am besten umbringen könnte. Erzählt wird das alles aber ganz leicht, wie nebenbei, als wäre es ein unbeschwertes Sommerbuch.3
Zum Jahreswechsel hatte ein Freund in ein Haus draußen auf dem Land eingeladen, irgendwo in Brandenburg, hinter dem Scharmützelsee, nicht nah, aber auch nicht richtig weit weg von Berlin. Er hatte schon erzählt, dass Günter de Bruyn mehr oder weniger sein Nachbar sei und ein Buch über sein Haus, den Wald drumherum und die Gegend geschrieben habe. Das besagte Buch lag im Wohnzimmer des bald eingeschneiten Hauses, wir haben uns dann, wir waren zu siebt, um das Buch gestritten. Wir einigten uns auf teilweises Vorlesen, später wanderte das Buch reihum. Wir erfuhren aus dieser bezaubernden Liebeserklärung an eine eigentlich langweilige Landschaft, wie sehr der Mediziner August Bier sich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts für den umliegenden Wald eingesetzt, ja den Waldbau reformiert hatte. Und wollte ich nicht schon immer gewusst haben, dass besagter August Bier während des Ersten Weltkriegs den Stahlhelm für das deutsche Heer entwickelt hatte? Nach der Lektüre, die ausnahmsweise keine einsame war, spazierten wir fast verliebt durch diese flache Landschaft mit Bäumen − das hatte de Bruyn mit seiner genauen, klassizistischen, ganz selten nur einen Hauch ins Betuliche rutschenden Prosa geschafft. Wir stapften also durch den Schnee und standen tief im Wald plötzlich vor dem uns nun aus dem Buch bekannten Haus des Schriftstellers. Und ich kam mir wieder vor wie der Gymnasiast, der in einer Bäckerei auf Peter Handke wartete.4
Keine Systematik mehr in meinen Lektüren, ich lese, was kommt, und führe nicht mehr Buch, schon lange nicht mehr. Manchmal notiere ich Titel von Büchern, die ich lesen möchte, eines Tages, mal sehen, wann es dazu kommt. Davor aber finde ich immer wieder irgendwo ein anderes, wie kürzlich, als ich im Hauseingang einer Freundin an einer Bücherkiste vorbeigehe und dann doch nicht vorbeigehe, sondern stehen bleibe, schaue − eigentlich will ich keine Bücher mehr mitnehmen, ich habe genug – und nach Wolfgang Kemps Buch über John Ruskin greife. Das besitze ich noch nicht. Vor Jahren habe ich es in der alten Bibliothek des Peter-Szondi-Instituts am Hüttenweg in der Hand gehalten, hineingeblättert, es aber nicht gelesen. Jetzt ist es zurückgekommen. Ich nehme es mit, es riecht nicht besonders gut, aber auch nicht so angemodert, dass ich es nicht im Bett lesen könnte, wo ich immer noch am liebsten lese. Und ich weiß nicht wieso oder woher, ich weiß schon in diesem Augenblick, dass es ein wichtiges Buch sein wird und ich es von der ersten bis zur letzten Seite lesen werde. Die Ahnung hat sich dann erfüllt, zweieinhalb sehr lesevergnügliche Tage im April saß ich mit dem Buch zwischen blühenden Apfelbäumen in einem oberösterreichischen Garten. Die Bäume hätten Ruskin sicherlich gefallen.5
Im New Yorker sehe ich eine Notiz über ein Buch von Will Self, es heißt »Liver«. Zwei Klicks und ich habe es bestellt, vier Tage später liegt es in meinem Briefkasten und ich nicht viel später damit im Bett. Die tollste Geschichte, die über den englischen Schriftsteller, Jahrgang 1961, erzählt wird, ist natürlich die, dass er einmal auf der Toilette der Regierungsmaschine von Premierminister John Major mit Heroin erwischt wurde. Kann seine Literatur da mithalten? In »Liver« findet sich eine lange, novellenartige Erzählung mit dem Titel »Leberknödel« (deutsch im Original) über eine final leberkrebskranke Frau, die mit ihrer erwachsenen Tochter in die Schweiz reist, um ihr Leben von einem dort ansässigen Sterbehilfeunternehmen beenden zu lassen. Im letzten Moment entscheidet sie sich dann allerdings doch gegen den Tod, bleibt in Zürich, ihr Krebs verschwindet, und sie gerät in religiöse Kreise, die ihre Spontangenesung als Wunder anerkennen lassen wollen. So weit, so schön und so lala. Gut recherchiert, sehr breit, detailreich und formal ambitioniert, die Struktur eines Requiems aufgreifend, erzählt.6
Als ich den Text das erste Mal lese, wundere ich mich über die vielen Fehler in den einmontierten deutschen Sätzen. Ein Stilmittel, das ich nicht verstehe? Bei der zweiten Lektüre finde ich dann gar nicht mehr so viele Fehler. Wollte ich die unbedingt finden, weil mir die ganze Geschichte bei aller Virtuosität ein wenig aufgepumpt und ausgedacht vorkam? Mir fällt ein, dass ich vor Jahren einmal eine Sammlung der schönsten Entstellungen deutscher Prunkzitate in französischen Büchern anlegen wollte – ein Unterfangen, das mir dann aber doch zu anstrengend und oberlehrerhaft erschien. Außerdem war ich gewarnt durch meine englische Stiefmutter, die – wahrscheinlich nicht zu Unrecht – oft genug vom Hang der Deutschen zum Erziehen und Belehren sprach. Ja, ich sollte nicht nach Fehlern suchen, sondern mich freuen, dass unsere unbedeutende kleine Sprache überhaupt noch irgendwo vorkommt.
In dem Karton, in dem das Heftchen lag, das ich so großspurig »Bibliothek von Babel« genannt hatte, fanden sich auch ein paar alte Hausarbeiten, die ich damals, Anfang der neunziger Jahre, immer hübsch in Schnellhefter abgeheftet hatte. Ich nahm eine heraus, eine Arbeit über das Erhabene und die Kunst Barnett Newmans, und staunte nicht schlecht über ein französisches Motto, das ich auf das Titelblatt gesetzt hatte. Der kurze Satz enthielt zwei unglaublich entstellende Fehler. Der Satz war (ich musste ihn geschrieben haben, bevor ich wegen Proust und der »Recherche« ernsthaft anfing Französisch zu lernen) so absurd falsch, dass das Napoleon zugeschriebene Zitat wie ein Witz wirkte, fast schien es mir, als wäre es ein Konzept, denn es lautete (hier nur auf Deutsch, aus Angst, mich wieder zu verschreiben): »Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt.«
1 Nicholson Baker,Eine Schachtel Streichhölzer.Reinbek: Rowohlt 2004.
2 Roberto Bolaño,Die wilden Detektive.München: Hanser 2002;Telefongespräche.München: Hanser 2004;2666. München: Hanser 2009.
3 J.M.Coetzee,Sommer des Lebens. Frankfurt am Main: Fischer 2010.
4 Günter de Bruyn,Abseits. Liebeserklärung an eine Landschaft. Frankfurt am Main: Fischer 2005.
5 Wolfgang Kemp,John Ruskin. 1819–1900. Leben und Werk.Frankfurt am Main: Fischer 1987.
6 Will Self,Liver.London: Bloomsbury 2009;Leberknödel.Aus dem Englischen übersetzt von Gregor Hens. Hamburg: Hoffmann und Campe 2015.