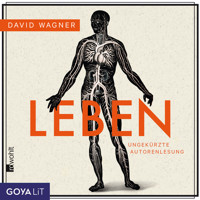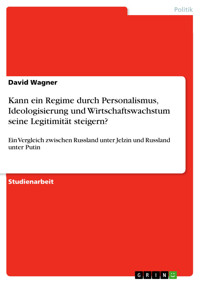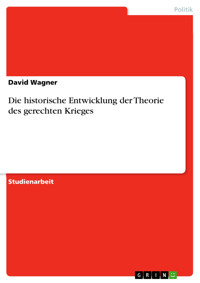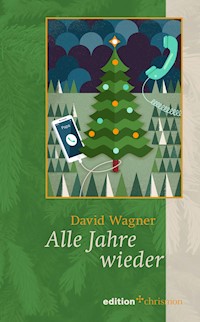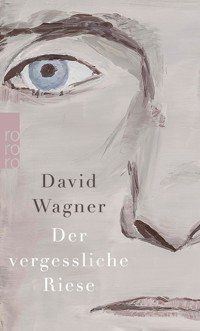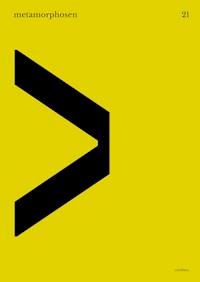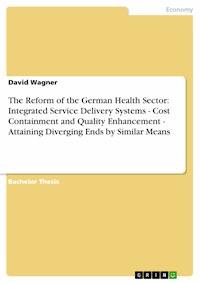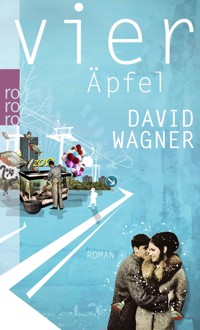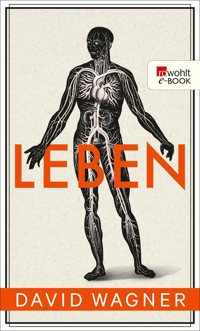Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Sonntag, 3. März 2002
Montag, 4. März
Dienstag, 5. März
Mittwoch, 6. März
Donnerstag, 7. März
Freitag, 8. März
Samstag, 9. März
Sonntag, 10. März
Montag, 11. März
Dienstag, 12. März
Mittwoch, 13. März
Donnerstag, 14. März
Freitag, 15. März
Samstag, 16. März
Sonntag, 17. März
Montag, 18. März
Dienstag, 19. März
Mittwoch, 20. März
Donnerstag, 21. März
Freitag, 22. März
Samstag, 23. März
Sonntag, 24. März
Montag, 25. März
Dienstag, 26. März (München)
Mittwoch, 27. März (Berlin)
Samstag, 30. März
Montag, 8. April
Dienstag, 9. April
Mittwoch, 10. April (München)
Donnerstag, 11.April (Bukarest)
Freitag, 12. April
Samstag, 13. April
Sonntag, 14. April
Montag, 15. April
Dienstag, 16. April
Mittwoch, 17. April
Donnerstag, 18. April
Freitag, 19. April
Samstag, 20. April
Sonntag, 21. April
Montag, 22. April
Dienstag, 23.April
Mittwoch, 24.April
Donnerstag, 25. April
Freitag, 26. April
Samstag, 27. April
Sonntag, 28. April
Über dieses Buch
Impressum und Copyright
Sonntag, 3. März 2002
Ich liege auf einem breiten Bett und sehe den Balkon des Palastes, von dem Nicolae Ceaușescu 1989 das letzte Mal zu seinem Volk sprach – das Volk aber wollte ihn nicht mehr hören. Er wurde ausgebuht und ausgepfiffen, Schüsse fielen, er floh mit seiner Frau Elena in einem Hubschrauber vom Dach, ein paar Tage später waren beide tot.
Simona sollte mich abholen. Ich stand am Flughafen Bukarest-Otopeni, wartete auf die Austauschdichterin und hatte ein bisschen Angst, dass wir uns verpassen, ich wusste ja nicht, wie sie aussieht. Ich stand in der Ankunftshalle herum, schaute jede Frau an und fragte mich, ob sie eine rumänische Dichterin ist.
Als sie, eine halbe Stunde war vergangen, schließlich kam, war es ganz leicht, sie zu erkennen: nicht groß, eine kleine runde Brille, halblange dunkle Haare, helle Bluse, schwarze Strickjacke und ein langer schwarzer Rock. Nicht nur ihre Brille erinnerte mich sofort an E., sie trägt auch ihr Parfüm (Chanel No.-Ich-weiß-nicht-mehr), riecht also nach großer Liebe, den vergangenen vier Jahren, viel Streit und einer Trennung.
Sie war mit Bogdan, ihrem Mann, gekommen, größer und älter als sie. Wir verließen das Flughafengebäude, gingen über den Parkplatz zu einem älteren Opel Kadett und fuhren, wir plauderten, wir verstanden uns gleich gut, Richtung Stadt. Bukarest, das hatte ich schon aus dem Flugzeug gesehen, liegt in einer weiten Ebene. In der Walachei.
Wir schauten uns Wohnungen an, noch war gar nicht klar, wo ich wohnen werde. Die erste Unterkunft, die wir besichtigten, war ein Loch, die Küchenzeile befand sich im einzigen Zimmer, leere Schnapsflaschen standen herum, es stank. Nein, lieber nicht. Simona hatte Schlüssel zu zwei weiteren Wohnungen, wir schauten sie an und ich entschied mich für einen kleinen Palast in einem Gebäude aus den sechziger Jahren gleich gegenüber der Konzert- und Kongresshalle, mitten im Zentrum.
Nach den Wohnungsbesichtigungen fuhren wir zu Simona und Bogdan nach Hause, sie leben in einem schönen Altbau an einem kleinen Platz mitten in der Stadt. Viele Bücher. Wir aßen Eintopf und Brot und tranken Bier und gingen bald ins Theater um die Ecke, wir sahen, genau das Richtige für mich, ein Stück über das langsame Sterben einer Frau an Krebs.
Ich verstand nicht viel, es gefiel mir trotzdem.
Das Fenster steht offen, draußen ist es warm. Ich liege auf dem Bett, höre die Stadt und sehe hinter der kleinen, beleuchteten Backsteinkirche den Balkon, von dem aus Ceaușescu zu seinem Volk sprach … – wie oft ist sein Name heute schon gefallen?
Und ich weiß wieder, zu verreisen ist viel besser, als sich umzubringen.
Montag, 4. März
Simona und ich besuchen die Vermieterin meiner Wohnung, sie heißt Madame Kivu und residiert in einer von Plattenbauten umstellten Villa. Sie empfängt uns in einem mit geschnitzten Möbeln vollgestopften, gründerzeitlich überladenen Salon, die Wände rosafarben verputzt. Ihr Mann, ein ehemaliger Offizier, scheint nicht viel zu sagen zu haben, ihr Sohn, er heißt Alexander, ungefähr mein Alter, schaut kurz herein und grüßt. Sie, die Dame, sitzt in einem gepolsterten Fauteuil, auf einem Tischchen neben ihr ein elfenbeinfarbenes Telefon, das unablässig klingelt. Die Miete kassiert sie in bar und in Dollar.
Als ich am frühen Abend zurück in die Wohnung komme, ist alles frisch geputzt.
Lasse rumänisches Fernsehen laufen, möchte ja Rumänisch hören. Bin todmüde nach dem langen Rumlauftag mit Simona, die mir alles zeigen möchte, ganz Bukarest an einem Tag. Sie werde nie müde, sagt sie. Ich glaube ihr.
Simona ist die Dichterin, die noch nicht herausgefunden hat, ob sie auch mit Kind schreiben kann. Dass sie ohne ihre Tochter für zwei Monate nach Deutschland gehen möchte, später im Jahr, es soll ja ein Austausch sein, lässt mich nun denken: Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass ich jetzt in Bukarest und nicht in Berlin bei meiner Tochter bin. Vielleicht bin ich doch kein Unmensch?
Dienstag, 5. März
Am Morgen sitzen zwei Schaben in der Küchenspüle. Ob die große Putzaktion gestern sie aufgeschreckt hat? Verglichen mit denen, die ich aus unserer alten Pariser Wohnung kenne, sind sie eher klein. Soll ich sie Kakerlaken nennen? Ich verzichte darauf, mir Nescafé zuzubereiten, ich beschließe, die Küche bis auf Weiteres nicht mehr zu betreten und gehe hinunter zu dem Kiosk unten neben dem Hauseingang. Eigentlich ist es nur ein Fenster, hinter dem ein mürrischer junger Mann auf Kundschaft wartet, er sitzt in einem winzigen Raum, früher vielleicht eine Pförtnerloge, in dem er sich kaum bewegen kann; sein Gehäuse, ein Kabäuschen, scheint um ihn und die Zigaretten, den Schnaps und die Schokoriegel herum gebaut worden zu sein. Es gibt Kaffee. Der Espresso, er kommt mit Zucker, schmeckt.
Die Sonne scheint, die Funkgeräte der Taxis vor dem Fenster spielen ihre Melodie.
Simona möchte mich intellektuell durchleuchten, sie sagt »radiographieren«. Es gefällt mir, mich ein bisschen dümmer zu stellen und nicht alles zu sagen. Wir unternehmen einen langen Spaziergang, wir besuchen eine alte Karawanserei, essen zusammen, wandern herum. Trinken Kaffee, wandern weiter. Die Avenue, die zu Ceaușescus Palast führt – bis 1989 hieß er »Haus des Volkes« (Casa Poporului), nun aber »Palast des Parlaments« (Palatul Parlamentului) – soll breiter sein als die Avenue des Champs-Élysées, sagt Simona. Glaube ich sofort.
Das große, das ganz große Entsetzen über all das, was zerstört worden ist, um diese Straße anzulegen – sie musste, wie einst Haussmanns Pariser Boulevards, durch bestehende Altstadtbebauung gefräst werden –, packt mich nicht. War es nicht immer schon so, dass das eine auf dem anderen erbaut wurde? Heute (und wahrscheinlich nicht für immer) steht am Ende der Straße dieses Monster, entworfen von einer 26-jährigen Architekturstudentin, die Ceaușescu mit ihrer naiven neoklassizistischen Maßlosigkeit überzeugte, 1983 beauftragte er sie mit dem Bau. So wird es mir erzählt. Ja, es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. 25 000 Mann sollen im Drei-Schicht-System auf der Baustelle gearbeitet haben, zeitweise 100000. Und die Ceaușescus, Nicolae und Elena, sie konnten es wohl kaum erwarten, sollen sie 428 Mal besucht haben.
Die Häuser entlang des Bulevardul Unirii (früher: »Boulevard des Sieges des Sozialismus«) erinnern an die Ost-Berliner Karl-Marx-Allee (früher: Stalinallee), weniger wegen ihrer Fassaden als wegen ihrer Ausmaße; die Fassaden selbst lassen mich, sonderbare systemübergreifende Ähnlichkeit, an manche postmoderne Spielerei der West-Berliner Bauausstellung von 1987 denken.
Wir ziehen durch Antiquitätengeschäfte, ich sehe schöne alte Stühle, Schreibtische und Kommoden, die ich sofort kaufen würde – wenn ich das Zeug nur nach Hause tragen könnte. Wir sehen auch Glasbläser und eine Ausstellung mit etwa fünfzig Bleistiftzeichnungen fünfzig verschiedener Mösen, meist in Untersicht, die Beine oft leicht gespreizt. Simona sagt: »Sieh an, ›L’origine du monde‹, immer wieder.« Ihr scheint’s zu gefallen.
Später am Abend, auf einer Vernissage, trägt eine Künstlerin Orange, Simona nennt sie »la fille en orange« – und fragt mich, wie ich sie finde.
Mittwoch, 6. März
Manche Autos heulen auf, wenn ich ihre Außenspiegel streife, manchmal reicht es, zu dicht an ihnen vorbeizugehen. Ihre Alarmanlagen schreien, manche Schreie enden in Klagelauten der Autobatterie, am Schluss nur noch ein Wimmern.
Die Regenrohre, die Fallrohre an den Hauswänden, enden hier einfach über dem Pflaster. Bei Regen muss das Wasser also über den Gehweg bis in den Rinnstein fließen. Bisher hat es noch nicht geregnet, bisher also noch keine nassen Füße wegen Gehwegüberflutung.
Es gibt so viele schöne alte Häuser, ich staune über die vielen neusachlichen Gebäude, Zwanziger- und Dreißiger-Jahre-Häuser, Simona nennt den Stil »kubistisch«, mir gefallen die elegant halbrund aus den Fassaden ragenden Balkone, es gibt einige halbrunde und sogar ganz runde Gebäude.
In das Heulen der Alarmanlagen (aus der Ferne hören sie sich wie zirpende Grillen an) mischt sich nachts das Bellen der Hunde. Die Hunde – Bogdan sagt, es gebe nicht mehr so viele, wie noch vor wenigen Jahren – leben auf der Straße, es sind Straßenköter, »stray dogs«, die wir in Deutschland gar nicht mehr kennen. Und Hundefänger waren mir eigentlich nur aus Laurel-&-Hardy-Filmen vertraut.
Es heißt, es seien die Hunde (bzw. die Nachkommen der Hunde), die bei den überraschenden Zwangsräumungen und Abrissen für Ceaușescus megalomane Bauprojekte ausgesetzt wurden, zwanzigtausend sollen es heute sein. Oder zweihunderttausend? Die Angaben schwanken. Viele Leute seien gebissen worden, sagt Simona, die Angst vor den Hunden hat; es helfe, mit ihnen zu sprechen, es helfe, sie anzusprechen, freundlich zu sein und aufrecht stehen zu bleiben, die alte Hunderegel. Nicht weglaufen jedenfalls. Die Hunde, vielleicht werden sie in ein paar Jahren ja auch zu Wölfen, sind Promenadenmischungen – jetzt verstehe ich, hier ist zu sehen, was dieses Wort bedeutet. Sie sind auf der Promenade entstanden.
Die Hunde erinnern mich an die auf mexikanischen Dorfstraßen, die nur von dem einmal am Tag durchfahrenden Bus aufgeschreckt werden, ich muss überhaupt oft an Mexiko denken, gestern zum Beispiel, während des langen Spaziergangs: die verstaubte frühere Pracht, die Vergangenheit, die auf Zukunft wartet, der schlechte Zustand der Straßen und Gehwege. Oder sehe und denke ich das bloß, weil ich mich hier in Bukarest nur ein wenig wie damals in Mexiko fühle? Von allen und allem abgeschnitten?
So abgeschnitten aber bin ich doch gar nicht: Vorgestern sprach ich mit Bert, gestern mit Nicolai. Er rief an, gleich nachdem ich ihm eine SMS mit meiner Telefonnummer geschickt hatte, das Wählscheibentelefon, ja, ich habe hier ein Wählscheibentelefon auf meinem Schreibtisch, klingelte, es rauschte in der Leitung, er war am Apparat.
Hörte sich an, als könnte ich mit diesem Telefon auch ins Jenseits telefonieren.
Am Morgen scheint mir die Sonne aufs Gesicht, sie kitzelt, sie weckt mich. Gehe wieder hinunter, ich traue mich ja nicht mehr in die Küche, und hole mir einen Espresso im Plastikbecher, Zucker, nicht zu wenig, ist schon drin. Der Kiosk, das ist schon praktisch, hat rund um die Uhr geöffnet. Gestern, ich hatte plötzlich Hunger, kaufte ich mir dort spät in der Nacht eine Tüte Chio Chips; Zutaten und Zusammensetzung standen in allen möglichen osteuropäischen Sprachen auf der Verpackung – nirgends aber war zu lesen, in welchem Land der Inhalt nun eigentlich hergestellt worden war. In Deutschland vielleicht?
Während ich vor dem Fernseher saß und Chips in mich hineinstopfte, verfiel ich nach und nach der meditativen Wirkung des Discovery Channel, diesem Betrugsfernsehen, das immer vorgibt, seinen Zuschauern gleich sehr wichtige Neuigkeiten, ganz große Entdeckungen mitzuteilen – die dann aber, Überraschung, keine sind. Das Raunen und die suggestive Musik verführen mich, immer glaube ich, gleich würde etwas ganz und gar Erstaunliches, Außerordentliches enthüllt. Und dann kommt doch wieder nichts. Gar nichts.
Bin jetzt wieder allein mit meinem Text und habe eine Stadt zur Zerstreuung. Alles könnte so leicht sein – dabei habe ich schon wieder das Gefühl, ich würde mich drücken. Wovor eigentlich?
Donnerstag, 7. März
Um sechs treffe ich Bogdan vor dem Theater nicht weit vom Markt, das Gebäude war mir schon gestern aufgefallen. Wir sehen ein Stück mit Kindern, die auf der Straße gelebt haben und jetzt in sozialen Wohnprojekten untergebracht sind, zwei Schauspielstudenten sind dabei, Simona kommt nach, die Vorstellung hat schon begonnen. Sie musste heute unterrichten und in einer Fernsehsendung auftreten. Bogdan wird vom Theaterdirektor begrüßt, alle scheinen ihn zu kennen, viele wollen ihn kennen, bauchpinseln ihn. Was wohl, vermute ich, an seiner wöchentlich erscheinenden Zeitung liegt, dem Observator Cultural, er ist der Chefredakteur.
Das Stück ist so lala, ich wundere mich fast ein bisschen, dass niemand sich auszieht und nackt über die Bühne springt, aus Berlin bin ich das ja so gewohnt. Während des Schlussapplauses fällt mir auf (das war schon Sonntagabend im Theater so), dass das Publikum sofort in ein rhythmisches Schnellklatschen im Einheitstakt fällt. Ungeordnet brandenden Beifall scheint es hier nicht zu geben, Beifall zu schenken, bedeutet hochfrequentes Einheitsklatschen.
Nach der Vorstellung ziehen Simona und ich noch weiter, ohne Bogdan, er muss eine Kritik fertigschreiben. Während wir herumspazieren, fällt mir auf, dass es kaum Cafés, Bars oder Restaurants gibt, Simona zeigt mir nur die, an denen ich bereits gestern und heute Nachmittag vorbeigegangen bin.
Wir spazieren durch die laue Frühlingsluft und kehren schließlich in einem Restaurant ein, das erst vor Kurzem im Souterrain einer Jugendstilvilla eröffnet wurde. Und ich esse schon wieder warm (war heute Mittag schon im Restaurant) und zum Nachtisch noch Papanași (ausgesprochen Papanache), gebratene Topfenknödel, die mit Marmelade und saurer Sahne serviert werden. Teuflisch gut.
Warum habe ich hier dauernd Hunger?
Simona erfindet das Wort »nashfull«, während wir über das Naschen reden, Papanași und Papa nascht, wir albern herum, dann sagt sie plötzlich, sie komme sich dämlich vor, wenn sie Dialoge schreibe, sie finde Dialoge lächerlich. Und ich sage: »Ich auch.«
Als ich nach Hause gehe, ist es immer noch warm. Und der Johnnie Walker der großen Leuchtreklame läuft in Rot über das Haus, das ich von meiner Wohnung aus sehe. Würde jetzt, in meinem Zimmer über dem Taxistand, gern E-Mails lesen, vielleicht hat Christiane geschrieben. Oder Julie?
Das Internetcafé, es liegt ein paar Straßen weiter, hat schon zu.
Müde. Müde bin ich hier. Hungrig und müde. Müde trotz des Mittagsschlafs. Habe ein wenig gearbeitet, erst hier am Schreibtisch, dann im Park, dann wieder zu Hause.
Und was heißt gähnen auf Französisch? Bâiller?
Simona sagt: »Stimmt.«
Der Muschelkalk fällt mir immer wieder auf, Simona sagt: »Der Stein gefällt dir, nicht wahr?«
Auf dem Markt werden die Eier lose, in großen Eimern liegend, angeboten. Und die Hunde streunen über die Straßen, so wie anderswo die Tauben. Nur fliegen können sie nicht.
Im Supermarkt, der Supermarkt heißt »Angst« (ist das nicht ein toller Name?), kaufe ich Wasser. Kaufe das preiswerte aus der Bukowina, ich nenne es »Paul-Celan-Wasser«. Evian gibt’s überall, in fast allen Geschäften, Gerolsteiner ebenfalls.
Freitag, 8. März
Große Sonne am Morgen, so hell. Als ich den Espresso bezahle, unten, am Kiosk, fühlen die Foliengeldscheine sich noch immer ungewohnt an. Das rumänische Geld ist aus Plastik.
Telefoniere mit Lothar Müller, es geht um die Besprechung von Robert Coovers Geisterstadt, bis Montag soll ich liefern.
Simona und ich treffen uns um zwölf, wir fahren ein Stück mit dem Bus und gehen ins Muzeul Satului, das Musée du Village, ein Freilichtmuseum, in dem alte Bauernhäuser, die meisten aus Holz, wiederaufgebaut wurden. Einige sind vor einigen Monaten abgebrannt – trotz der vielen Wächterinnen, die vor oder auf den Terrassen fast aller Häuser sitzen. Zwei von ihnen stören wir während ihrer Pause, eine lutscht gerade eine Zitrone aus, eine andere löffelt Marmelade aus einem riesigen Glas auf eine daumendicke Scheibe Brot. Die Frau, sonnengebräunt, lacht, als sie bemerkt, dass ich sie beobachte.
Die Häuser, vor denen sie sitzen, haben hohe Schwellen, um die Wärme zu halten, wenn ich es richtig verstehe, in ihnen riecht es nach Holz, innen sind sie dunkel.