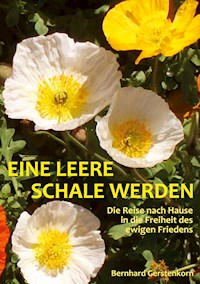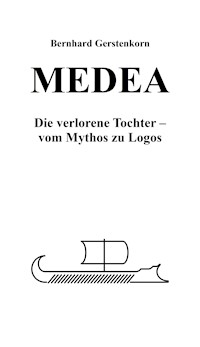
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Medea ist eine der prägnantesten Frauenfiguren aus der griechischen Mythologie. Bekannt vor allem durch Euripides antike Tragödie, wird das Thema des Kindsmords oft in den Vordergrund gerückt. Dabei umfasst ihr Mythos weit mehr. Die älteste Erzählung, in der Medea die Bühne betritt, ist das Argonautenepos. Die homerischen Epen Ilias und Odyssee nehmen Bezug darauf und auch Hesiod spielt darauf an, ohne sich weiter mit dessen Inhalt zu beschäftigen, weil er zu seiner Zeit als allgemein bekannt vorausgesetzt werden konnte. Der reiche Fundus an überliefertem Material weist darauf hin, dass der vielschichtige Medea-Mythos in verschiedenen Epochen und an unterschiedlichen Orten entstanden ist. In Verbindung mit anderen antiken Zeugnissen und heutigem Wissen lässt sich skizzieren, dass in ihrem Mythos unsere gesamte Menschheitsgeschichte aufscheint. Es lässt sich herleiten, woher wir kommen, wer wir sind, warum die Dinge so sind, wie sie sind, was unser Problem und unsere eigentlichen Aufgaben sind, und wohin wir gehen werden. An Beispielen aus der klassischen Musik wird erlebbar gezeigt, was das bedeutet. Bei Mozart können wir hören, wohin wir gehören. Aus Beethovens Musik lässt sich erschließen, dass er dorthin gegangen ist. Medea ist eine antike Tragödie; genauso hat Beethoven eines seiner Werke bezeichnet. Anhand einiger Schlüsselwerke und biografischem Material lässt sich sein Voranschreiten plausibel nachvollziehen. Das Aufdecken dieser wenig bekannten Seite lässt sein Leben und Werk in einem anderen Licht erscheinen. Abschließend wird die Deutung der Medea durch harte Fakten unterlegt, die nahelegen, dass wir uns in einer vierdimensionalen Raumzeit-Matrix verfangen haben und freier Wille auf Körperebene reine Illusion ist. Die Deutung der Medea zeigt uns aber auch, was uns darin gefangen hält und wie wir uns daraus befreien können. Wenn wir uns aktiv um unsere Befreiung bemühen, fördern wir gleichzeitig das Gedeihen unseres Lebens und dasjenige unseres Planeten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bernhard Gerstenkorn
MEDEA
Die verlorene Tochter – vom Mythos zu Logos
© 2019 Bernhard Gerstenkorn
Autor: Bernhard Gerstenkorn
Umschlag, Illustration: Bernhard Gerstenkorn
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN Paperback: 978-3-7482-8928-9
ISBN Hardcover: 978-3-7482-8929-6
ISBN E-Book: 978-3-7482-8930-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich; wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkungen nicht erkennbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Der Mythos
Von der olympischen Hochzeitsfeier zur Odyssee
Von der Odyssee zum Argonautenepos
Vom Argonautenepos zu Euripides
2. Mythenbildung
Ein Vulkanausbruch schreibt Geschichte
Das kollektive Unbewusste
Nichtlokalität des Bewusstseins
Mythen- vs. Legendenbildung
Erlebnis der Nichtlokalität
Vom Mythos zur Religion
Das Umfeld der Mythenbildung
Wie ist Medea zu deuten?
3. Medeas Heimat
Körper, Geist und Seele
Der eine Wille
Logos, die erste Ursache
4. Medeas Verhängnis
Die Abwärtsspirale, 1. Drehung: kognitive Dissonanz
2. und 3. Drehung: Schuld und Angst vor Logos
4. Drehung: Bindung an das Verhängnis
Die Geschichte wiederholt sich
Wirkungen in der Gegenwart
5. Die Natur des Verhängnisses
Die Spaltung des Geistes
Die Dynamik der unbewussten Schuld
Selbstbestrafung
Flucht aus der Gegenwart
Kolossale Blindheit
6. Medeas Kinder
Die Büchse der Pandora
Die Apokalypse ist vertagt
Medeas Kinder Atlantis und Lemurien
Sind wir Medeas letztes Kind?
Alles nur Fassade
7. Der Mythos endet
Elysisches Bewusstsein
Modellbildung
Die zwei Spuren des Lebens
8. Wege zu Logos
Kenneth Wapnick und sein spiritueller Lehrer
Ludwig van Beethoven
Die Verbindung mit jener anderen Welt
Die Umsetzung
9. Harte Fakten
Sklave des Gehirns
Das Drehbuch ist geschrieben
Der Spielraum der Handlungsfreiheit
Unser Leben in der Matrix
Vom Widerstand auszusteigen
Wahre Vergebung
Außerirdischen ergeht es genauso
Die Lösung des Dilemmas
Die Schöpfungsgeschichte des 21. Jahrhunderts
Die Heimkehr
Literatur
Vorwort
Im Radio wurde ausführlich über Neuinszenierungen von Medea-Opern berichtet. Medea? Kam mir irgendwie bekannt vor. Ich holte mir eine Zeitschrift mit Themen aus der griechischen Antike hervor und las einen Artikel über Platons Schulung zu Unabhängigkeit und Demokratie. Euripides soll in seiner Tragödie Medea mit einem „Sohn des Erechtheus“ angeblich Platon gemeint haben. Erechtheus ist ein mythischer Unabhängigkeitskämpfer und auf der Akropolis in Athen ist ihm zu Ehren mit dem Erechtheion ein eigener Tempel gewidmet. Ich wollte es genauer wissen, beschaffte mir Euripides Medea und las die Tragödie. Das Bühnenstück kam mir ziemlich primitiv vor. Deshalb hatte es mich nicht weiter erstaunt, dass Euripides im Tragödien-Wettstreit im Jahre 431 v. Chr. den letzten Rang belegte. Das Stück mag viele Anspielungen auf das Zeitgeschehen enthalten haben, aber selbst dies hatte das Premierenpublikum offenbar nicht zu überzeugen vermocht. Man könnte sogar eine leichte Xenophobie heraushören, da Medea als Ausländerin, als Fremde und Barbarin dargestellt ist. Doch Medea ließ mich nicht mehr los. Der hervorragende Wikipedia-Eintrag gab mir eine Gesamtschau auf Medea. Eines Tages kam mir der Gedanke, dass es sich bei Medea um eine frühere Variante der Geschichte des verlorenen Sohnes handelt, dass sie eine Metapher für unsere kollektive Geschichte ist. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich die Idee mit mir herumgetragen, etwas darüber zu schreiben, um die Zusammenhänge zu ergründen.
Zwischenzeitlich habe ich verschiedene Biografien und populäre Bücher gelesen, die sich in irgendeiner Form mit Geschichte befassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn die Autoren ihr Fachgebiet verlassen, um von ihm auf das große Ganze zu schließen, es sehr spekulativ wird und die Objektivität durch das vom jeweiligen Autor vertretene Denksystem begrenzt ist. Vielen Wissenschaftlern ist gemeinsam, dass ihre Sichtweise durch ein evolutionär begründetes Menschheitsbild geprägt ist. Empirisch bestens belegte Befunde aus der Psychologie, die ein viel differenzierteres Menschheitsbild nahelegen würden, bleiben dabei auf der Strecke oder werden falsch wiedergegeben. Auf einem evolutionären Menschheitsbild abgestützte Publikationen zeugen deshalb vereinzelt von mehr oder weniger großer Naivität, weil das konflikthafte, destruktive Potential der menschlichen Psyche übergangen wird, geschweige denn die Ursache dahinter beleuchtet wird.
Laut Yuval Noah Harari wird das Phänomen der kognitiven Dissonanz zwar oft als psychische Störung verstanden, doch in Wirklichkeit handle es sich um eine lebenswichtige Angelegenheit, da sie die Würze jeder Kultur ausmache.1 Rein formal ist kognitive Dissonanz keine psychische Störung, sondern eine empirisch breit abgestützte Theorie aus der Sozialpsychologie. In Hararis Argumentationen schimmert zeitweilig eine starke Affinität zu östlichen Philosophien durch, wie beispielsweise dem Buddhismus. Auf die Frage, ob er sich selbst als Buddhist sieht, antwortet er: „Nein, sicherlich nicht offiziell. Die Praxis der Meditation ist eine buddhistische Tradition. Aber über die Jahre wurde aus Buddhismus eine Religion mit eigener Mythologie, Geschichten und Problemen. Ich akzeptiere das Gesamtpaket nicht, sondern nehme mir das heraus, was ich brauche.“2 Eine zentrale buddhistische Praxis liegt im Versuch, das Urteilen aufzugeben. Im Urteilen scheint neben den Begierden die Ursache von allem Leiden zu liegen, das mittels ausdauernder Meditation aufgelöst werden soll. Das Urteilen ist auch die Ursache hinter der kognitiven Dissonanz. Sie hat sich als zentrale Theorie im Entschlüsseln des Medea-Mythos erwiesen und zeigt auf, wie unser individuelles wie kollektives Verhängnis beschaffen ist. Inhaltlich hatte Harari also unbeabsichtigt recht, kognitive Dissonanz mit einer psychischen Störung in Beziehung zu setzen, zur Würze jeder Kultur mag sie jedoch nur beitragen, wenn die dahinterliegende Ursache verschleiert bleibt. Ein grundlegendes Verständnis der mit kognitiver Dissonanz einhergehenden psychischen Prozesse und ein damit im Einklang befindendes metaphysisches Modell wird uns zeigen, wie wir mit einer einfachen und wirkungsvollen geistigen Praxis kognitive Dissonanz auflösen können.
Bislang war es mir jeweils möglich, alle wissenschaftlichen Befunde mit dem hergeleiteten Modell in Übereinstimmung zu bringen. Wenn das nicht erfolgreich war, dann deshalb, weil wir über die Medien, die Presse und wissenschaftlichen Publikationen oft nicht die eigentlichen Messdaten präsentiert bekommen haben, sondern nur eine Interpretation der Messresultate. Forscher verfolgen in ihren Untersuchungen ein bestimmtes Ziel und dementsprechend werden Daten oft in einer Weise präsentiert und gedeutet, dass sie das gewünschte Resultat aufzeigen. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass in der Forschung großer Erfolgsdruck herrscht und möglichst spektakuläre Resultate angestrebt werden, oder der finanzielle Anreiz der Forschung Ergebnisse in eine bestimmte Richtung begünstigen. Mein Blick auf diese Dinge wurde während des Psychologie-Studiums an der Universität Zürich im Nebenfach Sozial- und Präventivmedizin geschärft. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt liegt darin, dass Wissenschaftler auch nur Menschen sind und dazu tendieren, an liebgewonnenen Theorien lange festzuhalten, auch wenn neue Befunde dagegen sprechen. Anstatt sich an die Bildung neuer Modelle zu machen, werden die bestehenden mit teilweise spekulativen Elementen erweitert. Als Beispiel sei die dunkle Materie erwähnt, welche die Kosmologie benötigt, um die bestehenden Modelle mit den Beobachtungen in Übereinstimmung zu bringen. Aus den eigenen Reihen werden immer mehr Stimmen laut, die es für durchaus möglich halten, dass sich die theoretische Physik in eine Sackgasse verrannt hat. Gegenwärtig läuft die Suche nach dunkler Materie resp. dunkler Energie mit dem Teilchenbeschleuniger LHC am Forschungszentrum CERN in Genf .
All dies zusammengenommen hat mich bewogen, im Rahmen der Entschlüsselung des Medea-Mythos unsere gesamte kollektive Geschichte auszubreiten. Vielfach greife ich auf Überlieferungen aus der griechischen Antike zurück. Diese Quellen sind mit mehr oder weniger Unsicherheit behaftet. Was die Datierung betrifft, fördert die laufende Forschung gelegentlich neue Anhaltspunkte zutage. Es ist gut möglich, dass wir ein verzerrtes Bild der Antike haben, weil viel Material verloren ging und unsere Vorstellungen durch diejenigen Artefakte geprägt sind, die den Weg in unsere Zeit gefunden haben. Deutlich zeigt sich dies beispielsweise am Stand der technischen Entwicklung, welche durch die Erforschung des Mechanismus von Antikythera in einem neuen Licht erscheint. Auf der anderen Seite ist davon Abstand zu nehmen, die guten alten Zeiten zu idealisieren, denn objektiv betrachtet leben wir heute zumindest im westlichen Kulturraum in der besten aller Welten. Die metaphysische Deutung der Medea mag uns vor Augen führen, dass sich die Geschichte mehrmals wiederholt hat, dass wir jetzt aber erstmals vor der Möglichkeit stehen, aus der Wiederholung auszubrechen und in eine neue Epoche einzutreten.
1 Harari, Geschichte, 174 (siehe Literatur: Autor, Werk, Seite/Vers/Absatz)
2 Neue Zürcher Zeitung, NZZ am Sonntag, 29.9.2018
1. Der Mythos
Die Erzählungen aus der griechischen Mythologie haben in unserer Alltagssprache vielfältige Spuren hinterlassen und die homerischen Epen Ilias und Odyssee aus dem Sagenkreis des Trojanischen Krieges zählen zur ältesten vollständig erhaltenen abendländischen Literatur. Deshalb eignet sich dieser Sagenkreis besonders gut als Einstieg in die mythische Welt der alten Griechen, um anschließend über das weniger bekannte Argonautenepos die Verbindung zum Medea-Mythos herzustellen.
Der Sagenkreis um den Trojanischen Krieg umfasst weit mehr als die homerischen Epen. Allerdings liegen keine vollständigen Überlieferungen vor. Eine ungefähre Rekonstruktion ist anhand verschiedener Quellen möglich. So treffen wir leicht voneinander abweichende Erzählungen an, die im Endeffekt jedoch auf dasselbe Geschehen hinauslaufen. Im Vorgesang zur Ilias ist die göttliche Erwägung dargelegt, die zum antiken Nationalmythos der Griechen geführt hat.
Es gab eine Zeit, da die zahllosen übers Land schweifenden Völker die weite und breite Brust der Erde zu erdrücken drohten; Zeus sah dies und hatte Mitleid; in seinem weisen Rat beschloss er, die alles ernährende Erde vom Gewicht der Menschheit zu erlösen, indem er die großen Schlachten des Trojanischen Krieges entfachte, um ihre schwere Last durch den Tod erleichtern zu lassen: so wurden die Krieger vor Troja getötet, so erfüllte Zeus’ Wille sich.1
Und so nahmen die Dinge ihren unabwendbaren Lauf.
Von der olympischen Hochzeitsfeier zur Odyssee
Zur von Zeus erzwungenen Hochzeit der Meeresgöttin Thetis mit dem sterblichen Peleus, den späteren Eltern des Achilles, waren alle Götter eingeladen, außer Eris, der Göttin der Zwietracht. Von der Tür aus warf die beleidigte Eris einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „für die Schönste“ zwischen die feiernden Götter des Olymps. Daraufhin brach unter Hera, Zeus Schwester und Gemahlin, seiner Tochter Athene und seiner Schwiegertochter Aphrodite ein Streit aus, wem denn nun dieser goldene Apfel gebührte. Diese mythologische Episode ist der Ursprung des Begriffs Zankapfel, alternativ auch als Apfel der Zwietracht oder Erisapfel bezeichnet.
Zeus als höchster Olympier wurde um die Schlichtung des Streits angegangen. Er zog sich aus der Affäre, indem er das Urteil in die Hand eines Sterblichen legte. Der unschuldige und schöne Jüngling Paris, ein verstoßener Sohn des trojanischen Königs Priamos, wurde von Zeus zum Schiedsrichter bestimmt. Der Götterbote Hermes brachte die Göttinnen zum Königssohn. Sie umgarnten ihn und versprachen ihm eine Belohnung. Hera versprach ihm die Herrschaft über die Welt, Athene Weisheit und Aphrodite die Liebe der schönsten Frau der Welt. So konnte Aphrodite das Urteil für sich entscheiden.
Helena, die Schönste unter den Sterblichen, war jedoch bereits mit Menelaos verheiratet. Er war König von Sparta und der Bruder von Agamemnon, König von Mykene. Aphrodite sorgte dafür, dass sie sich bei der ersten Begegnung mit Paris in ihn verliebte. Das göttliche Versprechen mündete im Raub der Helena durch Paris und war Auslöser des Trojanischen Krieges. Nachdem alle Vermittlungsversuche zur Rückgabe Helenas gescheitert waren, segelten die Griechen in einer vereinigten Seestreitkraft mit nahezu zwölfhundert Schiffen unter dem Oberbefehl von Agamemnon gegen Troja. Die Stadt Troja mit ihren mächtigen Befestigungsanlagen war uneinnehmbar, und der Krieg zog sich über zehn Jahre hinweg. Die Ilias beschreibt 51 Tage gegen Ende des Krieges und legt im ersten Gesang das Thema vor.
Von der Bitternis sing, Göttin – von Achilleús, dem Sohn des Peleús, seinem verfluchten Groll, der den Griechen unsägliches Leid brachte und die Seelen zahlloser Krieger hinab in das Haus des Hades sandte, die blutvollen Leben dann nur noch Fleisch, an dem die Hunde fraßen, den Vögeln ein Festmahl – und wie Zeus’ Wille sich dadurch erfüllte…
Sing, Muse, und beginn mit dem Moment, wo der göttliche Achilleus sich in einem Streit mit seinem Kriegsherrn Agamemnon entzweite.2
Das zentrale Motiv der Ilias ist der Zorn des Achilles. Agamemnon nahm Achilles sein Beutemädchen Briseis weg, worauf dieser in seinem Stolz verletzt die weitere Teilnahme an den Kampfhandlungen mit den Myrmidonen aus Thessalien, deren Anführer er war, verweigerte. Zudem bat er durch seine Mutter Thetis erfolgreich, Zeus zu bewegen, die Trojaner fortan siegen zu lassen, bis ihm Genugtuung widerfahren sei. Wie schon bei der verhängnisvollen Hochzeitsfeier setzte ein gekränktes Ego einen unheilvollen Verlauf in Gang. Die Griechen erlitten massive Verluste und wurden von den Trojanern bis zu den Schiffen zurückgedrängt. Erst als sich die Niederlage der Griechen abzuzeichnen begann, erlaubte Achilles seinem treuen Kampfgefährten Patroklos als Anführer in seiner Rüstung mit den Myrmidonen in den Kampf zurückzukehren, nicht aber bis zur Stadt vorzurücken. Das Blatt wendete sich und die Trojaner wurden von der Küste zurückgedrängt. In seinem Schlachtrausch hielt sich Patroklos nicht an die Abmachung und verfolgte die Trojaner bis vor ihre Stadt, wo er von Hektor getötet wurde. Mit Patroklos Tod richtete sich Achilles Zorn nicht mehr gegen Agamemnon. Er hatte ein anderes Ziel gefunden: die trojanischen Krieger und besonders ihr Heeresführer Hektor, ein weiterer Sohn von König Priamos. In der folgenden Teilnahme an der Schlacht gelang dem schnellfüßigen Achilles die Tötung Hektors. Aus Rachsucht für die Tötung Patroklos durchbohrte er dem Leichnam zornentbrannt die Fersen, zog einen Riemen hindurch, befestigte ihn an seinem Streitwagen und schleifte ihn hinter sich her. Die Götter waren Hektor wohlgesonnen und sorgten dafür, dass die Schändung dem Leichnam nichts anhaben konnte. Durch Achilles Mutter Thetis ließen die Götter ihn wissen, dass er den Leichnam zurückgeben müsse. Des Nachts geleitete der Götterbote Hermes König Priamos durch das Lager der Griechen zu Achilles. Durch die von gegenseitigem Respekt geprägte Begegnung mit seinem „Feind“ Priamos fiel ihm sein blinder Zorn wie Schuppen von den Augen. Damit hatte sich das Motiv der Ilias erledigt und ihrem Ende zugeführt. Im Tausch gegen wertvolle Gaben wurde Hektors Leichnam ausgelöst. Achilles spricht zu Priamos die vielsagenden Worte:
Der donnernde Zeus hat zwei Tonkrüge in der Halle seines Palastes stehen. Im einen verwahrt er alles Glück, im anderen das Leid. Den meisten misst er eine Portion von allem beiden zu, drum geht es ihnen einmal besser, einmal schlechter. Wem er jedoch bloß aus dem Krug des Bösen schöpft, lässt er an ausgestreckter Hand verhungern. Verstoßen muss er über diese heilige Erde irren, von den Göttern und Menschen verachtet.3
Diese Worte beleuchten den Aspekt der Zweiteilung der Seele. Der Krug des Leids würde ein gekränktes Ego hervorbringen, wenn nicht gar dem Ego selbst entsprechen. Auch die Götter schienen davon nicht verschont geblieben zu sein. Sie traten in vielfache Interaktion mit den Menschen. So griffen die olympischen Götter ins Kampfgeschehen um Troja ein. Selbstredend war Aphrodite auf der Seite der Trojaner, Hera und Athene setzten sich für die Griechen ein. In einem frühen Abschnitt in der Ilias wird Paris von Aphrodite an einen anderen Ort versetzt, als er Gefahr läuft, getötet zu werden. Ihm war noch eine einschneidende Rolle zugedacht.
Im Kriegsverlauf nach den in der Ilias geschilderten Ereignissen wird Achilles am Skäischen Tor Trojas von einem tödlichen Giftpfeil in die Ferse getroffen, abgeschossen von Paris und ins Ziel gelenkt durch Apollon. Dadurch hatte sich die Prophezeiung erfüllt, dass Achilles vor Troja die Geschichte überdauernden Ruhm sowie den Tod finden würde. Die Achillesferse wurde das Synonym für die verletzlichste oder empfindlichste Stelle schlechthin. Streng chronologisch gesehen hätte Achilles zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind sein müssen, denn zwischen der verhängnisvollen olympischen Hochzeitsfeier und dem Kriegsbeginn dürfte nur eine kurze Zeit vergangen sein. Aber in Mythen gelten andere Regeln, sind es doch alles von Menschen erfundene Geschichten. Achilles Sohn Neoptolemos, der laut der Odyssee nach seinem Tod Anführer der Myrmidonen wurde, ist ein weiterer Widerspruch, stimmt Achilles doch nach den oben zitierten vielsagenden Worten zu einem Klagelied über fehlende Nachkommenschaft an.
Kassandra, Tochter von Priamos und Schwester von Paris und Hektor, hatte Apollon wegen ihrer Schönheit die Gabe der Weissagung verliehen. Als sie ihm auf seine Verführungsversuche hin die kalte Schulter zeigte, verfluchte er sie. Da er die ihr verliehene Gabe nicht zurücknehmen konnte, bestimmte er, dass niemand ihren Weissagungen glauben schenken werde. Immer das Unheil voraussehend, aber niemals Gehör findend, wurde sie zu einer tragischen Heldin. Derart ungehörte Warnungen werden seither als Kassandrarufe bezeichnet.
Im weiteren Schlachtgetümmel wurde auch Paris getötet, und Helena soll das Heimweh nach Sparta geplagt haben. Unter dem Eindruck des Misserfolgs vor Troja kam der einfallsreiche Odysseus auf die kriegsentscheidende List, ein großes hölzernes Pferd bauen zu lassen, die mutigsten Krieger darin zu verstecken und die Heimfahrt der Griechen vorzutäuschen. Als die Trojaner an der entleerten Küste das zurückgelassene Pferd entdeckten, beförderten sie es entgegen den eindringlichen Warnungen Kassandras und eines Priesters in die Stadt. In der Nachtruhe nach der Siegesfeier entstiegen die Krieger dem Holzpferd und öffneten der zurückgekehrten Streitmacht die Stadttore. Troja wurde geplündert, niedergebrannt und nur wenige Bewohner überlebten. Aus dieser Begebenheit stammt der gängige Begriff des Trojanischen Pferdes. Der Troja-Film von Wolfgang Petersen gibt einen guten Einblick in die Geschehnisse vor dem zehnten Jahrhundert v. Chr. in der späten Bronzezeit, wenn auch vom Mythos in leicht abgeänderter und verdichteter Form.
Nach dem Fall Trojas wurde Kassandra im Tempel der Athene von einem griechischen Krieger vergewaltigt. Hierbei ist zu bedenken, dass den Menschen in den Mythen ohne den Beistand der Götter ein schweres Los beschieden war. Die Ilias beginnt damit, dass der Apollon-Priester Chryses seine von Agamemnon erbeutete Tochter Chryseis gegen eine beträchtliche Goldsumme auslösen will. Doch Agamemnon verschmäht das Angebot und schickt ihn unverrichteter Dinge weg. Als treuer Diener Apollons bittet er seinen Gott, Gerechtigkeit walten zu lassen und die Griechen für ihr frevelhaftes Verhalten zu bestrafen. Apollon lässt im Lager der Griechen eine Seuche ausbrechen. Der bewährte Seher Kalchas deutet den Grund des Übels und wie es abzuwenden wäre. Widerwillig lenkt Agamemnon ein und beauftragt Odysseus, zur Insel des Chryses zu segeln, Chryseis zurückzugeben und dort 100 Rinder dem Apollon zu opfern, um den Zorn des Gottes zu besänftigen. Als Kompensation nimmt Agamemnon dem Achilles sein Beutemädchen Briseis weg. Dieser sieht sich in seiner Ehre verletzt mit den geschilderten Folgen.
Die Entweihung des Tempels der Athene durch die Schändung Kassandras an ihrem Altar kam einer direkten Demütigung der Göttin gleich und sollte sich als kolossale Dummheit herausstellen, stand Athene doch immer hilfreich auf der Seite der Griechen. Ohne ihren Beistand wird sich die Heimfahrt der Griechen als eine schier endlose Irrfahrt erweisen und als Odyssee in unseren Wortschatz übergehen. Besonders Odysseus musste viele unnennbare Leiden erdulden. Auf der Insel der einäugigen Riesen gerät er selbstverschuldet in die Gefangenschaft des Kyklopen Polyphem, einem Sohn des Meeresgottes Poseidon. Um ihm zu entkommen, blendet er ihn. Als Vergeltung bittet dieser seinen Vater, Odysseus zu töten oder seine Heimkehr sehr lange hinauszuzögern. Ohne Athenes Unterstützung und mit Poseidon gegen sich, dauert seine Odyssee bis zur Rückkehr in seine Heimat Ithaka zu seiner Gemahlin Penelope zehn Jahre. Dabei verliert er seine zwölf Schiffe, inklusive Mannschaft. Sieben Jahre wird er auf der Insel Ogygia von der Nymphe Kalypso festgehalten. Eine weniger lange Irrfahrt bringt Menelaos mit seiner wiedergewonnen Helena zurück nach Sparta.
Von der Odyssee zum Argonautenepos
Die homerischen Epen nehmen mehrfach Bezug auf das Argonautenepos. Viele Väter griechischer Helden vor Troja zählen zur Mannschaft des sagenhaft schnellen Schiffs Argo, beispielsweise Achilles Vater Peleus und Patroklos Vater Menoitios. Aus Lemnos war eine Anzahl von Versorgungsschiffen bei den Griechen gelandet – geschickt hatte sie König Euneos, der Sohn, den Jason auf seiner Argonautenfahrt damals mit Hypsipyle gezeugt hatte.4 Und die Seefahrergeschichten der Odyssee weisen Parallelen zur Argonautensage auf. Das auslösende Element dieser alten Sage findet sich in der Geschichte des Pelias. Er hatte sich durch die Tötung seiner Stiefmutter Sidero auf den Stufen eines Altars im Tempel der Hera den unversöhnlichen Zorn der Götterkönigin zugezogen. Wird im Trojanischen Krieg der Familienzwist ausgetragen, den Zeus unter seinen Frauen angezettelt hatte, so scheint in der Argonautensage Zeus Gemahlin Hera diejenige zu sein, die im Hintergrund die Fäden zieht und Gedanken eingibt, um alle Beteiligten in einem unabwendbaren Schicksal zu verstricken, das in Pelias Tod Erfüllung findet.
Pelias war der älteste Sohn von Tyro, Gattin des Kretheus, Gründer und Herrscher von Iolkos in Thessalien, aber in einer außerehelichen Affäre gezeugt. Nach Kretheus Tod gelang dem machthungrigen Pelias die Übernahme der Herrschaft in Iolkos gegen die leiblichen Söhne Kretheus. Bei der üblichen Orakelbefragung anlässlich seines Regierungsantritts erhielt er die zunächst unverständliche Warnung vor dem Einschuhigen. Jason, Sohn des ältesten leiblichen Kretheus-Sohnes Aison, wurde von der Göttermutter Hera in Gestalt einer Greisin gebeten, ihr bei der Überquerung eines Baches zu helfen. Dabei blieb ein Schuh im Flussbett stecken. Als Jason darauf einschuhig vor seinen Onkel trat, wurde Pelias die Bedeutung des Orakelspruchs klar. Um Jason loszuwerden, beauftragte er seinen Neffen mit der scheinbar unlösbaren Aufgabe, das Goldene Vlies, ein wertvolles Widderfell, herbeizuholen, das sich im Bereich der aufgehenden Sonne am östlichen Weltrand in Kolchis befinden sollte. Als Erfolgsprämie versprach er ihm den Thron in Iolkos. Unter göttlicher Anleitung baute Argos sodann die nach ihm benannte fünfzigrudrige Argo aus den Kiefern des Pelion-Gebirges. Im Bug wurde ein Stück Holz einer Eiche aus einem Zeus-Heiligtum eingebaut, damit das Schiff sprechen konnte.
Jason konnte die berühmtesten Helden Griechenlands für die Teilnahme an der Expedition gewinnen, die fortan in Anlehnung an den Namen des Schiffs Argonauten genannt wurden. In Iolkos stachen sie in See und erlebten auf der Hinfahrt mannigfaltige Abenteuer. Am schwierigsten erwies sich die Fahrt durch die Symplegaden am Eingang zum Schwarzen Meer. Das waren zwei sich abwechselnd öffnende und schließende im Meer treibende Prallfelsen, gegen die starke Strömung brandete und die alles sie Passierende zerquetschten. Nur dank Heras Hilfe gelangte die Argo heil durch die Meerenge der Symplegaden. Wie das von den Göttern bestimmt war, wenn einer sehenden Auges mit dem Schiff hindurchführe, blieben die Felsen nach der erfolgreichen Durchfahrt unbeweglich verwurzelt stehen. In der Odyssee berichtet Kirke von der erfolgreichen Durchfahrt der Argo, was darauf hinweist, dass der viel besungene Mythos bei ihrer Abfassung weit verbreitet war.
Nach der Ankunft der Argonauten in Kolchis begab sich Jason zu König Aietes, um die Bedingungen zur Herausgabe des Vlieses zu erfahren. Bei diesem Zusammentreffen war auch seine zauberkundige Tochter Medea anwesend, die sich Hals über Kopf in den Fremdling verliebte. Aietes trug Jason unlösbar scheinende Aufgaben auf, mit deren Bewältigung er das Anrecht auf das Vlies erlangen konnte. Aus Liebe half ihm Medea die Aufgaben zu bewältigen und dem Vlies habhaft zu werden. Als Gegenleistung hatte er ihr versprochen, sie zu seiner Gemahlin zu machen. Da Aietes nicht entgangen sein konnte, dass Medea bei der Bewältigung der Aufgaben ihre Hand im Spiel gehabt haben musste, sah sie sich genötigt, zusammen mit den Argonauten zu fliehen. Von der Verfolgung der Argo durch die kolchische Flotte konnten sie sich nur dadurch retten, dass Medea den Tod ihres Bruders Apsyrtos verschuldete. Medea und Jason heirateten. In Iolkos ersann sie ihm zuliebe eine List, durch die König Pelias zu Tode kam.
Das Goldene Vlies zu holen war nur der vorgeschobene Vorwand für die Argonautenfahrt nach Kolchis, denn in Wirklichkeit ging es darum, die zauberkundige Medea nach Iolkos zu bringen, weil ihre Hilfe bei Pelias Beseitigung erforderlich war. Damit gehören alle Beteiligten der Argonautenfahrt inklusive Medea zu Heras Instrumentarium, um ihrem Zorn auf Pelias durch dessen Tötung Genugtuung zu verschaffen.
Vom Argonautenepos zu Euripides
Die älteste und vollständig erhaltene Gesamtfassung der Argonautensage ist die Argonautika des Apollonios von Rhodos aus dem dritten Jahrhundert v. Chr. In verschiedenen Punkten weicht seine Version von der Urfassung ab. Er scheint die homerischen Epen genauestens studiert zu haben, denn die Rückfahrt enthält mehrere Stationen, die wir auch in der Odyssee antreffen. So fahren die Argonauten zur Insel der Kirke, einer Tante Medeas, um sich von ihr von der Blutschuld des Brudermords entsühnen zu lassen. Auf der Weiterfahrt segeln sie an der Insel der Sirenen vorbei, indem Orpheus mit seinem Gesang den Gesang der Sirenen übertönt, passieren Mithilfe der Nereiden die Meerenge von Skylla und Charybdis unbeschadet durch die Plankten, segeln an der Insel mit den Heliosrindern vorbei und erreichen schließlich als letzte gemeinsame Station die Insel der Phaiaken, wo sie auf König Alkinoos treffen. Die Argonautika enthält in der zweiten Hälfte, als Medea die Bühne betritt, sehr ausdrucksstarke Passagen, die uns bei der Deutung des Mythos wichtige Hinweise liefern. Im folgenden Ausschnitt begibt sich Aphrodites Sohn Eros in den Hof des Palastes von Aietes, als Jason, nach seiner väterlichen Abstammung als Aisonide benannt, mit Begleitern von seinem Schiff das erste Mal mit Medea, ihrer Familie und deren Hofstaat zusammentrifft.
Eros durcheilte unsichtbar die klare Luft. Auf der Schwelle im Vorhof spannte er schnell den Bogen und nahm aus dem Köcher einen leidbringenden Pfeil, der noch neu war. Unbemerkt überschritt er die Schwelle mit hurtigen Füssen, scharf umherspähend. Dicht hinter dem Aisoniden kauerte er sich nieder, legte die Kerbe in die Mitte der Sehne, spannte den Bogen mit beiden Händen und schoss geradewegs auf Medea: Sprachlose Verwirrung erfasste sie im Herzen. Eros eilte frohlockend zurück aus dem hochgebauten Palast; der Pfeil aber brannte tief im Herzen des Mädchens, einer Flamme gleich. Sie warf dem Aisoniden ständig verstohlene Blicke zu, und in ihrer Verwirrung verflüchtigte sich aus ihrer Brust der klare Verstand. Sie konnte keinen anderen Gedanken mehr fassen, und im süßen Schmerz zerfloss sie in ihrem Gemüt.5
Als Fortsetzung des Argonautenepos, oder unabhängig davon, hat sich der Mythos um Medea weiterentwickelt. Nach Pelias Tod verlassen Medea und Jason Iolkos und lassen sich in Korinth nieder. Dort leben sie einige Zeit mit ihren zwei Söhnen. Dann verstößt Jason Medea, um die Tochter des Königs Kreon