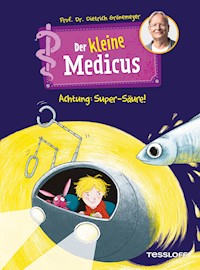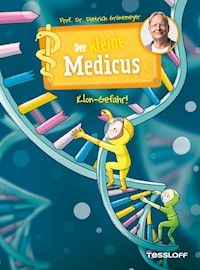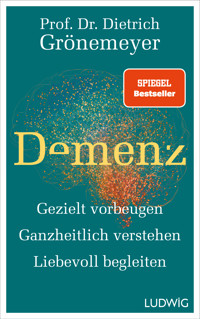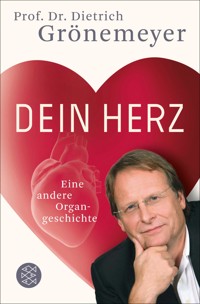19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Dietrich Grönemeyer
- Sprache: Deutsch
Werden wir gut behandelt?
Werden wir beim Arztbesuch wahrhaft gesehen und gehört? Werden wir kompetent und umfassend beraten und können uns – voller Vertrauen – auf empfohlene Maßnahmen einlassen, die auf unsere medizinische Situation individuell abgestimmt sind? Können wir davon ausgehen, dass das ganze Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten eingesetzt wird, um uns verbindlich zu besserem Wohlbefinden und Gesundheit zu verhelfen? Oder werden wir mit unseren Beschwerden, Ängsten und Sorgen einfach nur abgefertigt und letztendlich allein gelassen?
In seinem bislang persönlichsten Buch beschreibt Dietrich Grönemeyer anhand bewegender Erlebnisse und Erfahrungen, was sein Verständnis als Arzt geprägt hat – und was wir tun müssen, um als Gesellschaft zu guter Gesundheit zu finden: Wir brauchen eine Medizin, in der individuell und ganzheitlich auf die Patienten eingegangen wird, in der Prävention, Aufklärung und Eigenverantwortung eine entscheidende Rolle spielen, in der Heilkompetenzen kombiniert werden, Heilende als engagiertes, vertrauensvolles Team fungieren und das Arzt-Patienten-Verhältnis eine echte Begegnung auf Augenhöhe darstellt, wie es beispielsweise viele Krankenschwestern und Pfleger bereits vorleben, trotz großer Frustration und mangelnder Wertschätzung – menschlich wie finanziell. Die menschenferne Organisation und das Diktat der Ökonomie und Verwaltung in der Medizin verhindern zunehmend eine würdevolle Heilkunst zwischen HighTech und Naturheilkunde, zwischen Psychosomatik und Umweltmedizin.
Veränderung ist möglich – davon ist Dietrich Grönemeyer überzeugt. Sein Motto „Den Jahren Leben geben“ steht für eine Medizin des Wohlbefindens, in der jeder Mensch nur an einer Stelle stehen kann: im Mittelpunkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zeit für ein Umdenken in der Medizin
Wer krank ist, muss vertrauen können – auf Wertschätzung und Empathie von Ärzten und Krankenschwestern, auf Top- Kompetenz und die übergreifende Zusammenarbeit medizinischer Disziplinen. Doch die Realität sieht zum Leidwesen aller Beteiligten anders aus, bedingt durch menschenferne Strukturen des Gesundheitssystems und das Diktat der Ökonomie.
Wir können die Medizin verändern – davon ist Dietrich Grönemeyer überzeugt. In seinem bislang persönlichsten Buch beschreibt er, wie er die Medizin erlebt und mitgestaltet hat und welche bewegenden Erfahrungen sein Selbstverständnis als Arzt geprägt haben. Hierauf basieren seine Leitgedanken für eine Medizin, in der die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Menschen im Mittelpunkt stehen müssen: individuelle Fürsorge, Mitgefühl, Ängste nehmen, Selbstheilung und Heilen, Vernetzung und Digitalisierung der Medizin. Darum geht es ihm, um neue Rollen von Hausärzten und Krankenschwestern, um Kooperationen und Kompetenzzentren, Spitzenforschung und Innovation, Aufklärung und Eigenverantwortung – um das »Kapital Gesundheit« und vor allem um Vertrauen und Mut zum Miteinander.
PROF. DR. DIETRICHGRÖNEMEYER
MEDIZIN
VERÄNDERN
HEILUNG BRAUCHT ZUWENDUNG, VERTRAUEN UND MUT ZU NEUEN WEGEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde das generische Maskulinum verwendet. Die Personenbezeichnungen gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechter.
Die in diesem Buch vorgestellten Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Dennoch übernehmen der Autor und der Verlag keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der hier beschriebenen Anwendungen ergeben. Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall bzw. bei ernsthaften Beschwerden immer professionelle Diagnose und Therapie durch ärztliche oder naturheilkundliche Hilfe in Anspruch.
Originalausgabe 11/2022
Copyright © 2022 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Henning Thies
Umschlaggestaltung: Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch,
unter Verwendung eines Fotos von © Laura Möllemann
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29793-0V001
www.Ludwig-Verlag.de
Für Anja
Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.
Johann Wolfgang von Goethe
Inhalt
EINLEITUNG
1. KAPITEL: Wann ist der Mensch gesund?
2. Kapitel: Menschenwürdig heilen – wie geht das?
3. Kapitel: Pflegefall Medizin
4. Kapitel: Micro is more – mein Weg zur Mikrotherapie
5. Kapitel: Über Werte und Kosten
6. Kapitel: Die Kunst, zu leben und zu sterben
Nachwort: Mut zum Miteinander, gemeinsam neue Wege gehen
Do It Yourself – Kleiner Leitfaden zur Selbsthilfe
Dank
Anmerkungen und Quellen
Nicht ein »Erkenne die Kosten«, sondern die alte Weisheit vom Apollon-Tempel in Delphi »Erkenne dich selbst« – an jeden von uns gerichtet – wird uns helfen, die Zukunft der Gesundheit und die Zukunft der Menschheit langfristig zu gestalten.
Dietrich Grönemeyer
Einleitung
Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment des absoluten Verlorenseins. Ich war vier Jahre alt und stand mutterseelenallein in der Dunkelheit des Nichts, wortlos schluchzend, vor unendlicher Angst zitternd. Kleine Tränen kullerten an meinem Hals herunter, während eine bleibeschwerte Hand meinen Brustkorb und den Bauch abtastete. In meinem unendlichen seelischen Schmerz hörte ich aus dem Dunkel eine geisterhafte Stimme, die mich streng ermahnend anraunzte: »Einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen« …, und irgendwo vernahm ich aus der Ferne die leisen Rufe meiner Mutter: »Didilein, alles wird gut…!«
Wie gerne hätte ich sie damals getröstet. Ja, wirklich. Sie tat mir so unendlich leid in ihrem Weh und ihrer Angst um ihren ältesten Sohn. Aber ich musste ja selbst mit dieser gefühlten »Hölle« fertigwerden. Nackig zitterte ich in dem schwarzen Ungeheuer eines Röntgen- Durchleuchtungsgeräts und biss die Zähne aufeinander. Auf der einen Seite stand ich vor einem kalten quadratischen Etwas, das eng an meinen Vorderkörper drückte. Zwischendurch wurde mein Körper ohne mein eigenes Zutun immer wieder hoch- und runtergefahren. Ein Gefühl wie Fahrstuhl, Kirmes und Geisterbahn gleichzeitig – unter anderen Umständen hätte es ein lustiges Abenteuer sein können. Irgendwo auf der Gegenseite im gefühlten Nichts saß ein Arzt vor einem Bildschirm – wie ich später, viel später begriff – und beurteilte mit knappen Worten mein Inneres. Immer wieder raunzte mich seine Stimme aus dem Dunkeln an: »Nicht einschlafen, Junge, noch einen kräftigen Schluck aus dem Becher.« Mich ekelte. Er hätte mich ja wenigstens begrüßen und nach meinem Namen fragen können. Am liebsten hätte ich ihm die ganze »Brühe« über die Schulter gespuckt. Aber er war ja unsichtbar, selbst ein Nichts im Nichts. Glauben Sie mir, es war das Abscheulichste, was ich jemals getrunken habe: ein widerlich stinkendes schleimig-zähes Gesöff. Mit solch einem Kontrastmittel wurden damals, lange bevor die Magen-Darm-Spiegelung aufkam, die Speiseröhre, der Magen und der Darm unter dem Röntgenschirm sichtbar gemacht. Brrrr. Und zu allem Überfluss auch keine tröstenden Worte, keine Erklärung, keine Verabschiedung.
Schrecklich. Im Nachhinein hätte ich ihm vermutlich vors Schienbein treten sollen … Macht man doch so als kleiner Junge. Oder?
Ich litt zu dieser Zeit immer wieder an Bronchitis, Mandel- und Ohrentzündungen sowie an Bauchgrummeln. Da meine Mutter übervorsichtig und ihre Schwester internistische Chefärztin im Krankenhaus war, wurde ich häufiger bei kleinen Wehwehchen zum Arzt »verschleppt«. Echte Torturen für mich – wie Sie sich vermutlich gut vorstellen können.
Es sind nicht nur Erlebnisse dieser Art aus meiner Kindheit, die bis heute nachhallen. Immer wieder wurde und werde ich als Arzt, als Vater und Großvater und als Patient (der ich selbst gelegentlich ebenfalls bin) im medizinischen Alltag der Gegenwart damit unangenehm berührt. Es sind Erfahrungen der Hilflosigkeit, des Alleingelassen-Werdens, der mangelnden Wertschätzung und fehlenden Empathie. Erfahrungen, die verängstigen können, die empören und fassungslos machen. Ihre Tragweite ist für unsere Gesundheit und für unsere Einstellung zur Welt viel zu ausschlaggebend, als dass wir uns als Ärzte, Krankenschwestern und Patienten damit abfinden dürften. »Muss das denn so sein?«, habe ich mich in solchen Momenten immer wieder gefragt. Wieso ist es so schwierig, der Situation angemessene tröstende Worte zu finden? Und damit meine ich nicht, dass man lapidar »Das wird schon wieder« zu hören bekommt. Oder: »Das tut bestimmt nicht weh!« Wie oft habe ich selbst erlebt, dass es gerade dann höllisch wehtut. Nein, ich meine ein vertrauensvolles Gespräch, in dem man in Ruhe aufgeklärt wird. Damit man sich mit seiner Angst nicht unverstanden fühlt. Sonst ist man schlussendlich nicht beruhigt. Nicht, weil der Arzt oder die Therapeutin die Methode des Untersuchens, Spritzens oder Katheter-Legens nicht beherrschen würde, sondern, weil die Empathie, das Fingerspitzengefühl und die Worte fehlen. Kein Wunder, wenn dann Tränen kullern oder wenn man dann so verspannt ist, dass der ganze Körper, die gesamte Muskulatur vor Angst so hart wie ein Brett wird. Oder gar die Ohnmacht einen niederstreckt.
Könnte man solche Zustände nicht ändern? Und wenn, wie? Dem Kranken als Arzt nicht als verstörende Autorität, geradezu herrschaftlich, sondern auf Augenhöhe zu begegnen, Angst zu nehmen, aufzuklären und verständlich zu reden, das halte ich nach wie vor für eine der wichtigsten Voraussetzungen jeder erfolgreichen Therapie. Und diese Haltung vermisse ich seit meiner eigenen Kindheit. Warum – so frage ich mich seit Jahrzehnten – wird nach wie vor vergessen, dass liebevolle Zuwendung, Vertrauen und solidarisches Miteinander in der Medizin so wesentlich für den Patienten, für seine Einstellung zur Medizin und damit für seine Heilung sind?
Aus solchen leider viel zu zahlreichen Erfahrungen auf meinem Lebensweg hat sich für mich als Arzt eine klare Haltung herauskristallisiert: Nicht ein »Erkenne die Kosten«, sondern die alte Weisheit vom Apollon-Tempel in Delphi »Erkenne dich selbst« – an jeden von uns gerichtet – wird uns helfen, die Zukunft der Gesundheit und die Zukunft der Menschheit langfristig zu gestalten.
Drei Säulen für eine menschliche Medizin
Es sind drei Maximen, die für mich das Fundament einer dem Menschen zugewandten Medizin ergeben – so wie ich sie zu vertreten immer bemüht bin:
1. Heilung braucht Zuwendung und Vertrauen,
2. Medizin ohne Seelsorge ist keine Medizin,
3. Medizinische Kompetenz-Teams sind die Zukunft.
Heilung braucht Zuwendung und Vertrauen
Was hat sich in den letzten 65 Jahren in der Medizin nicht alles zum Guten verändert? Die Krankenhäuser sind architektonisch und von der Ausstattung sehr viel moderner geworden, die Technik hat gigantische Fortschritte zu verzeichnen, es gibt fantastische Behandlungs- und Operationsmethoden, wir können fast jeden Körperteil (bis auf den Kopf) transplantieren, Impfstoffe in Rekordzeit entwickeln, Krankheiten wie die Pocken ausrotten oder die Kinderlähmung durch pharmazeutische Produkte besiegen.
Mit dem Computertomografen und besonders mit der Kernspintomografie ist es möglich geworden, transparent die gesamte Anatomie des Körpers bis in die Zellen hinein anzuschauen und zu beurteilen. Sogar, ohne den Körper mit dem Skalpell zu öffnen. Vielleicht bin ich deshalb Radiologe geworden? Trotz der schlimmen Erlebnisse als kleiner Junge im Röntgengerät – oder gerade deshalb, unbewusst? Fasziniert davon, dass man, ohne den Körper zu öffnen, seine Details so genau anschauen kann, war ich schon immer. Aber nicht mit den Menschen auf Augenhöhe zu sprechen, ihnen nicht in Würde zu begegnen und sie liebevoll zu behandeln, das macht mich seit meinem vierten Lebensjahr traurig und wütend. Und genau das hat sich im Turbo-Alltag der Zwei- bis Fünfminutenmedizin bis heute leider nicht geändert.
Natürlich gibt es gute Gegenbeispiele, ärztlich und besonders wenn Krankenschwestern die Kranken behandeln. Aber im allgemeinen Medizinbetrieb werden wir Menschen wie seelenlose Materie, wie Körpermaschinen und nicht als Individuen behandelt. Der heutige Medizinbetrieb ist straff ökonomisch geprägt und durchorganisiert. Statt Zuwendung gibt es eine Tablette oder eine Operation. Statt psychosomatisch-sozial orientierter Gespräche und persönlicher Untersuchungen des Körpers viel Technologie. Statt Seelsorge Sterbehilfe. Statt eines vorsichtigen Behandlungsbeginns mit Hausmitteln oder Naturmedizin, die eine begleitende Behandlung des Arztes erfordern würden, meistens sofort schulmedizinische »Geschütze«. So sieht die medizinische Realität bis heute aus. Weltweit. Und körperliche und psychische Krankheiten nehmen zu.
Den kranken Menschen als Individuum wahrnehmen und auf Augenhöhe behandeln
Bei allen unbestreitbaren und unverzichtbaren Erfolgen der modernen, hoch technisierten und spezialisierten Medizin besteht die Tendenz, dass sich Ärzte mit einer ausschließlich körperlichen medizinischen Wiederherstellung begnügen – anstatt den Menschen auch in seinen psychischen und intellektuellen Eigenschaften sowie in seinen gesellschaftlichen und kulturellen Bezügen wahrzunehmen. Ferner ist mit der Technisierung der Medizin eine Konzentration des Arztes auf feste Krankheitsbilder verbunden, die es anhand »objektiver« Labor-, Elektro- oder Bilddaten festzustellen und dann nach den »Regeln der Kunst« zu behandeln gilt. Die kranke Person als Individuum rückt damit in Anamnese, Diagnose und Therapie immer mehr in den Hintergrund.
Der Patient oder die Patientin als Mensch und Dialogpartner des Arztes findet in der modernen, immer unpersönlicher werdenden und zunehmend »datenorientierten« Medizin immer weniger Beachtung. Und damit geht auch das Bewusstsein verloren, dass der Patient nicht nur eine Krankheit hat, sondern ein fühlendes und denkendes Wesen ist, das in seiner Gesamtheit von einer Krankheit betroffen ist – einer Krankheit, die vielleicht auch aus seiner oder ihrer Lebensgeschichte und Lebenseinstellung resultiert und die nun das Leben und die Einstellung dazu umgekehrt beeinflusst.
Gesundheit, das Ziel allen ärztlichen Handelns, ist nicht die Abwesenheit von Krankheit (und wird nicht durch das bloße Abstellen von Krankheitssymptomen erlangt). Gesundheit ist vielmehr ein lebenslanger, dynamischer Prozess, um den sich der einzelne Mensch, die Wissenschaft und die Gesellschaft, gegebenenfalls unter Mithilfe der Medizin und des Arztes, immer wieder bemühen müssen. Es geht auch um das psychosomatisch-soziale Wohlbefinden – für körperlich gesunde, für kranke wie für gehandicapte Menschen.
Gesundheit kann zwar als ein Ganzes begriffen werden, man kann sie aber nicht allgemeingültig bestimmen oder definieren. Denn Gesundheit ist individuell – sie hat immer auch mit persönlicher Befindlichkeit, Geschichte und einem Lebensentwurf zu tun. Also ist sie stets relativ auf den konkreten Menschen hin zu fassen. Das bedeutet aber auch, dass sie und das momentane wie das langfristige persönliche Wohlbefinden jeweils von Arzt und Patient gemeinsam erarbeitet werden müssen. Die Zukunft gehört einer sprechenden, hörenden und mitfühlenden Medizin als Grundlage einer menschlichen Humanmedizin. (»Human« bedeutet hier »zum Menschen gehörig«, nicht »menschlich«, wie die meisten von uns denken. Diesen Fehler habe auch ich lange gemacht.) Wir unterscheiden ganz neutral zwischen den Disziplinen Human-, Zahn- und Tiermedizin. Ob diese dann im Sinne einer humanen Moral und Ethik ausgeübt werden, darüber entscheiden die bewusste Haltung und das praktische Handeln.
Manchmal kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Haustiere besser versorgt werden als wir Menschen, besonders unsere Kinder. Welch ein Aufwand wird für Nahrung, Spielzeug und medizinische Versorgung für Hunde, Katzen, Hamster oder Wellensittiche betrieben. Wie liebevoll wird mit ihnen umgegangen, selbst wenn der Haussegen zwischen den Menschen, bei denen sie leben, in Schieflage geraten ist. Und wenn sich die geliebten Haustiere einmal falsch verhalten, werden sie danach meist liebevoller behandelt als Menschen. Auch wenn sie kränkeln. Tiere genießen es, wenn man sie streichelt, tröstet und liebevoll zu ihnen spricht. Sie kuscheln, schnurren und schmusen.
Wir Menschen sehnen uns genauso danach, wenn es uns schlecht geht, wenn wir erkranken, wenn wir Angst oder Schmerzen haben. Gerade dann wären gefühlte menschliche Wärme und Nähe, wäre eine zugewandte Atmosphäre so wichtig, nicht nur allgemein zwischen den Mitmenschen, sondern insbesondere während einer medizinischen Behandlung. Gerade in solchen Momenten wäre es von größter Bedeutung, Vertrauen zu schaffen, zuzuhören, zu trösten oder Hoffnung zu geben, positive Perspektiven zu entwickeln.
Medizin ohne Seelsorge ist keine Medizin
Ein Patientenverhältnis auf Augenhöhe sowie Medizin und zugleich Seelsorge – mit solchen Vorstellungen über die Ausbildung zum Arzt begann ich 1972 mein Medizinstudium in Kiel. Dass diese Aspekte in der tatsächlichen Mediziner-Ausbildung eine völlig untergeordnete Rolle spielten, begriff ich allerdings schnell. Ich wollte viel und unermüdlich lernen, aber nicht nach Methoden, die mir vorkamen wie aus dem 19. Jahrhundert. Ja, angesichts des verschulten naturwissenschaftlichen Lehrbetriebs waren meine Erwartungen schon fast sträflich naiv gewesen. Bis wir zum ersten Mal Patienten überhaupt zu sehen bekamen, verging eine lange Zeit. Philosophisch-ethische Reflexionen und Diskussionen über Leben, Sterben und Tod, über Sterbehilfe oder die Menschenverträglichkeit von Behandlungsmethoden hatten von Anfang bis Ende im Studium keinen Platz. Den Begriff »Menschenverträglichkeit«1 etwa habe ich erst viel später, 1996, im Rahmen meiner Habilitation (so nennt man die Qualifikationsprüfung für Professoren) in Analogie zum Begriff »Umweltverträglichkeit« geprägt.
Symptomatisch war bereits der allererste Tag meines Studiums. Ich wurde vor ein Mikroskop gesetzt, um mir Gewebestrukturen anzuschauen, die bunt und bisweilen sogar ästhetisch wirkten, mit denen ich aber nichts anzufangen wusste, da wir keine Patienten sahen, aus deren Leiden man sich hätte erschließen können, was es damit auf sich hatte. Wir studierten sozusagen abgeschirmt vom Leben – damals unbegreiflich für mich, zumal es speziell meine eigene Schmerzerfahrung nach einer Nasenoperation war, die mich überhaupt erst bewogen hatte, Medizin zu studieren.
Diese Schmerzerfahrung aus meiner Bundeswehrzeit, liebe Leserin und lieber Leser, war so brutal, dass sicher niemand von Ihnen sie hätte machen wollen. Es war am Tag nach der Operation meiner Nasenscheidewand wegen starken Schnarchens. Und die Schmerzen, als mir zwei zur Blutstillung eingesetzte Tampons aus den beiden Nasenlöchern entfernt wurden, waren so schlimm, dass ich glaubte, man hätte mir mit den Tampons auch Teile des Gehirns herausgerissen. Ohne ein Wort der Aufklärung oder Zugewandtheit hatten sich zwei Ärzte plötzlich und unerwartet zu mir gesetzt. Ihre einzigen Worte waren: »Kopf in den Nacken, Junge.« Sie hatten zu (gefühlt riesigen) Zangen gegriffen und ohne Vorwarnung die Tampons aus der Nase gerissen. Mit den belanglosen Worten »Das wird schon wieder und kann noch ein bisschen nachbluten. Aber das regelt gleich die Schwester« verschwanden sie im Nirgendwo. Ja, wie so häufig war es dann eine Krankenschwester und nicht ein Arzt, die die »Angelegenheit« rettete und mich als Mitmenschen behandelte, die mich lange tröstete und wirklich auch beruhigen musste. Der Ärger auf die Ärzte blieb, und auch das Schnarchen hatte sich zu meinem eigenen Leidwesen, und zu dem der anderen, nicht verbessert …
Später, bei einem Praktikum in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Kiel, verstand ich, dass die Entfernung von Tampons aus der Nase damals in dieser Weise üblich war und dass Nachblutungen nach der Operation durch Verkrustung immer dazu führen, dass die Tampons in der Nase stark fixiert sind. Erst später wurden Möglichkeiten gefunden, diese Prozedur viel eleganter und schmerzärmer zu gestalten. Trotzdem bleibe ich dabei: Das Verhalten der Bundeswehr-Ärzte war weder medizinisch akzeptabel noch human – auch wenn zu damaligen Zeiten der zwischenmenschliche Ton, besonders zwischen Arzt und Patienten, deutlich rauer und herrischer war, als es heute zum Glück der Fall ist. Das Schmerzerlebnis führte bei mir jedoch schlagartig zu dem Wunsch, Arzt zu werden. Um mitzuhelfen, dass die Medizin der Zukunft feiner, schmerzloser, fürsorglicher und menschengerechter wird. Ich hätte am liebsten sofort »mit angepackt«. Das war die positive Seite des Operationserlebnisses. Doch um überhaupt ein wenig mitgestalten zu können, lag noch ein langer Weg vor mir.
Heute weiß ich, dass das Physikum – das Pauken der Anatomie und der Gewebestrukturen bis in den Zellkern hinein sowie anderer lebloser Fächer – eine unabdingbare Voraussetzung jeder ärztlichen Ausbildung ist. Denn ohne Kenntnis der Fakten, mit dem bloßen Willen, helfen zu wollen, und mit menschlicher Nähe allein lässt sich keine Krankheit heilen. Ohne Empathie und Seelsorge, also ohne das Vermögen, sich in Patienten einzufühlen und sich auf sie einzulassen, sondern allein gestützt auf die naturwissenschaftliche Erkenntnis, ist allerdings ebenso wenig auszurichten. Das ist der entscheidende Konflikt, der im Sinne einer humanen Humanmedizin dringend gelöst werden muss.
Woran es die universitäre Ausbildung fehlen ließ, das habe ich mir nebenher mit anteilnehmender Faszination angeeignet, indem ich, wann immer ich Zeit dazu hatte, besonders an Wochenenden und in den Ferien, als Pfleger in verschiedenen Kliniken und auf Intensivstationen aushalf – und dabei sehr viel von den wundervollen Krankenschwestern lernte. Ein Berufszweig, der seit jeher nicht genug wertgeschätzt wird, weder menschlich noch finanziell. Was den Umgang mit Patientinnen und Patienten und mit deren Ängsten anlangte, waren sie meine eigentlichen Lehrmeisterinnen, mehr noch als die hoch qualifizierten Fachärzte. Sie wussten, wie wichtig es ist, die Kranken zu beruhigen, ihre Furcht zu bannen, ihnen Mut zu machen oder sie zu trösten. Wie wichtig es ist, auch den im Koma Liegenden die Hand zu halten und ihnen zuzureden. Denn was wissen wir schon, ob und wie solche Patienten empfinden, selbst wenn sich das naturwissenschaftlich bisher nicht belegen lässt? Ist der Hirntote wirklich tot? Fühlt der anästhesierte Mensch wirklich nichts? Ich weiß es nicht und mag mir darüber kein Urteil anmaßen. Ich bin mir aber sicher, dass menschliche Nähe auch bei Komatösen wohltuend wirken kann und dass alles sehr viel einfühlsamer gehen könnte, als es in der Regel und in der Hektik des betriebswirtschaftlich optimierten Alltags in Kliniken und Praxen vielen möglich scheint, nach wie vor. Gerade auf den Intensivstationen, im Angesicht des Todes, habe ich sehr viel vom Leben gelernt und begriffen. Sieben wichtige Lektionen, die ich im medizinischen Alltag und nicht im Hörsaal oder aus den vielen Büchern gelernt habe, haben mich geprägt. Die überhaupt wichtigste und ersteLektion für meinen medizinischen Werdegang, »Behandeln heißt: die Seele streicheln«, lernte ich von den Patienten, von Menschen, die mit dem Tod rangen
Das Grundproblem einer menschengerechten Behandlung im Gesundheitssystem ist immer lösbar, wenn es mental erfasst und verstanden wird, wenn man wirklich spürt, dass ein Zustand menschlich unwürdig ist, und sich sofort um Abhilfe bemüht. Auf die Politik kann man dabei zunächst nicht zählen. »Selbst ist der Mann, und anpacken«, sagt man im Ruhrgebiet. Das Motto »Ärmel hoch und ran! Glück auf« hat sich als Bonmot im deutschsprachigen Raum verbreitet. Ich habe diese Haltung von den Kumpeln, den Bergleuten, erfahren und persönlich erlebt, die sich in den 1960er- und 1970er-Jahren im Zuge der Stilllegung ihrer Zechen zu Krankenpflegern umschulen ließen. Viele von ihnen brachten Schwung in den tristen Alltag der Krankenhäuser, packten an wie unter Tage, lösten Probleme vor Ort und sofort und waren liebevolle und tatkräftige Pfleger. Ein wesentlicher Faktor, der sich bei mir tief eingeprägt hat und seitdem fester Bestandteil meines tagtäglichen Lebens und Handelns ist. Von ehemaligen Bergleuten, die sich zu Krankenpflegern ausbilden ließen, lernte ich mit Begeisterung meine zweite Lektion: »Anpacken und nicht labern.«
Wie wichtig das Einfühlen in einen Menschen und das fürsorgliche Kümmern sind, habe ich nicht nur von Krankenschwestern und Krankenpflegern gelernt. Später nahm mich ein Landarzt an die Hand. Ich fühlte mich verstanden und begriff, dass das ehrliche und empathische Kümmern Vertrauen schafft – und damit die Grundvoraussetzung, dass ein Mensch sich öffnet. Dass er über sich erzählt, sein Leiden, seine körperlichen und seelischen Symptome schildert und dann auch bereit ist, seinen Frust und seine sozialen Probleme, zu Hause und am Arbeitsplatz, nach und nach zu äußern. Das braucht Zeit und Offenheit auf beiden Seiten. Aber es ist die Grundlage für eine effiziente Diagnose und Therapieplanung.
Zuhören, Anschauen, Riechen, Berühren und Intuition zur Diagnose – Medizin kann so einfach sein
Ich durfte den Landarzt bei seinen Hausbesuchen begleiten. Auf der Rückfahrt von einer dieser Visiten erklärte er mir im Auto: »Zuerst müssen Sie sich den Patienten genau anschauen, mit ihm reden, ihm zuhören. Die Laboranalysen nachher können nur bestätigen oder widerlegen, was Sie auf den ersten Blick gesehen und nach dem Gespräch vermutet haben. Mit Ihrem Wissen und all dem, was der Patient Ihnen mitgeteilt hat, über Ernährung und Stuhlgang, Schmerzart und Schlaf; aus der Beobachtung seines Aussehens, seiner Ausdünstungen aus Mund und Haut; aus seinen Bewegungen und Ihrer körperlichen Untersuchung bekommen Sie die wesentlichsten Informationen. Wenn Sie konzentriert und präzise sind, wenn Sie sich wirklich Zeit nehmen und auch intuitiv den Menschen erfassen, werden Sie ihn in seiner Ganzheit, als Individuum, erfassen. Da bin ich mir sehr sicher! Die Laboranalysen und radiologischen Bilder danach können nur bestätigen oder widerlegen, was Sie als Erkenntnis herausgefunden haben. Wenn Sie so vorgehen, werden Sie selten falschliegen. Und die Patienten werden es Ihnen danken.« Dies ist die beste Grundlage für eine vertrauensvolle Individualmedizin, die den Menschen in seiner Gesamtheit sieht. Diese Lektion, meine dritte, habe ich von einem Landarzt gelernt.
Er behandelte, wie es ihn neben der Ausbildung seine Erfahrung und seine Sinne gelehrt hatten – in der Regel ohne großes technisches Equipment. Nur mit Händen, Augen, Ohren, Nase – und mit Einfühlung. Er musste vor keiner Autorität kuschen, bedurfte keiner Uniform, um sich Bedeutung zu geben. Fuhr er aus, so blieb der weiße Kittel am Haken in der Praxis hängen. Und wenn er ihn schon einmal mitnahm, sozusagen für den Notfall einer womöglich blutigen Behandlung, hatte er ihn meist auf dem Rücksitz des Autos vergessen, wenn er das Krankenzimmer betrat. Dort hätte das weiße Ornat doch nur Distanz geschaffen. Deshalb auch habe ich Jahrzehnte später im eigenen Institut immer Wert darauf gelegt, dass keiner meiner Kolleginnen und Mitarbeiter einen weißen Kittel trug. Begegnung von Arzt und Patient auf Augenhöhe, beide im Alltagszivil und mit offenen Herzen, aneinander interessiert – das war die Devise.
Schnell stand als Student mein Entschluss fest, selbst Landarzt werden zu wollen. Später ist es anders gekommen. Doch auch die Entscheidung für die Radiologie rührte aus meiner landärztlichen Lehrzeit her. Ich wollte einfach in der Lage sein, mir und meinen Patienten zu erklären, was auf den Röntgenbildern zu sehen ist. Vor allem jedoch wurde mir während der Hausbesuche auf dem platten Land klar, wie wichtig es ist, die Lebensverhältnisse sowie die familiären Situationen zu verstehen, um den Kranken – oder auch denen, die vielleicht nur meinten, krank zu sein – ärztlich helfen zu können.
Das verstand sich, bei allem, was den Ärzten zugutezuhalten war, damals keineswegs von selbst. Während des Studiums waren wir auf den menschlichen Umgang mit Menschen nicht vorbereitet worden. Auch schien es noch unter der Würde der Koryphäen zu sein, ein Krankenzimmer zu betreten, wenn darin eine Patientin oder ein Patient lag, die dem sicheren Tod entgegenging. Im Sterben die Versöhnung mit dem Leben zu erkennen, lernte ich wiederum von den Schwestern und Pflegern, und zwar während der radiologischen Facharzt-Ausbildung auf der Krebsstation der Kieler Radiologischen Universitätsklinik. Ich lernte, den Todgeweihten die Hand zu halten – das Einfachste, das einem oft so schwerfällt, weil wir uns der eigenen Hilflosigkeit bewusst werden. Obwohl es doch den Kranken so viel bedeutet, obwohl es so angstbefreiend wirkt. Was, fragte ich mich angesichts des deprimierenden Leids, ist von einer Heilkunst zu halten, deren stolze und technisch perfekte Vertreter sich vor der Begegnung mit dem Tod scheuten, die das Sterben ausblendeten, wenn sie nur der Überzeugung waren, alles richtig gemacht zu haben – so, wie das Lehrbuch es vorschrieb? Operation gelungen, Patient tot, sagt der deftige Volksmund, oftmals nicht ganz zu Unrecht. Doch»Es gilt, im Sterben die Versöhnung mit dem Leben zu erkennen«.Diese weitere wichtige Lektion, die vierte, lehrte mich das Leben.
Kompetenz-Teams gehört die Zukunft
Eine wichtige Lehrmeisterin, die mir die Augen öffnete und der ich viel zu verdanken habe, war eine koreanische Krankenschwester. Sie lehrte mich, wie schmerzarm, oder besser noch schmerzlos, Spritzen gesetzt werden können. Diese Technik habe ich mir zu eigen gemacht und immer weiterentwickelt. Damals, in den 1970er- und 1980er-Jahren, wurde in den Kliniken, in denen ich als Student oder Assistent arbeitete, nach dem Motto behandelt: »Indianer kennen keinen Schmerz«, also ohne auf Angst und Schmerzen der Patienten wesentlich Rücksicht zu nehmen. Schmerzen infolge medizinischer Anwendungen, wie Spritzen oder Wundmaterialentnahme, waren den Behandelnden meistens egal – fast immer noch so, wie ich es in meiner Kindheit und später erlebt hatte. Als Patient fühlte man sich dann alleingelassen, und die Angst vor dem zu erleidenden Schmerz stieg von Behandlung zu Behandlung. Für mich als jungen Arzt war das völlig unverständlich, und ich war untröstlich.
Unverständlich waren mir vor allem auch die vielen, aus meiner Sicht unnötigen Rückenoperationen, die zur damaligen Zeit das Mittel der Wahl bei Rückenschmerzen waren – mit damals noch großen Schnitten am Rücken, häufigen Infektionen und unvorstellbar langen Liegezeiten der Patienten in den Krankenhäusern und anschließend noch langen Aufenthalten in Rehabilitations- und Kurkliniken. Nicht wenige kamen zur zweiten oder dritten Nachoperation. Als junger Assistenzarzt nahm ich nachts sozusagen jeden Patienten mit in meine Träume und versuchte, Schmerzen zu lindern oder Operationen zu vermeiden.
Zum Glück erlöste mich meine koreanische Krankenschwester von diesem Trauma. Sie erklärte mir, dass in Asien bei Weitem nicht so viel operiert werde und dass Schmerzen mit Massagen, warmen Kräuterwickeln oder Kräutertinkturen, mit Akupunktur und lokalen Injektionen, also mit Lokalanästhetika, behandelt würden. Sie war rührend zu den Patienten, klärte in gebrochenem Deutsch auf, wenn die ärztlichen Informationen spärlich waren, nahm Patienten in den Arm, verscheuchte die Angst, gab Zuversicht und Anleitungen zur Selbsthilfe, vor und nach der Operation.
Sie war es auch, die mich darüber aufklärte, dass man am Rücken zwischen den Gelenkschmerzen der kleinen Wirbelgelenke (Facetten) und bandscheibenbedingten Schmerzen unterscheiden müsse. Erstere verbessern sich durch Bewegung, Schmerzen durch vorgefallene Bandscheiben aber verschlimmern sich. Wie zum Beweis zeigte sie mir, dass man Facettenschmerzen durch Lokalanästhesie betäuben kann, die anderen nicht. Und so lernte ich von ihr die körperliche Untersuchung des Rückens und das schmerzfreie Injizieren – die fünfte Lektion meines zukünftigen Arztseins. Für die spätere Entwicklung der Mikrotherapie war dies die bedeutsamste und wesentlichste Vorbereitung. Sie führte zu einer schmerzarmen, sanften und schonenden operativen Behandlungsmethode.
Und die sechste Lektion folgte kurze Zeit später, als sie mir zusammen mit dem Masseur und der Krankengymnastin, mit denen sie zusammenarbeitete, erklärte, wie wichtig die innere Haltung im Umgang mit Schmerzen ist: Akzeptanz des Schmerzes, bewusstes Atmen in den Schmerz hinein, Gelassenheit, innere Ruhe finden sowie Motivation, sich selbst zu heilen. Dazu gilt es herauszufinden, welche Körperhaltung, welche Bewegung oder Massage den Schmerz lindert, welche ihn verschlimmert. Mit einer solchen Haltung richtet man sich innerlich wieder auf und gibt damit auch den positiven Anstoß für die äußere Haltungsänderung und die Selbstregulations- und Regenerationskräfte des Körpers. Umgekehrt schwächt eine angstbesessene, mutlos gekrümmte äußere Haltung des Rückens unsere innere Haltung. Sie könnte uns im Lauf der Zeit chronische Schmerzen, Bandscheibenvorfälle, Gelenksarthrosen oder Osteoporose bescheren.
Auf die Haltung kommt es an
Gefühle verändern die Muskelspannung – das habe ich schon damals gelernt. Menschen, die »die Zähne zusammenbeißen«, verspannen sich im Bereich der oberen Halswirbelsäule. Wer viel ertragen muss, viel »auf dem Buckel« oder die »Angst im Nacken« hat, hebt unbewusst die Schultern. Manchem wird »das Kreuz gebrochen«, andere »ziehen den Schwanz ein« und versteifen im unteren Rückenbereich. Etwa 85 Prozent der Rückenleiden sind unspezifisch, lassen sich also auf keine klare Ursache zurückführen.2 Fest steht nur, dass es in über 80 Prozent der Fälle akuter Rückenschmerzen muskuläre Verspannungen sind, die ursächlich wirken, während die vielfach vermuteten Verschleißerscheinungen gerade einmal mit 10 Prozent und die Bandscheibenvorfälle gar nur bis zu 5 Prozent zu Buche schlagen.3 Verantwortlich dafür ist die enge Verbindung der Muskulatur mit unserem limbischen System, dem »Gefühlsorgan« des Gehirns. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass bei 80 bis 90 Prozent der Patienten die chronischen Rückenschmerzen mit leichten depressiven Zuständen verbunden sind.
Eine Änderung der inneren Haltung, die auf der Erkenntnis des Problems fußt, würde Linderung schaffen und den Heilungsprozess unterstützen. Nur wer die Ängste oder die Lasten kennt, die unseren Rücken verspannen, kann die verkrampfenden Auswirkungen lindern. Die ständige Fehlhaltung am Computer oder Handy zum Beispiel lässt sich nicht wegoperieren, sie muss geändert werden. Dieser Ansatz würde uns manche Behandlung ersparen, den Ärzten wie den Patienten. Eine Vielzahl der Bandscheiben- und Versteifungsoperationen, die jährlich in Deutschland durchgeführt werden, wäre vermeidbar, wenn es uns endlich gelänge, eine ganzheitliche Behandlung zum Standard der Rückenmedizin zu machen. Davon aber sind wir weit entfernt. Immer noch wird eines der größten Volksleiden überwiegend somatisch, nicht auch psychosomatisch oder gar psychosozial betrachtet und behandelt. Viel zu sehr haben wir uns daran gewöhnt, den Körper mechanistisch zu verstehen, als ein handwerklich reparables Räderwerk.
Die Geschichte des Rückens aber ist eine andere. Die Haltung, die wir ihm körperlich wie emotional verdanken, bedarf psychischer und sozialer Stärkung. Wo diese Kraft fehlt, drohen wir in einer gleichsam umgekehrten Evolution zu degenerieren. Die Verkrampfung, das unverstandene Reagieren wird zum Normalfall, der aufrechte Gang vom Leben gebeugt.
Bis zu 53 Mrd. Euro jährlich kosten die Behandlungen, Tendenz steigend. Nicht zu reden von den 27 Milliarden, die durch rückenbedingte Arbeitsunfähigkeit anfallen.4 Auch von daher ist es höchste Zeit umzudenken, in der Medizin wie in der Gesundheitspolitik.
Wo und wann immer Rückenschmerzen auftreten, bedarf es einer ganzheitlichen Analyse und eines Behandlungskonzepts »von leicht nach schwer«. Gefordert ist dabei vor allem das solidarische und multidisziplinäre Zusammenwirken von Hausarzt, Facharzt, Krankengymnasten, Osteopathen, Manual- und Sporttherapeuten, Naturheilkundlern und Therapeuten psychischer Disziplinen. Es geht zunächst um Massagen, Akupunktur und Ähnliches, erst danach ist der invasive Ansatz zu wählen – seien es Injektionen, Mikrotherapie oder konventionelle chirurgische Operationen. Doch auch das wäre noch nicht genug. Hinzukommen müssen vorbeugende Maßnahmen, nationale Vorsorgeprogramme mit Fitnesskampagnen und einer Aufklärung, die schon bei den Kindern in den Schulen ansetzt. Über den Rücken und die große Bedeutung der äußeren Haltung zur Verhinderung von Schmerzen – wie beim Handy-Nacken, der weltweit dramatisch zunimmt – kann man selbst Kindern sehr gut die Wichtigkeit der inneren, der psychischen Haltung erklären. Begeisterung und positives Denken stärken die Seele, halten aufrecht und erzeugen ein Lächeln. Negativer Stress und Angst verändern die Haltung; man lässt die Schultern hängen, ebenso die Mundwinkel. Probieren Sie es mal. Sie werden staunen. Eine positive Haltung zum Leben – und das verstehen selbst Kinder sofort – stärkt unsere Persönlichkeit und unseren Körper.
Was also habe ich als Arzt von Patienten, Krankenschwestern, Pflegern und Therapeuten gelernt, und natürlich auch von meinem ersten Mentor, dem Landarzt?
1. Behandeln heißt: die Seele streicheln
2. Handeln statt labern
3. Individuelle Fürsorge schafft Vertrauen
4. Das Leben mit dem Tod versöhnen
5. Schmerzfrei behandeln
6. Selbstheilung ist möglich
Diese Lektionen haben mein medizinisches Handeln von Anfang an geprägt. Gepaart mit meiner Frustration darüber, dass Rückenpatienten kaum Möglichkeiten hatten, ihre Schmerzen ohne Operation loszuwerden, hat sich meine Form einer Medizin zwischen Hightech und Naturheilkunde, hat sich die Mikrotherapie entwickelt. »Von leicht nach schwer behandeln«, so lautet meine globale medizinische Devise – von Hausmitteln über Naturheilverfahren (wie Pflanzenheilkunde, Akupunktur und Massagen) über Physiotherapie und Osteopathie, über die Mikrotherapie mit hauchdünnen Sonden im Computertomografen (CT) und Magnetresonanztomografen (MRT) bis hin zur Endoskopie und zur großen Operation. Alles unter einem Dach. Diesen goldenen Mittelweg zwischen ambulanter und stationärer Medizin habe ich in Bochum 1997 etabliert. Das erste ambulante Kompetenzzentrum war geboren, erstmalig für Rückenbehandlungen und zudem als Präventionszentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Weniger ist mehr, micro is more
Bis heute fehlt im deutschen Gesundheitssystem die Brücke zwischen niedergelassener Praxis und Klinik – ein ungelöstes großes Problem. Mein Institut hat diese Aufgabe vom Start an gelöst: mit einem interdisziplinären Team aus Radiologen, Orthopäden, Neurochirurgen, Anästhesisten, Kardiologen, Allgemeinärzten, Neurologen und Naturheilkundlern, die mit Psychologen, Physiotherapeuten und Osteopathen unter einem Dach und einer Leitung zusammenarbeiten. Dafür gibt es einen modernen ambulanten Operationssaal mit integriertem CT-Gerät, Röntgen-Durchleuchtung, Ultraschall- und Endoskopiesystemen. Auch ein Sanitätshaus ist vorhanden. Alles, was normalerweise in einem Krankenhaus vorhanden ist, ist also hier in Miniatur für die ambulante Behandlung vorhanden und untereinander digital verbunden. Das gesamte Rücken-Kompetenzteam ist vernetzt mit den niedergelassenen Ärzten und Therapeuten, Universitätskliniken und Krankenhäusern der Region. Die Abrechnungsmodalitäten sind über Krankenkassen seit fast zwanzig Jahren gewährleistet und stabil. Die Patienten sind hochzufrieden, die Krankenkassen freuen sich über gute Resultate – und über die Einsparung von Kosten durch vermiedene Operationen und stationäre Aufenthalte. Das Institut ist als Kompetenzzentrum das bewährte Modell für die Zukunft der sektorübergreifenden Medizin (ambulant-stationär). Es war zwei Jahrzehnte lang auch die universitäre Ambulanz meines Lehrstuhls für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Witten/Herdecke, an der ich die bereits in den 80er Jahren in Kiel begonnene ganzheitliche, weltmedizinische Ärzte- und Krankenschwesternausbildung zwischen Hightech und Naturheilkunde weiterentwickelte. Mein Motto dazu: »Weniger ist mehr, micro is more.«
Meine wichtigsten Säulen der Medizin
• Medizin auf Augenhöhe, im fürsorglichen Dialog mit den Menschen
• Empathie und Zuhören schaffen Vertrauen
• Zeit nehmen für den Menschen, seinen Körper und die Seele
• Der Individualmedizin gehört die Zukunft
• Sterben gehört zum Leben dazu
• Von den Krankenschwestern lernen
• Den Kompetenz-Teams gehört die Zukunft
• Ob gesund oder krank, auf Haltung kommt es an
• Selbstheilen kann jeder
• Weniger ist mehr – micro is more
• Zuhören ist heilsam, vertrauensvoll sprechen auch
• Der Mensch ist ein wundervolles Lebewesen, keine Maschine
1. Kapitel
Wann ist der Mensch gesund?
Spätestens seit Anfang meines Medizinstudiums grüble ich darüber nach, ob Gesundheit überhaupt klar und eindeutig definierbar ist, ob der Begriff Gesundheit – oder Health, wie er sich neudeutsch aus dem englischen Wortschatz eingebürgert hat – überhaupt stimmig ist. Was meint die Medizin, was die Politik, was die Öffentlichkeit, was meinen die Menschen, wenn sie über »die« Gesundheit sprechen? »Gesundheit ist das höchste Gut.« Wirklich?
Mein Vater war bis zu seinem 86. Lebensjahr körperlich und mental altersgemäß topfit – bis die Demenz sozusagen wie ein Blitz einschlug. Ein großer Schock. Ich werde diese dramatische Situation zu Weihnachten, in der sich die rasant fortschreitende Demenz zum ersten Mal zeigte, nie wieder vergessen. Ein Jahr später verstarb mein Vater, ohne dass wir uns noch bewusst von ihm verabschieden konnten. Was für ein Leid für unsere ganze Familie, besonders für meine Mutter, die ihn in dieser Zeit aufopfernd mit Unterstützung von uns und liebevollen Pflegerinnen zu Hause gepflegt hatte! Dass sie seine geliebte Frau war, selbst das hatte mein Vater an seinem Lebensende vergessen. Meine Mutter ertrug das stoisch, aber mit großer Traurigkeit. Bis zu seinem Tod nahm mein Vater keine Medikamente ein, war weder an Diabetes, Bluthochdruck oder noch sonst wie erkrankt. Als Arzt hatte ich eine solche Dramatik vorher nie erlebt. Er starb friedlich in meinen Armen.
Mein Vater war eindeutig nur mental erkrankt. Sein Körper und dessen Funktionen waren bis zu den letzten Monaten seines Lebens ohne Gebrechen intakt. Nur am Ende wurde er zunehmend hinfällig – wie jeder Mensch, der sich langsam von dieser Welt verabschiedet. Weder das Alter noch die damit verbundenen Einschränkungen sind eine Krankheit. Auch Vergesslichkeit erst einmal nicht. Aber wie lange ist Vergesslichkeit gesund? Wann ist man krank? Die Schwierigkeit der Begriffsdefinition hat mich schon immer beschäftigt und irritiert. Besonders in Anbetracht von fröhlich fitten Menschen, die ich zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, nach einer Herztransplantation oder mit einem geistigen oder körperlichen Handicap erlebt oder behandelt habe. Ist ein Mensch mit erhöhtem Blutdruck, mit Schilddrüsenunter- oder -überfunktion oder mit einer Hüftgelenksarthrose krank? Wirklich?
Eine schwierige Frage. Meine einfache Antwort: Entscheidend ist das Wohlbefinden. Und dazu hat jeder Mensch seine ganz eigene Vorstellung. Die Gefühle von Lebensqualität, Gesundheit und Krankheit sind in ihrer Ausprägung zutiefst individuelle Zustände und keineswegs nach einer DIN-Norm zu bestimmen. Die Behauptung, der sogenannte gesunde Zustand sei der normale, war in dieser Form noch niemals stimmig, und in unserer modernen Welt mit ihren immer neuen, unnatürlichen Bedrohungen stimmt sie gleich gar nicht mehr. Man denke nur an die psychischen Belastungen der vielfach vernetzten Arbeitswelt, an das plötzliche Auftauchen bisher unbekannter Epidemien (wie Corona) oder an die bedrohliche Zunahme von Allergien. Immer weiter dehnt sich das Feld. Wie ist es überhaupt abzustecken? Ist jemand, der eine Kniegelenksarthrose hat und deshalb hinkt, krank oder nur körperlich »angeschlagen«?
Während wir ziemlich genau sagen können, worin diese oder jene Krankheit besteht, verfügen wir über keine für alle Menschen gleichermaßen verbindliche Bestimmung des »Gesunden«. Dafür sind wir Menschen ganz einfach zu verschieden. Ob und wie weit sich jemand gesund fühlt, ist immer auch eine Frage seines Selbstverständnisses. Natürlich gibt es Krankheiten, leichte und schwere, unter denen jeder leiden kann – mehr oder weniger. Deshalb muss er sich aber noch nicht aus der Gemeinschaft der Gesunden ausgeschlossen fühlen. Dazu geben ihm oft erst die anderen Anlass, indem sie ihn als Kranken oder »Behinderten« behandeln. Das geschieht meist aus Befangenheit gegenüber einem Menschen, der einfach nur anders ist als man selbst. Und das Mitleid, das wir uns dann gern zugutehalten, kränkt oft mehr, als es guttut. Denn Gesundheit resultiert eben nicht allein aus der Unversehrtheit des Körpers.
Bei meinem medizinischen Handeln gehe ich immer eine persönliche Beziehung ein. Schon bei meinem ersten Patienten war das so, und es ist aus meiner Sicht das, was der Medizin heute mehr und mehr fehlt. Der Patient ist für mich immer »jemand« und nicht »etwas«! So muss es sein! Jeder Patient ist eine Person, ein Ich. Er oder sie ist nicht ein krankes Organ, nicht der Rücken, das Herz von Zimmer 33 oder der Krebs, die Hüfte. Ein Kind, das sein Ich erst im Verlauf seiner Entwicklung entdeckt, ist nicht erst von dem Moment an eine Person, in dem es wirklich »ich« sagen kann. Leider reden wir in der Medizin häufig über nur über einen Befund, eine Sache und berauben damit, ohne es zu wollen, den Menschen seiner Seele, seines denkenden und fühlenden Geistes. Wir sprechen von »Heilung«, wenn eine Bandscheibe operiert oder ein Hüftgelenk eingebaut wurde. Es hat sich damit jedoch eine falsche Definition, eine dem Menschen gegenüber falsche Haltung etabliert. Denn ich, Dietrich Grönemeyer, trage erst dann zu einem Heilungsprozess bei, wenn ich die Patienten auf einer persönlichen, emotionalen und beziehungsreichen Ebene begleite. Vom Beginn meines Berufslebens an stehe ich Patienten als individuellen Menschen mit Empathie zur Seite. Konsequent beziehungsvoll und nah bei der Integration ihrer Empfindungen, ihres Ich-Seins – bei ihrem Schmerz genauso wie bei ihren Gebrechen und ihren körperlichen und mentalen Unzulänglichkeiten. Ein Mensch, der dement ist, besitzt genauso Menschenwürde wie ein Mensch mit nur einem Bein, wie du und ich. Ein Mensch, der seine Sinne verliert oder dessen Sinne sich nicht entwickeln konnten, oder ein Mensch, der im Koma liegt, besitzt Menschenwürde bis zuletzt. Selbst Tiere verfügen über eine Würde, die nicht selten eher geachtet wird als die des Menschen.
Gesund sein – auch eine Frage des individuellen Empfindens
Die Begriffe Gesundheit und Krankheit sind aus meiner Sicht Endpunkte einer Skala. Sie werden aus unterschiedlichen Perspektiven und in verschiedenen Medizinschulen unterschiedlich definiert. Grundsätzlich befindet sich jeder Mensch ständig irgendwo dazwischen. »Gesundheit«, sagt die Weltgesundheitsorganisation, sei »der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.« Anders gesagt, wenn es um die Gesundheit geht, ist nicht alles mit gleichem Maß zu messen. Das Wort ist kein normativer Begriff. Was den einen krank macht, mit dem kann ein anderer ganz gut leben. »Völlig gesund« gibt es nicht! Auf die individuelle Einstellung kommt es an, nicht darauf, worunter der Patient nach Meinung des Arztes leidet und wovon er oder sie befreit werden muss.
Wenn wir erkranken, wenn nichts mehr funktioniert, wie es soll, dann wünschen wir uns alle den besten Arzt, die fürsorglichste Krankenschwester, die liebevollste Behandlung und die effektivste Medizin. Doch dafür gibt es weder Universalrezepte noch Superhelden! Der Mensch ist keine Maschine, denn er fühlt und denkt. Heilen ist etwas anderes als Reparieren. Jedem steht seine eigene Gesundheit zu. Das müssen wir Ärzte, aber auch die Politik, die Krankenkassen und das System einschließlich der Medien respektieren. Gesundheit ist eine Sache persönlicher Haltung und des individuellen Empfindens. Auch wer in seiner körperlichen oder geistigen Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, kann sich durchaus den anderen gegenüber als ebenbürtig und gesund empfinden – eine Tatsache, die wir uns viel zu selten bewusst machen, wenn wir von »den Behinderten« sprechen. Im Grunde ist das eine begriffliche Stigmatisierung, die der Ausgrenzung Vorschub leistet. Um zu erkennen, wie diese Wortwahl an der Realität vorbeigeht, muss man nur an die großartigen Leistungen der Athletinnen und Athleten bei den Paralympics denken. Oder an den Sportjournalisten Marcel Bergmann, der im Rollstuhl China durchquerte, bis hinauf auf die Große Mauer.
Überall stieß er zunächst auf Skepsis, die jedoch beim Erleben seiner Person und seiner Leistung in Begeisterung umschlug. Deshalb wurde er von hilfsbereiten Chinesen auf die Große Mauer getragen. Wer einmal selbst auf diesem über tausend Kilometer langen und sehr hohen, atemberaubenden »Weltwunder« gestanden hat wie ich, einem Bauwerk, das selbst vom Mond aus zu sehen ist, der wird verstehen, was das für Marcel und die Chinesen für eine Anstrengung gewesen sein muss. Für Marcel war es ein bedeutsamer, beglückender Moment. Und für die Welt ein wichtiges Symbol zur Entstigmatisierung von gehandicapten Menschen.
Ich habe ihn damals persönlich kennengelernt. Was für ein beeindruckender, hochsympathischer und bescheidener Mensch. Ich habe mich gefragt, wie er es mental überhaupt schaffte, eine so gigantische Herausforderung anzugehen und sich ein solches an Wahnsinn grenzendes Abenteuer zuzumuten. Würde ich so etwas auch wagen, wenn ich an seiner Stelle wäre? Ohne Beinkraft und mit reduziertem Stoffwechsel des Unterleibs, gepaart mit der Angst, zu versagen oder sich noch weiter schwer zu verletzen? War ich doch selbst einmal zehn Meter in den Bergen abgestürzt. Das hätte anstatt zweier angebrochener Wirbel und eines ausgekugelten Hüftgelenks auch den Tod oder eine Querschnittslähmung bedeuten können. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich sehr, ohne große Malaisen noch leben zu dürfen. Ein großes Geschenk, für das ich unendlich dankbar bin. Im Rollstuhl das ganze Leben zu verbringen, immer von oben herab behandelt zu werden, sich kleingemacht zu fühlen – im wahrsten Sinne des Wortes … ich bin mir da nicht so sicher, ob und wie ich das ertragen hätte. Marcel indes hat mich, aber auch andere Gelähmte, besonders auch die Kinder, die damals von meiner Stiftung betreut wurden und die ihn kennenlernten, sehr motiviert, das Leben, so schwer es auch sein mochte, anzunehmen und jede Niederlage als Chance zu begreifen. Marcel konnte das, weil er sich nicht behindert, sondern gesund fühlte, trotz seines »Handicaps«, wie die Engländer sagen. Ein Begriff, der mir sehr viel angemessener erscheint, da er nicht gleich die ganze Persönlichkeit infrage stellt.
Es gibt in der Medizin keinen Status quo, auf dem wir fortdauernd verharren könnten. Generelle Denkverbote, religiös oder sonst irgendwie begründet, sind mit dem hippokratischen Eid ebenso unvereinbar wie ein Ehrgeiz, der den Menschen zum Objekt wissenschaftlicher Experimente degradiert. Das ist meine klare persönliche Haltung. Auch befürworte ich Impfungen, denn aus meiner Sicht ist das Impfen eine der besten Schutzmöglichkeiten, um Krankheiten zu verhindern. Impfen hat der Menschheit geholfen, Pocken auszurotten, Kinderlähmung zu reduzieren und Grippe oder Hepatitis vorsorgend begegnen zu können. Impfen ist meist einfacher, weniger aufwendig und billiger als Heilen. Aber jeder hat das Recht, sich selbst für oder gegen eine Impfung zu entscheiden. Um diese Entscheidung klug zu treffen, sind allerdings gutes Wissen und umfassende Aufklärung nötig. Die ist jedoch bis heute zu Covid-19 in der Corona-Pandemie-Periode ebenso ausgeblieben wie früher schon bei Grippeepidemien oder zu multiresistenten Krankenhauskeimen und den großen Volkskrankheiten.
Um Wohlbefinden sollte es gehen – auch in der Medizin
Ich bin Arzt geworden, um mitzuhelfen, dass Medizin vorsichtiger und umsichtiger wird, dass sie sich vorsorgend und therapierend um das Wohlbefinden jedes einzelnen Menschen kümmert – egal mit welchen Behandlungsmethoden zwischen Hightech und Naturheilkunde und Psychosomatik. Wer heilt, hat recht. Das habe ich schon als Kind gelernt. Es gilt für Therapeuten und Therapeutinnen genauso wie für jeden Menschen selbst. »Ärzte sind nur deine Gehilfen, der wahre Arzt bist du selbst«, formulierte schon Paracelsus, der berühmte Schweizer Arzt aus dem 16. Jahrhundert. Davon abgeleitet sage ich: Jeder Mensch ist ein Kleiner Medicus oder eine Kleine Medica, die meist viel mehr über sich selbst wissen als wir Ärzte. Wir müssten nur einmal genauer hinhören. Voraussetzung dafür ist nicht zuletzt die Abkehr von jeglichem Dogmatismus.