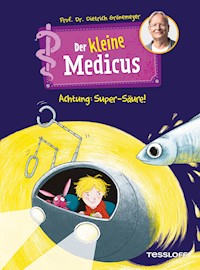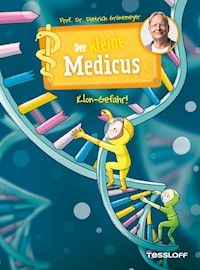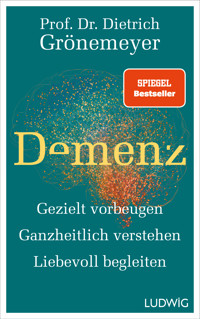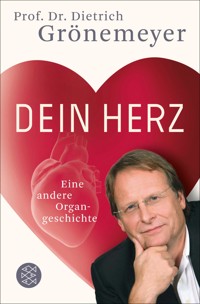9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Weltmedizin – das ist das Lebensprojekt von Bestsellerautor und Arzt Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer! Seit Jahrzehnten widmet sich Dietrich Grönemeyer leidenschaftlich der Frage, wie alternative Heilmethoden unsere Schulmedizin bereichern können. Dafür ist Deutschlands bekanntester Arzt um die ganze Welt gereist und hat Heiler und Schamanen gebeten, ihr jahrtausendealtes Wissen mit ihm zu teilen: Von Kräutermedizin, über Meditation, bis hin zur Traditionellen Chinesischen Heilkunst. Er machte sich dafür auf nach Afrika, Tibet, Brasilien, Australien, Korea und viele weitere Länder. Sein Wissen nutzt Grönemeyer jetzt, um wesentliche Fragen zu beantworten: Wie kann Meditation den Herzrhythmus regulieren? Werden Menschen durch Handauflegen gesund? Warum funktionieren Akupunktur und Ayurveda? So zeigt uns Grönemeyer, was wirklich heilt. Es geht unter anderem um: Tibetische Medizin, Schamanismus, Kräuterkunde der Aboriginies, Yoga, Hamam Meditation, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Akupunktur, Schröpfen, Ayurveda, Phytomedizin, Naturmedizin/Bhutan, Tai Chi, Tuina/Shiatzu, Kampfkünste, Arabisch-Persische Medizin, Reflexzonentherapie, Massagen, Qi Gong, Traditionelle Afrikanische Medizin (TAM), Trance und La'au Lapa'au Pflanzenmedizin/Hawaii.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer
Weltmedizin
Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst
Über dieses Buch
- Das medizinische Wissen der Weltkulturen spannend zusammengefasst vom angesehenen Arzt Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer
- Faszinierende Reisen nach China, Indien, Bhutan, Afrika, Mexico, Brasilien, USA, Australien und in viele Länder Europas
- Wie jahrtausendealtes Wissen die Schulmedizin bereichert
Aus dem Inhalt:
Akupuntur
Ayurveda
arabisch-persische und indianische Medizin
Heilkräuter
Heilzauber
Hightech-Medizin
Klostermedizin
Massagen
Medizin der Mayas
Naturheilkunde
Qi Gong
Reflexzonentherapie
Schamanismus
Schulmedizin
Tai Chi
Traditionelle Chinesische Medizin
Traditionelle Tibetische Medizin
Trance
Tuina/Shiatsu
Yoga
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Lektorat: Rüdiger Dammann, Berlin; Thomas Welt, Bochum
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Gaby Gerster
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490892-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Auf der Suche nach den Geheimnissen der Weltmedizin
Die Kunst des Heilens
Jede Medizinschule hat ihre Berechtigung
Arzt in sechster Generation
Lernen von Chinesen und Asiatinnen
Wider den Untergang des Humanismus in der Medizin
Wie heilt man ohne Labor, EKG und Bildgebung?
Individualisierte Medizin
Der aus dem Schlamm kam, Carl Abraham von Hunnius
Heilpflanzen und Medikamente zwischen Wohl und Wehe
Das Alte mit dem Neuen verbinden
Alles fließt: Die Anfänge der Heilkunst
Geistheilung
Innere und äußere Harmonie
Himmel und Erde, Feuer und Wasser
Unani-Medizin
Wo das »Qi« strömt: Mein Aufbruch ins Reich der Mitte
Das Wunder der chinesischen Heilkunst
Weiterbildung in Sri Lanka
Von der Akupunktur zur Mikrotherapie
Mit den Fingern sehen
Blockadebrecher
Körper und Geist sind untrennbar
Indische Lebensweisheiten: Wann ist der Mensch »bei sich«?
Alles ist Teil der Ganzheit
In sich sein
Nicht Krankheiten behandeln, sondern Gesundheit erhalten
Yoga und Ayurveda: Zwei Seiten einer Medaille
Erste Begegnungen mit Yoga in Sri Lanka
Die Panchakarma-»Verjüngungskur«
Ernährung ist Medizin
Wer hat von wem gelernt?
Der achtsame achtfache Pfad: Wie ich lernte, den tibetanischen Ärzten zu vertrauen
Meine Begegnung mit dem Dalai Lama
Heilsames Bhutan
Glauben und Wissen
In ihren Wurzeln liegt die Kraft der Medizin
Der Körper ist der Tempel der Seele
Die Reise ins Ich als Weg in die Welt
Unter Schamanen und Medizinmännern: Alles Magie?
Ver-rückte Welten
Wissensverlust durch religiösen Wahn
Unerklärbare geistige Heilkräfte in Hawaii
Lass los und lebe!
Beobachten und Empirie statt Kernspin und Labor
Nicht jede Tasse passt in jeden Schrank
Heilen durch Wärme und natürliche Antibiotika
Die Kraft der Suggestion
Die Kraft der Natur
Tanzen als Therapie
Das verlorene Wissen der Azteken, Inkas und Mayas
»Heidnischer« Weihrauch
Gute Nonnen, böse Hexen: Eine Zeitreise durch die Kräutergärten der Weltmedizin
Antikes Aspirin, natürliche Arzneien
Die Systematisierung der Heilkunst: Galen und die Klostermedizin
Die Mutter der europäischen Naturheilkunde: Hildegard von Bingen
Teufelswerk oder göttlicher Segen: Die Tyrannei der Rechthaber
Die fortlaufende Erweiterung der Pflanzenapotheke
Irrtümer, Mystik und Verzückung
Die wissenschaftliche Pflanzenheilkunde: Phytopharmakologie
Der Aufstieg der Pharmazie aus der Naturheilkunde
Von Ärzten, Forschern und Maschinen: Wege und Irrwege der Schulmedizin
Wie die Anatomie der Schulmedizin den Weg ebnete
Die Pathologie als Mutter der naturwissenschaftlichen Medizin, Virchow als ihr Vater
»Halbgötter in Weiß«: Der Siegeszug der Chirurgie
Das radiologische Körperkino
Immunologie: Der Kampf gegen die Menschheitsgeißeln
Zucker ist nicht nur süß: Volksseuche Diabetes
Das Herz: Unser geliebter und gefährdeter Mittelpunkt
Das Gehirn als letzte Bastion: »Menschendesign« durch Transplantation?
Entmündigung durch Technik?
Am Scheideweg der Medizingeschichte
Hippokratischer Eid
Vom Alpha bis zum Omega der Medizin: Ein kleiner Wegweiser
Medizinischer Pfadfinder 1 Von A bis Z: Traditionelle und alternative Heilweisen der Welt
Aderlass
Akupunktur
Aku-Taping
Amulett
Anthroposophische Medizin
Aroma-Therapie
Atemtechniken
Ayurveda
Beten
Bindegewebsmassage
Blutegeltherapie
Chakren
Curry als vorbeugende Heilnahrung
Eiskammer
Fango
FX Mayr
Geistheilung
Hamam
Hawaiianische Medizin
Heilerde
Heiße Bäder
Hildegard-Medizin
Homöopathie
Hot Stone-Massage
Hypnose
Indianische Medizin
Jin Shin Jyutsu
Kampfsport
Kampo-Medizin
Klimatherapie
Kneippgüsse
Lomi-Lomi-Massage
Lymphmassage
Makrobiotik
Meditation
Mineralien/Kristalle
Moorbäder
Musiktherapie
Muskelentspannung nach Jacobson
Neuraltherapie
Ohrakupunktur
Osteopathie
Psychosomatik
Pulsdiagnose
Reflexzonenmassage
Sauna
Schamanismus
Schlaftherapie/Powernap
Schröpfen
Schwedische Massage
Schwitzhütte
Shiatsu
Stangerbad
Tai Chi und Qi Gong
Tanztherapie
Tapen
Tee
Thai-Massage
Thalasso-Therapie
Tollkirsche
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
Traditionelle Tibetische Medizin (TTM)
Trance
Trinkkuren
Tuina
Unani-Medizin
Vegane Ernährung
Vegetarische Ernährung
Wickel
Yoga
Medizinischer Pfadfinder 2 Von A bis Z: Schulmedizin
Antibiotika
Augenhintergrund
Biopsie
Blutdruck
Chemotherapie
Computertomographie (CT)
EKG
EMG
Endoskopie
ENG
Histologie
Immuntherapeutika
Injektion und Infusion
Interventionelle Radiologie/Kardiologie
Körperhaltung
Körperliche Untersuchung
Kortison
Labor: Blut, Liquor und Urin
Laser
Laser in der Augenheilkunde
Magnetresonanztomographie (MRT) oder Kernspintomographie
Medikamentenpumpen
Mikrotherapie
Minimalinvasive Therapie
Neurologische Untersuchung
Nuklearmedizin
Operation
Pathologie
Pulsmessung
Robotik & Navigation
Röntgen
Sozialmedizin
Spiroergometrie
Staroperation und Linsenimplantat
Telemedizin
Thermoablation
Transplantation
Ultraschall
Urin-Diagnose
Vitaldatenerfassung
Zahnmedizin
Zungendiagnose
Anhang
Literatur
Personenregister
Haftungsausschluss
Jeder ist einzigartig. Es gibt niemanden, der genauso ist wie der andere. Mein Körper, meine Gedanken, meine Freude, meine Ängste, meine Enttäuschungen, meine Verrücktheiten, meine Liebe, meine Inspiration und meine Ideen: Alles ist einmalig, so einmalig wie bei jedem anderen. Allein diese Unterschiedlichkeit haben wir gemeinsam. Und nur, indem wir sie respektieren, können wir über Grenzen und Epochen hinweg zusammenfinden.
Dietrich Grönemeyer
Auf der Suche nach den Geheimnissen der Weltmedizin
Ärzte sind keine Halbgötter in Weiß, Schamanen keine Zauberer, auch wenn Vertreter beider Gruppen bisweilen so tun. Wunderheiler verdanken ihre Existenz dem Mythos, religiösem Denken oder schlichtweg den Wunschträumen vieler Menschen, der Kranken in höchster Not. Von Angesicht zu Angesicht bin ich auf all meinen Reisen noch keinem begegnet. Gleichwohl gibt es ungelöste Rätsel wundersam anmutender Heilung. Selbst die Schulmedizin bediente sich immer wieder zufällig entdeckter Behandlungsmethoden, deren erfolgreiche Wirkungsweise sie sich lange nicht erklären konnte. Nach wie vor werden, etwa bei Rückenleiden, Heilmethoden oder Medikamente verordnet, die von quälenden Schmerzen erlösen, ohne dass wir sagen könnten, worauf die Wirkung beruht. Allein die Erfahrung verbürgt den therapeutischen Erfolg.
Nicht alles, was den Naturheilkundigen, etwa den Buschmännern im südlichen Afrika, gelingt, kann ich mir wissenschaftlich erklären. Diese Ratlosigkeit lässt den Schulmediziner, der ich nun einmal bin, nicht selten zweifeln. Geht das alles mit rechten Dingen zu? Oder sitzen wir da einem Schwindel auf, womöglich einer Inszenierung, mit der sich die wundersam Heilenden selbst etwas vormachen, um die Kranken mental über ihre Beschwerden hinwegzutäuschen, wenigstens vorübergehend? Ganz auszuschließen ist das nicht immer, zumal die Medizinmänner und die furchtsam bewunderten Kräuterfrauen, die »Hexen« früherer Jahrhunderte, auch selbst fast nie erklären konnten oder können, wie es ihnen beispielsweise gelingt, nur mit Blicken oder durch das bloße Fühlen des Pulses zu erkennen, welche inneren Organe ihren Dienst versagen, welche Erkrankung vorliegt. Dennoch stelle ich immer wieder staunend fest, dass die erfühlten Diagnosen dem entsprechen, was wir als akademisch geschulte Ärzte mit Hilfe von Laboruntersuchungen oder bildgebenden Verfahren ermitteln.
Die Kunst des Heilens
Goethes Empfehlung, die Geschehnisse der Natur »sinnenmäßig« zu erfassen, verstand sich für Heilende seit jeher. Lebenserfahrene Ärzte tun das bis heute. Wenigstens teilweise praktizieren sie durchaus sinnlich, aus dem Bauch heraus, würde der Volksmund sagen. Sie nehmen Gesundheit und Krankheit, Entstehen und Vergehen des Lebens dank ihrer Sinneserfahrung wahr. Der Erfolg jedes Therapeuten hängt von seiner sinnlichen Sensibilität sowie von seinem Wissen und seiner medizinisch-praktischen Fähigkeit ab. Denkendes Beobachten und beobachtendes Denken, beides zusammen macht die ärztliche Begabung aus, das Talent, in selteneren Fällen das Genie.
Fraglos gibt es eine gleichsam intuitiv agierende, über Jahrtausende tradierte »Heilkunst« im wahrsten Sinne des Wortes, etwas das sich nur bedingt erlernen lässt, wenn es einem nicht gegeben ist. So hat sich im Laufe der Geschichte ein ärztlicher Erfahrungsschatz angehäuft, von dem ich meine, dass wir ihn viel zu wenig nützen, und zwar um so weniger, je weiter die medizinische Forschung voranschreitet. Stattdessen neigen wir in der modernen Hightech-Gesellschaft dazu, alles Überkommene wissenschaftlich gering zu schätzen, wenn wir es nicht gleich über Bord werfen. Wie viel Wissen ist dadurch bereits verloren gegangen? Was alles übersteigt inzwischen unser technisch orientiertes Vorstellungsvermögen? Wie ist es möglich, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Arzt die Hand auflegt? Wie gelingt es magisch geschminkten »Zauberern«, Knochenbrüche ohne Schiene oder Gips zu heilen? Wie bringen sie es zuwege, operative Eingriffe ohne die uns bekannten Methoden der Anästhesie schmerzfrei auszuführen?
Jede Medizinschule hat ihre Berechtigung
Alles Lug und Trug? Ganz gewiss nicht! Die Phänomene als »unwissenschaftlich« abzutun, ist allzu voreilig. Stattdessen sollten wir uns gerade im Zuge der Globalisierung bemühen, das oftmals Phänomenale aus der Geschichte, dem Glauben, den Sitten und Gebräuchen jener Gesellschaften herzuleiten, in denen es heilende Bedeutung erlangt. Denn nur wenn man sich forschend in sie versenkt, besteht die Chance, fremde Kulturen zu verstehen, ihnen womöglich etwas für das eigene Leben abzugewinnen. Das gilt insbesondere für die Heilkunst, da sie zusammen mit dem Essen zu den ältesten Kulturgütern der Menschheit zählt.
Am Anfang der Medizingeschichte stehen religiöse Rituale. Damit eine Behandlung anschlagen konnte, bedurfte es des Segens höherer Wesen. Solche Verbindungen des Mythos mit der ärztlichen Praxis haben sich bis heute in der Heilkunde der letzten Naturvölker dieser Erde erhalten, beispielsweise in den Urwäldern Brasiliens.
Jede Schule hat ihre Berechtigung, sofern ihre Methoden heilsam sind. Nur verbohrte Dogmatiker – von denen es freilich stets mehr als genug gab und gibt – können auf die absurde Idee verfallen, die Lehren gegeneinander in Stellung zu bringen. Richtiger wäre es, die unvorstellbare Vielfalt der Heilsysteme auch als eine gewisse Einheit zu begreifen, zumindest medizinhistorisch als das Ursprungsbecken, aus dem sich der heutige Stand der Medizin entwickelt hat und sich weiter entwickeln wird. Weil mir das im Laufe meines Lebens als praktizierender Arzt immer klarer geworden ist, habe ich den Begriff der »Weltmedizin« geprägt: ein integrativer Ansatz zur Weiterentwicklung der Schulmedizin. Mit einer kleinen Stiftung versuche ich, die Aufmerksamkeit der Mediziner und ihrer Patienten, der Politiker und der Forscher auf dieses entwicklungsgeschichtliche Kontinuum zu lenken. Zumal es bis heute, von wenigen Ethnologen abgesehen, kaum Wissenschaftler gibt, die hier vergleichende Forschungen betreiben.
Dabei wissen wir doch alle, wie notwendig es ist, voneinander zu lernen, und zwar auf allen Gebieten, in sämtlichen Bereichen des Lebens. Höchste Zeit also, dass wir im Gesundheitswesen über kulturelle und sonstige Grenzen hinweg näher zusammenrücken und uns fragen: Welchen Wert hat die Erfahrungsheilkunde früher Epochen für die Medizin von morgen? Wovon könnten wir profitieren? Was lässt sich als wirkungsvoll nachweisen? Und auch wenn solcher Nachweis noch aussteht: Muss das Unerklärliche deshalb sofort und für immer im Orkus der Medizingeschichte versinken? »Es gibt zwei Arten zu leben«, hat Albert Einstein gesagt, »entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins.« So denke auch ich. Ich glaube, dass man eine wissenschaftlich orientierte Medizin betreiben kann, ohne die traditionelle Heilkunst gering zu schätzen. Jedenfalls war sich die Schulmedizin bei allem Bemühen um weltanschauliche Abgrenzung nie zu schade, Erfolge durch die stillschweigende Integration naturkundlichen Wissens zu erzielen, zum Beispiel mit der chemischen Synthese des Aspirins, dessen Wirkstoff ursprünglich aus der Weidenrinde gewonnen wurde. Manches müssen wir uns nur wieder bewusst machen, wie beispielsweise die großartigen Leistungen auf dem Gebiet der Augenheilkunde, eine der ältesten medizinischen Disziplinen. Bei den Ägyptern gab es bereits den königlichen Augenarzt, die hohe Fachkenntnis der dortigen Ophtalmologen erkannte schon Homer. Kleine Operationen im Auge und am Lid gegen Gerstenkörner zum Beispiel waren genauso bekannt wie die Anwendung von Arzneipflanzen, etwa der Tollkirsche, dem Belladonna und heutigen Atropin, zur Erweiterung der Pupille. Der sogenannte »Starstich« zur Behandlung des Grauen Stars, einer meist altersbedingten Linsentrübung, gehörte zur medizinischen Routine. Überliefert ist der Ursprung dieser Methode von den Babyloniern, also aus einer Zeit, die bald 4000 Jahre zurückliegt. Bei Nichterfolg des Eingriffs sollten dem Augenoperateur die Hände abgehackt werden, so stand es auf später übersetzten Gesetzestafeln. Bei Erfolg indes soll er bezahlt worden sein. Später, sehr viel später wurde 1747 die erste Linsenentfernung vom französischen Arzt Jacques Daviel realisiert. Auch dies nicht von ungefähr, denn schon die Gallier zeichneten sich vor einigen tausend Jahren nicht nur durch die Kunst der Käseherstellung, sondern auch durch eine fortschrittliche Augenheilkunde aus.
Aspirin Schon Hippokrates sah die Weidenrinde als Arznei an, sie wurde gegen Fieber und Schmerzen aller Art eingesetzt. Der darin enthaltene Wirkstoff wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Mitarbeitern der Firma »Bayer« als »Acetylsalicylsäure« synthetisiert und unter dem Markennamen »Aspirin« patentiert. Das Mittel fand schnell weltweite Verbreitung. Inzwischen ist die Acetylsalicylsäure Bestandteil von mehreren Hundert Präparaten und wird von der Weltgesundheitsorganisation auf der Liste der »unentbehrlichen Arzneimittel« geführt.
Starstich Bei dieser durchaus rabiat anmutenden Methode wird mit einem spitzen Gegenstand (»Starstichnadel«) ins Auge gestochen und die getrübte Augenlinse nach unten gedrückt, damit wieder Licht auf die Netzhaut fallen kann. Im günstigsten Fall verhalf der Eingriff den Patienten zu neuer Sehkraft, allerdings kam es häufig zu Komplikationen, vor allem zu Entzündungen, die nicht selten tödlich endeten. So soll auch Johann Sebastian Bach an den Folgen zweier Augenoperationen gestorben sein.
Zwar haben wir nach der naturwissenschaftlichen Revolution am Ende des 19. Jahrhunderts unendlich vieles neu erfunden, aber eben nicht alles. Darauf einen Anspruch zu erheben, sich gar im Gefühl einer Überlegenheit der westlichen Kultur zu wiegen, wäre vermessen.
Es gibt sie ganz einfach nicht, die eine, allein seligmachende Heilkunst. Weder die Schulmediziner noch die Akupunkteure oder Alternativ-Mediziner verfügen darüber. Das gilt für die eingeschworenen Traditionalisten, die glauben, sie könnten uns mit Globuli und Kräutertee von jeglichem Leiden erlösen, ebenso wie für die Operateure, die lieber zum Skalpell greifen, als sich auf ein Gespräch mit den Patienten einzulassen oder bei Rückenschmerzen eine Massage oder Osteopathie zur Muskel- und Faszienentspannung anzubieten. Nicht zu reden von den Gesundbetern und deren genereller Verdammung schulmedizinischer Behandlung, wenn es sein muss bis zum Tode hin. Jegliche Heilkunst, die traditionelle wie die vorausschauend moderne, hat viele unterschiedliche Stärken. Nur will das einer dem anderen ungern zugestehen. Statt zusammenzuwirken üben sich die Überzeugten in eifersüchtiger Abgrenzung, noch immer.
Mir wollte das nie einleuchten. Obwohl selbst Schulmediziner, als Radiologe und Mikrotherapeut der Gerätemedizin sogar professionell verpflichtet, habe ich der fachwissenschaftlichen Hybris seit jeher misstraut. Das kann, dachte ich bereits als Student, doch nicht alles sein. Und auf der Suche danach, was es außerdem noch geben musste, bin ich wieder und wieder in ferne Länder und auf fremde Kontinente gereist, nach Indien, auf die Höhen des Himalaja und in das farbenprächtige Bhutan, nach Australien zu den Aborigines, nach Japan, nach China und Brasilien oder kreuz und quer durch Europa. Um hinter die »Geheimnisse« der Weltmedizin zu kommen, habe ich mit Ärzten und Medizinern, mit Priestern und Schamanen gesprochen und lange mit dem Dalai Lama zusammengesessen. Und irgendwann führte mich die Recherche dann auch zurück in die eigene Familiengeschichte. War doch einer meiner Vorfahren, Carl Abraham von Hunnius, der Ur-Ur-Ur Großvater meiner Mutter, einer der ersten gewesen, die im 18. Jahrhundert Naturheilverfahren in die klassische Medizin einführten.
Arzt in sechster Generation
Dass ich selbst Arzt in sechster Generation bin, ist mir allerdings erst spät aufgegangen. Zunächst ergab sich meine Entscheidung für die Medizin aus anderen, schmerzhafteren Erfahrungen. Dass mir ein besonderes Interesse sozusagen angeboren gewesen wäre, wäre mir nicht im Traum eingefallen und war auch ansonsten nicht erkennbar. Ich tat, was die meisten Jungen um mich herum taten, begeisterte mich für Technik, Sport und Musik, bolzte auf dem Fußballplatz, bastelte gern und lernte schon früh Gitarre spielen. Außerdem haftete mir der Ruf an, eine Leseratte zu sein. Wie nebenher, ohne dass ich dazu von den Lehrern oder den Eltern angehalten worden wäre, stellte sich ein besonderes Interesse an Philosophie und Religion ein. Bis heute zehre ich von vielen dieser ersten, noch naiv gesammelten Eindrücke. Wann immer ich Paul Gerhardts Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« höre, fühle ich mich für Momente zurückversetzt in die ebenso besinnliche wie heitere Atmosphäre der sonntäglichen Gottesdienste meiner Kindheit. Das Mitte des 17. Jahrhunderts gedichtete und komponierte Kirchenlied ergriff mich seinerzeit derart, dass ich lange überlegte, selbst Pastor zu werden. Das, was damals nahelag, sich beinahe von selbst verstand, wenn man in einer Bergbauregion, im »Revier«, aufwuchs, kam für mich nie in Frage. In die Fußstapfen meines Vaters, der sich als Bergbau-Ingenieur seiner Arbeit und dem Milieu stark verbunden fühlte, wollte ich nicht treten. Obwohl es auf diesem Gebiet durchaus viel Faszinierendes für mich gab, wie den Tunnelbau der Stollen unter Tage. Bis heute habe ich nicht verstanden, warum unsere Urväter diese Technik nicht einsetzten, um den Automobil- und Bahnverkehr unter das Ruhrgebiet, in dem ich lebe, zu verbannen. Selbst eine U-Bahn, die alle Städte verbindet, gibt es nicht.
Als Jugendlicher zog es mich erst einmal weg, und zwar so weit wie möglich. Um mir diese erträumte Ferne, das Unbekannte zu erschließen, begann ich zunächst Sinologie und Romanistik zu studieren. Über das Studium der Sprachen wollte ich in die Kulturen eintauchen.
Das Interesse an der Medizin schlummerte in tieferen Schichten. Aus der Erfahrung geborene Ängste, so scheint es mir heute, versperrten den Zugang fürs erste, so wie sie später der Grund für mein ärztliches Engagement, für die große Leidenschaft meines Lebens werden sollten. Als Kind hatte ich häufig Halsschmerzen und litt oft an Mittelohr-Entzündungen, einer Erkrankung, die heute dank der Antibiotika kaum noch so schmerzhaft verläuft, wie sie mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich erinnere mich noch genau an die schlimmen Besuche beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt, genauso wie an das Blutabnehmen mit stumpfen Kanülen. Die Spritzen besaßen damals in der Regel einen schlechten Schliff: vielfach sterilisierte Stahlröhrchen im Dauereinsatz. Auch kam kaum jemand auf die Idee, bei dieser Prozedur wenigstens ein freundliches oder beruhigendes Wort zu verlieren. Allenfalls bekam man einen aufmunternden Klaps, begleitet von der Bemerkung: »Indianer kennen keinen Schmerz!« Und die Eltern hatten gefälligst im Wartezimmer zu warten, bis die traumatische Prozedur vorbei war.
Dieses scheinbar herzlose Geschäft zu meinem Beruf zu machen, kam mir nicht in den Sinn – nicht bis zu dem Tag, da ich mich während meiner Bundeswehrzeit einer Mandel-Operation und danach gleich noch einer OP der Nasenscheidewand unterziehen musste. Die in beide Nasenlöcher zum Stillen der Blutung eingesetzten Tampons wurden am Folgetag ruckartig »herausgerissen«. Ich war, wie es mir damals schien, in die Hände von Folterknechten geraten. Dabei entsprach das Vorgehen fraglos der üblichen »Behandlung«. Absichtlich wollte mir niemand wehtun. Das wusste ich schon. Aber sollte diese Quälerei wirklich unvermeidlich sein? Sicher war der Zweifel, der mich damals spontan anfiel, naiv und unter den gegebenen Umständen ungerecht; losgelassen hat er mich fortan nie mehr. Unbeleckt von jeglichem Fachwissen dachte ich mir, dass es doch gelingen müsste, viele Behandlungen einfacher und sanfter durchzuführen, ohne den Patienten dieser höllischen Angst vor dem Eingriff oder den Ärzten auszusetzen. Unter Schmerzen wurde so der spontane Entschluss geboren, Arzt zu werden.
Lernen von Chinesen und Asiatinnen
Am nötigen Selbstvertrauen fehlte es mir mit Anfang zwanzig nicht, wenngleich es noch dauern sollte, bis aus dem ersten Übermut ein Mut erwuchs, der mir später half, manches zu wagen, worüber die erfahrenen Kollegen den Kopf schüttelten, wenigstens zunächst. Alles Neue erfordert schließlich die Überwindung eingeübter Verhaltensmuster, die der anderen ebenso wie der eigenen. Das braucht Zeit, ungeachtet aller rationalen Einsicht. Auch meine Angst vor den Spritzen legte sich erst, als mir während des Studiums eine koreanische Krankenschwester beibrachte, Kanülen einzuführen, ohne dass der Patient zusammenzuckt. Das Wissen um die Verpflichtung zum vorsichtigen und behutsamen Umgang mit den medizinischen Instrumenten sowie das Bewusstsein, dass jeder Patient genau wie ich seinerzeit in großer Angst sein könnte, verdanke ich einer Frau, in deren Kulturkreis ein mitfühlender Zugang eine medizinische Selbstverständlichkeit ist, Voraussetzung erfolgreicher Behandlung. Es war meine erste persönliche Begegnung mit einer Weltmedizin, von der wir mehr lernen können, als sich unsere schulmedizinische Weisheit träumen lässt. Hinzu kam, dass sich bald der Bogen zu den Anfängen meiner akademischen Ausbildung schließen sollte. Das »Virus« der chinesischen Medizin trug ich seit meinem Studium der Sinologie schon in mir. Beim Erlernen der Sprache hatte ich erste Eindrücke von der Hochkultur der Chinesen gewonnen. Ich war mit dem Konfuzianismus und dem Taoismus sowie mit den Lehren der chinesischen Medizin in Berührung gekommen. Außerdem traf ich bald auf einen chinesischen Arzt, der das, was ich mir auf der geisteswissenschaftlichen Ebene angeeignet hatte, medizinisch praktizierte. Erstens verstand er den Menschen, jeden Patienten für sich, stets als die Einheit von Körper, Seele und Geist. Und zweitens behandelte er, gleich, ob es um ein Leber-, Lungen- oder Rückenleiden ging, nie vornehmlich organbezogen, konzentriert auf die einzelne Dysfunktion, wie sich dies in der westlichen Schulmedizin im Zuge fachärztlicher Spezialisierung ausgeprägt hat. Vielmehr diagnostizierte und therapierte er diese oder jene Krankheit immer mit Blick auf das funktionale Zusammenwirken aller Körperregionen und Organe.
Wenn die Überlieferung stimmt, dann war es früher die oberste Pflicht von Ärzten im Reich der Mitte, ihren Patienten die Gesundheit zu erhalten. Dazu waren im Sinne der Vorsorge regelmäßige, wöchentliche oder monatliche Konsultationen vorgeschrieben. Allein dafür wurden die Ärzte honoriert. Die Behandlung von Krankheiten, die dennoch eintraten, mussten sie nachher mehr oder weniger unentgeltlich übernehmen. Es gab sozusagen einen Garantieanspruch der Patienten auf den Erhalt ihrer Gesundheit – eine weltmedizinische Reminiszenz, die uns zu denken geben sollte. Zum einem würde die Rückbesinnung auf derartige Vorsorgesysteme helfen, Behandlungskosten in schier unüberschaubarem Ausmaß einzusparen und den irgendwann drohenden finanziellen Kollaps des Gesundheitswesens abzuwenden. Zum anderen trüge es dazu bei, unserem geschäftlich rationalisierten Medizinbetrieb wieder humanere Züge zu verleihen. Das persönliche Verhältnis zwischen Arzt und Patient würde an Bedeutung gewinnen.
An sich nichts Besonders. Über Generationen hin war dies ein selbstverständlicher Denkansatz für jeden Hausarzt, nur eben nicht so attraktiv wie der Ausweis fachärztlicher Exzellenz. Das Streben danach, nach der Spezialisierung, befeuert den beruflichen Ehrgeiz mittlerweile mehr denn je. Kein Wunder daher, dass statt von Ärzten immer öfter von »Medizinern« die Rede ist. Der sachlich abgekühlte Begriff entspricht unserem technisch dominierten Zeitalter, wogegen nichts zu sagen wäre, folgte dem nicht die menschliche Entfremdung auf den Fuß – praktisch gesprochen der Bedeutungsverlust des ärztlichen Gesprächs, die Abfertigung der Patienten im Minutentakt. Glauben wir der Statistik, sprechen Arzt und Patient pro Konsultation gerade noch zwei Minuten miteinander. Nach weiteren fünf Minuten technischer Untersuchung ist der Arztbesuch beendet, ausgenommen die oftmals stundenlange Wartezeit davor. Rund achtzig Prozent aller Patienten wissen nach dieser Turbo-Behandlung nicht wirklich, woran sie erkrankt sind, noch wie die Medikamente wirken, die sie verordnet bekommen – und welche Nebenwirkungen sie nach sich ziehen könnten.
Diese Zustände sind nicht allein das Ergebnis großartiger medizinischer Fortschritte und des daraus erwachsenen Glaubens vieler Ärzte, dass sich die zuverlässigsten Ergebnisse ohnehin der technischen Diagnose verdanken. Auch die Patienten wollen zunehmend fachärztlich betreut werden, möglichst schnell. Auch sie betrachten ihren Körper nur allzu oft als eine Ansammlung von Organen, die sich einzeln »reparieren«, operieren und notfalls austauschen lassen. Das Vertrauen der Kranken wächst mit dem technischen Aufwand der Behandlung. Viele lassen sich lieber hastig durch eine Facharztpraxis schleusen, als dass sie sich mit dem gern belächelten »Wald-und-Wiesen-Arzt«, dem Allgemeinmediziner aus der Nachbarschaft in Ruhe besprechen.
Indes, der schwarze Peter soll hier nicht denen zugeschoben werden, die ärztlichen Beistand suchen. Zuerst sind wir es, die Ärzte, die Gefahr laufen, sich in der Hektik der Leistungsgesellschaft dem Ethos des Berufes zu entfremden. Ich will mich da gar nicht überheblich ausnehmen. Zwar reden wir gern über Behandlungskonzepte, über diese und jene Therapie, und halten uns zu Recht manches auf deren Erfolge zugute. Doch soll das schon alles gewesen sein? Dürfen wir uns damit zufrieden geben? Ist uns noch bewusst, welchen Ansprüchen wir gerecht werden müssten, wenn wir uns als »Therapeuten« ansehen wollen? Immerhin geht die Berufsbezeichnung auf das griechische therapeia zurück, wörtlich zu übersetzen mit Behandlung und Pflege. Für Platon bedeutete dieser Pflegebegriff im philosophischen Sinne die Orientierung auf das wahre Sein: psychän therapeuein – sich um die Seele der Kranken kümmern. Welcher Arzt dürfte heute ruhigen Gewissens von sich sagen, dass er das immer tut, dass er noch über die Zeit verfügt, die das verlangte? Abgesehen von den Psychotherapeuten, bei denen darin der eigentliche Behandlungsauftrag besteht, sicher nur sehr wenige.
Das ist – nochmals – kein Vorwurf an die Kollegen. Und wenn es einer wäre, dann einer, den ich mir wenigstens teilweise selbst machen müsste. Sehr wohl aber ist es eine alarmierende Feststellung. Denn wenn wir uns zunehmend darauf konzentrieren, einzelne Aggregate, Komponenten des Körpers zu reparieren, der eine dieses, der andere jenes Organ, entgleitet uns nolens volens das Ganze, der Mensch. Der Humanmedizin droht der Verlust ihres humanen Charakters.
Wider den Untergang des Humanismus in der Medizin
Schon als ich mich nach dem Studium entscheiden musste, in welcher Fachrichtung und wo ich als Arzt einmal arbeiten wollte, hat mich dieser Gedanke umgetrieben. Während der Woche befand ich mich in der Ausbildung zum Radiologen an der Kieler Universitätsklinik. An den Wochenenden übernahm ich hausärztliche Vertretungsdienste im Umland. Manchmal begleitet von einem erfahrenen Kollegen, fuhr ich über die Dörfer, um allgemein praktizierend Erfahrungen zu sammeln, so wie ich mir später manches von den Heilern anderer Kulturen abschaute. Für die Radiologie hatte ich mich entschieden, um nachher als Landarzt in der Lage zu sein, Röntgenbilder ohne fremde Hilfe genauestens zu interpretieren.
Das war der Plan. Aufgegangen ist er nicht, jedenfalls nicht nach dem Vorbild der üblichen fachärztlichen Laufbahn. Weder bin ich Landarzt geworden noch ein »fachzentrierter« Radiologe. Nach wie vor, noch nach vier ärztlich durchlebten Jahrzehnten, bin ich auf der Suche, als Wissenschaftler und Forscher im Bereich der Schulmedizin sowie als Reisender durch die Gefilde einer über Jahrtausende gewachsenen Weltmedizin. Der Entdeckung sowie der Wiederentdeckung dessen, was sich da angesammelt hat, ist nicht weniger Bedeutung beizumessen als der Entwicklung neuer schulmedizinischer Diagnose- und Heilverfahren oder Methoden der High-Tech-Medizin. Erst wenn beides zusammenkommt, dürfen wir uns Hoffnung machen, den Traum von der ewigen Gesundheit mehr und mehr verwirklichen zu können. Ganz erfüllen wird er sich nirgends und nie. Umso mehr aber sollten wir alles an Wissen zusammentragen, was sich als nützlich erwiesen hat, den Menschen zu helfen. Sei es die Mikrotherapie, um deren schulmedizinische Anerkennung ich jahrelang kämpfen musste, sei es die alternative Medizin oder die Heilkunde der Naturvölker. Warum soll sich das eine nicht mit dem anderen vertragen? Immer vorausgesetzt, dass es nachweisliche Erfolge gibt. Auf faulen Zauber müssen wir nichts geben, nicht in der Wissenschaft und nicht bei den Beschwörungsritualen der Schamanen.
Wer aber wollte bestreiten, dass manche Krankheiten etwa in Indien und in China seit Jahrtausenden schonender behandelt werden als bei uns in Europa. Selbst die Krankenkassen, von Haus aus vorsichtig, haben ja unterdessen eingesehen, dass es von Fall zu Fall gescheiter ist, die Kosten einer fachkundig ausgeführten Akupunktur zu übernehmen als Unsummen für einen operativen Eingriff zu zahlen, der unter Umständen gar nicht nötig gewesen wäre.
Die fortschreitende Globalisierung, das engere Zusammenrücken einstmals getrennter Welten, sollte es doch möglich machen, endlich auch lange gehegte Vorurteile zu überwinden. Dass sich der therapeutische, auch ökonomische Gewinn, der daraus folgen würde, nicht für alle von selbst verstehen mag, liegt wohl im menschlichen Charakter begründet. Doch nicht hinter jeder Geistheilung muss ein hypnotischer Schwindel stecken, nicht immer verbirgt sich dahinter Hokuspokus, nur weil wir dem Geheimnis noch nicht auf den Grund gehen konnten. Man darf es getrost als die Kehrseite unseres medizinischen Fortschritts ansehen, dass damit ein Selbstbewusstsein gewachsen ist, das uns vielfach zu einem Gefühl der Überlegenheit verführt. Gut beraten sind wir damit keineswegs.
Wie heilt man ohne Labor, EKG und Bildgebung?
Gerade weil traditionelle Heiler meist nicht über die anatomischen, biochemischen oder physiologischen Kenntnisse verfügen, die jedem Medizinstudenten bis zum Physikum beigebracht werden, weil sie nicht die Möglichkeit haben, den Körper mit den modernsten Verfahren der Bildgebung zu durchleuchten, können sie seine Organe nicht isoliert betrachten. Vielmehr müssen sie den Menschen ganzheitlich auffassen, als die Einheit von Körper, Seele und Geist. Wie denn sonst sollten sie ihn verstehen, ohne Hand an seine leibliche Existenz zu legen?
Da wir das in der technokratisch geprägten Zivilisation des Westens heute nicht mehr nötig haben, wenigstens glauben, es nicht nötig zu haben, neigen wir dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aus den Menschen, die auf Behandlung hoffen, sind Kunden geworden. Wir scheuen weder Kosten noch Mittel, sie als Konsumenten zufrieden zu stellen, ohne ihnen sonst näherkommen zu müssen. Wir brauchen Frau, Mann oder Kind ja nur zu röntgen oder in die »Röhre« zu schieben, um bestens über ihren inneren Zustand informiert zu sein. Schneller, als es der selten fachkundige, oftmals nicht medizinisch redegeübte Patient beschreiben könnte, sind wir in der Lage, uns eine Vorstellung von seinem Leiden zu machen, theoretisch, typologisch und allgemein.
Was uns dagegen entgeht, ist die Individualität des Patienten als bestimmender Faktor dieser oder jener Krankheit. Unbestritten ist dabei, dass es mittlerweile gelingt, von Beschwerden und Schmerzen zu erlösen wie nie zuvor. Vieles, das früher den sicheren Tod bedeutete, lässt sich inzwischen erfolgreich behandeln. Selbst den Motor des Lebens, das Herz, könne wir transplantieren. Was die Therapie der Symptome anbelangt, sind wir unübertroffen. Ob wir damit immer das Übel bei der Wurzel packen, ist eine ganz andere Frage. »Operation gelungen, Patient tot«, sagt ein sarkastisch übertreibendes Sprichwort.
Meine Erfahrung hat mich jedenfalls gelehrt, dass wir – zumal in den weniger eindeutigen Fällen – nachhaltige Heilungserfolge nur erzielen können, wenn wir uns menschlich auf den Patienten einlassen, ihm mehr als Subjekt denn als Objekt der Behandlung begegnen, ihn individuell wahrnehmen. Es gibt keine »Krankheiten«, sondern nur »kranke Menschen«, wie es Georg Groddeck, der Wegbereiter der Psychosomatik, einmal auf den Punkt gebracht hat. Und jeder kranke Mensch ist einzigartig. Nur darin sind wir alle gleich: Jeder stellt eine individuelle Persönlichkeit dar, die Anspruch auf persönliche Zuwendung erheben darf. Viele »Geheimnisse« der Weltmedizin lassen sich, wie wir noch sehen werden, zuvörderst auf das empathische Verhältnis der Heiler zu ihren Patienten zurückführen.
Psychosomatik Dass Körper und Seele untrennbar miteinander verbunden sind, dass also psychische Einflüsse auf körperliche Vorgänge einwirken – und umgekehrt –, ist eine Grundüberzeugung sowohl der antiken wie auch der traditionellen chinesischen und indischen Medizin sowie anderer ganzheitlicher Heilkunden, etwa in Afrika, Australien, Nord- und Südamerika. Insofern ist die von Johann Heinroth (1773–1843) und Georg Groddeck (1866–1934) begründete Psychosomatik, als einer Krankheitslehre, die psychische und soziale Ursachen von Erkrankungen diagnostisch und therapeutisch einbezieht, gewissermaßen eine eigenständig entstandene weltmedizinische Disziplin.
Beinahe kaltherzig mutet dagegen das gesundheitspolitische Credo unserer Tage an. Ihm zufolge gilt: Gesund ist, wer funktioniert, ohne dass die Maschinerie ins Stottern gerät. Ein geradezu mechanisches Gesundheitsverständnis, Ausdruck menschlicher Verarmung auf höchstem technischem Niveau. Derart banal wurde »Gesundheit« nicht zu allen Zeiten definiert. Die Bedeutung des Begriffs wandelte sich im Laufe der Geschichte. In der Antike wurde er zunächst anthropologisch, also zugleich geistes- und naturwissenschaftlich verstanden. Es ging um die Harmonie des Lebens mit dem Kosmos, während es in der chinesischen Medizin die Balance zwischen Yin und Yang ist, die im Zentrum des Gesundheitsbegriffes steht. Davon wird später ausführlicher zu handeln sein. Fürs erste soll der Hinweis darauf genügen ebenso wie der Verweis auf das christliche Mittelalter, in dem als »gesund« galt, wer über die Stärke verfügte, Leid zu ertragen. Im antiken und im chinesischen sowie im christlichen Verständnis des Wortes spielte die seelische Komponente eine wesentliche Rolle.
Individualisierte Medizin
Die psychische und soziale Situation und ihr Einfluss auf die Gesundheit der Menschen – und damit das kulturgeschichtlich ursprüngliche Verhältnis von Krankheit und Gesundheit – klingt auch in der Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, zwischen den Zeilen an. »Gesundheit«, heißt es da, sei »der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen«. Mit anderen Worten, auch der Behinderte kann ein »gesundes« Leben führen. Ihm dieses zu ermöglichen ist nicht allein eine medizinische Aufgabe, sondern zugleich eine gesellschaftliche, eine seelsorgerische nicht zuletzt. Auch der Glaube, woran immer, kann heilen. Wahre Wunder tun die tröstend verständnisvollen Worte einer Mutter, eines Arztes oder eines geistlichen Beistands, indem sie Selbstheilungskräfte wecken, die uns allen innewohnen. Und sei es nur für den Augenblick der Hoffnung. Ohne diese einfühlende Zuwendung bleibt für mich jede ärztliche Behandlung Stückwerk. So dringend, bisweilen lebensrettend die medikamentöse Verordnung oder der operative Eingriff sein mögen, ob eine Therapie anschlägt, ob die OP erfolgreich verläuft, hängt – ich wiederhole mich – allemal von individuellen Faktoren ab. Insofern ist die Medizin eben gerade keine absolute Wissenschaft, unanfechtbar, weil allein naturgesetzlich begründet.
Wie der Professor am Universitätsklinikum so hat der kräuterkundige Indianer Recht, wenn es ihm mit zelebriertem Zauber gelingt, einen Verletzten zu heilen. Was die Kraft der Suggestion und das überlieferte Wissen um die heilende Wirkung aller möglichen Pflanzen, bekannter und unbekannter, vermag, habe ich auf meinen Reisen vielfach erfahren. Manches war dabei so verwunderlich, dass ich nur ungläubig staunen konnte. Anderes erinnerte mich unverhofft an die eigene Kindheit.
Bei dem leisesten Anflug von Fieber legte meine Mutter uns Kinder ins Bett, ließ uns schwitzen und erst wieder aufstehen, nachdem wir drei Tage fieberfrei waren. Ehe der Arzt gerufen wurde, versuchte sie dem Übel mit den berühmten Hausmitteln zu begegnen, besser noch vorzubeugen. Behandelt wurde nach dem Prinzip, das ich später zur Richtschnur meiner ärztlichen Tätigkeit machte: vom Leichten zum Schweren. Bevor man zu den fiebersenkenden Tabletten in der Hausapotheke, einem weißen Wandschrank mit rotem Kreuz auf der Tür, griff, gab es kalte Wadenwickel, die alle zwanzig Minuten gewechselt wurden. Dazu händisch ausgepresste Gemüsesäfte. Wenn ich daran denke, habe ich heute noch den strengen Geschmack einer Trinktinktur gegen den Husten aus Zwiebelsud und Kandis auf der Zunge, zum Schütteln. Zwar führte die unerbittlich verordnete Kur nicht immer zum erhofften Erfolg, beschwerde- und schmerzlindernd war sie allemal. Die Rezepte des Arztes taten dann von Fall zu Fall das ihre, nötig waren sie nicht immer. Öfter war es allein mit der naturheilkundigen Therapie getan. Zu manchem davon hab ich meinen Patienten nachher in der ärztlichen Praxis selbst geraten. Die Wadenwickel sind bei akutem Fieber ein geradezu phantastisches Hausmittel. Nur wer weiß das noch?
Der aus dem Schlamm kam, Carl Abraham von Hunnius
Dass solche einfachen Verfahren, der Grundstock aller Weltmedizin, bei uns nicht nur angewendet wurden, sondern zum Teil von einem meiner Vorfahren entdeckt worden waren, habe ich erst später erfahren. Irgendwann, als ich selbst längst praktizierte, erzählte mir meine Mutter, ihrerseits Krankenschwester, von Carl Abraham Hunnius: dem ärztlichen Stammvater der Familie, könnte man sagen. Ausgang des 18. Jahrhunderts als Sohn eines deutschen Kaufmannsgeschlechts in Reval, dem heutigen Tallinn, geboren, hatte er sich 1815 an der medizinischen Fakultät im estnischen Dorpat, das jetzt Tartu heißt, eingeschrieben. Nach dem Studium wirkte er unter anderem in einem Invalidenkommando, bevor es ihm gelang, sich als Landarzt zu etablieren. Die Betreuung vermögender Patienten gehörte nicht von Anfang an zu seinen täglichen Aufgaben. Öfter musste er mit Pferd und Wagen an der Küste unterwegs sein, um die ärmeren Fischer und deren Angehörige zu behandeln.
Ein Glücksfall, wie sich bald zeigen sollte. Bei seinen Hausbesuchen war ihm nämlich aufgefallen, dass die Männer, wenn sie an den wärmeren Tagen vor ihren Katen saßen, die Beine gern in einen Trog voller Schlamm steckten. Einer, von dem Hunnius wusste, dass er an Ischias litt, erzählte ihm, wie gut ihm das tue, wie es helfe, seine Schmerzen zu lindern. Bei dem Arzt weckte diese Beobachtung die Neugier des Forschers. Durch und durch wissenschaftlich interessiert, unternahm er erste Versuche bei der Behandlung rückenleidender Soldaten in der heimischen Garnison. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die Schlammtherapie gleich bei mehreren Krankheiten mit überraschend guten Ergebnissen verlief, ob es nun um Rheumatismus, chronische und nachoperative Nervenleiden oder Hautprobleme ging. Aus der ärztlichen Praxis hatte sich die Entdeckung einer neuen Behandlungsmethode ergeben.
Fortan, bis zum Ende seines Lebens arbeitete Carl Abraham Hunnius am Ausbau »seines« Naturheilverfahrens, eines der ersten in der moderneren Medizin Europas. Zu den Fußbädern kamen Wickel und Kompressen mit angewärmtem Schlick, Bäder in schlammigem Meerwasser, Massagen und Einreibungen. Immer mehr Menschen hofften, in der warmen »Meerwasser-Wanne« zu genesen oder ihre Schmerzen wenigstens vorübergehend loszuwerden. Der Erfolg sprach sich herum, so dass private Investoren auf den Plan traten. 1825 ermöglichten sie die Gründung der ersten »Schlamm-Wasser-Heilanstalt« in Hapsal, estnisch Haapsalu, einer Stadt, der Tschaikowsky sogar eine Symphonie widmete. Die Kleinstadt an der Ostsee entwickelte sich zu einem Kurort, den selbst die russische Zarenfamilie gelegentlich aufsuchte.