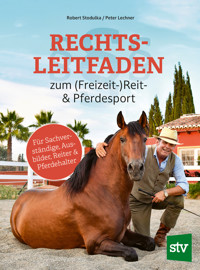79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Enke
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Jede Einwirkung des Reiters hat Auswirkungen auf die Gesundheit des Pferdes. Positive oder negative, Losgelassenheit oder Verspannung. Aber was bedingt was? Die »Medizinische Reitlehre« zeigt nachvollziehbar die Zusammenhänge zwischen der Biomechanik des Pferdes und den Lektionen der Dressurreiterei. Sie macht deutlich, welche Ausbildungsfehler welche Folgen nach sich ziehen und welche reiterlichen und physiotherapeutischen Maßnahmen angezeigt sind. Dem ambitionierten Reiter liefert das Buch wertvolle Hilfestellung bei der Ausbildung oder Korrektur seines Pferdes. Der Tierarzt wird mit diesem Wissen trainingsbedingte Störungen besser beurteilen und erfolgreicher therapieren und den Reiter im Hinblick auf eine Trainingsoptimierung beraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ich widme dieses Buch meinen Eltern Karl-Erhard und Gerlinde, die mir durch ihre permanente Unterstützung ermöglicht haben, das zu werden, was ich heute bin.
Medizinische Reitlehre
Trainingsbedingte Probleme verstehen, vermeiden, beheben
Robert Stodulka
135 Abbildungen
Geleitworte
von Prof. Dr. Horst Erich König, Ordinarius für Anatomie
Es ist ein besonderer Glücksfall, wenn ein hoch spezialisierter Tiermediziner, Fachtierarzt für Physiotherapie und Rehabilitationsmedizin, bewandert in alternativmedizinischen Methoden, selbst Reiter, die Zeit findet, seine Erfahrungen in Buchform mitzuteilen. Der Autor praktiziert in zwei Ländern der Europäischen Union, die beide in ihrer Jahrhunderte langen Tradition mit der Reitkultur verbunden sind und weltweit bekannte Pferde züchten. Er nimmt zudem einen Lehrauftrag an der Veterinärmedizinischen Universität Wien wahr.
Das Einzigartige und Neue an diesem Werk ist, dass hier nicht nur detaillierte Informationen zum Erlernen der Reitkunst, zum Training und zur Ausbildung des Pferdes gegeben werden, sondern dass vor allem auch auf die Fehler, die ein Reiter machen kann und die sich unmittelbar auf die Gesundheit des Pferdes auswirken können, aufmerksam gemacht wird.
Reiter und Pferd sind zwei Lebewesen, die aufeinander unbedingt angewiesen sind. Der Reiter ist derjenige, dem das Pferd sein volles Vertrauen schenkt, der die Aktivitäten des unter ihm befindlichen hochsensiblen Wesens lenken muss und der die Verantwortung für dessen Leistungsfähigkeit, sein Wohlbefinden und seine Gesundheit trägt.
Dieses einzigartige Buch spricht ein großes Publikum an, Tierärzte, Studierende der Veterinärmedizin und der Pferdewissenschaften, Reiter und Pferdebesitzer und alle diejenigen, die Pferde lieben.
Möge das Werk zum Wohle der Reiter und der Pferde eine große Verbreitung finden.
Prof. Dr. med. vet. Dr. h.c. Horst Erich König Veterinärmedizinische Universität Wien
von Arthur Kottas-Heldenberg, Reitmeister und ehem. Erster Oberbereiter der Spanischen Hofreitschule zu Wien
Ich habe viele Reitlehren gelesen. Diese Medizinische Reitlinie ist eine der besten und leicht verständlich für jung und alt, Profis und Amateure. Eine Pflichtlektüre für Tierärzte und Pferdeliebhaber. Das Pferd und der Reiter müssen psychisch und physisch in der Lage sein, das von ihnen Verlangte auch zu verstehen. Dr. Robert Stodulka hat es verstanden, sein Wissen und seine Erfahrung in diesem Buche zu verewigen. Ein Dankeschön und viel Erfolg mit diesem herrlichen Buch.
Mit reiterlichem Gruß Ihr Arthur Kottas-Heldenberg
von D. Francisco Reina Osuna, Direktor der Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, der Königlich Andalusischen Hofreitschule in Jerez de la Frontera
Dieses Werk bietet dem Pferdeinteressierten Informationen zweier weiter Felder, die miteinander eng verbunden und von der klassischen Reitkunst untrennbar sind. Wie der Euphrat und der Tigris, so fließen die Reitkunst und die Biomechanik eng zusammen und bilden eine synergistische Gesamtheit, in der das eine ohne das andere nicht bestehen kann.
Während schon mehrere hundert Jahre wissenschaftliche Abhandlungen über die Reitkunst verfasst wurden, sind die biomechanischen Zusammenhänge in ihrer Notwendigkeit und wissenschaftlichen Aufbereitung erst in den letzten Jahrzehnten besonders erfasst worden. Sie dienen heute als wissenschaftlich belegte Grundlage für ein sinnvolles und gesundheitserhaltendes Ausbildungssystem.
Das Verständnis der Probleme des Pferdes während der Ausbildung sowie profunde Kenntnisse auf beiden Gebieten – der Reitkunst und der Anatomie des Pferdes – sind unangezweifelt notwendig und gehen fließend ineinander über. Trotzdem ist der Lösungsansatz, ein so genanntes „reiterliches Problem“ in der Biomechanik des Pferdes zu suchen, ein sehr moderner und noch nicht weit verbreiteter. Er ist aber durch die Weiterentwicklung der modernen Pferdeausbildung sowie der genauen Kenntnis der Psyche des Pferdes durchweg begrüßenswert und sinnvoll. Reitkunst ohne harmonische Ausführung von Bewegungsabläufen wäre undenkbar und somit auch von Kunst weit entfernt.
In der Reitkunst wurde schon von den alten Meistern alles niedergeschrieben, leider aber oft zu wenig gelesen, missinterpretiert und auch somit häufig falsch angewendet. Dennoch ist es notwendig, den richtigen Weg zu gehen, um die Gesundheit des Pferdes als höchstes Gut zu erhalten. Heutzutage gibt es dank der wissenschaftlichen Entwicklung Möglichkeiten, Therapien etc., welche das Pferd im Geiste und Körper gesund erhalten können, um von ihm die gewünschten sportlichen Leistungen selbst auf höchstem Niveau abzuverlangen.
Gute Trainingsbedingungen, Management, Reiter, Trainer, Hufschmiede und letzen Endes auch der Tierarzt bilden als Equipe die Basis für den sportlichen Erfolg.
Dennoch ist nichts so wichtig wie der Einfluss des Reiters auf sein Pferd. Beide müssen in einem harmonischen, vertrauensvollen Verhältnis zueinander stehen, damit der Reiter das Pferd zur richtigen Zeit motivieren, beruhigen und auch verstehen kann. Der Reiter bewahrt die Kadenz, den Schwung, das Gleichmaß in der Bewegung, das Gleichgewicht sowie die „Legerté“, die viel gesuchte Leichtigkeit, ausschließlich durch das, was man mit „Reitertakt“ oder Gefühl bezeichnet. Er muss sich all jene Kenntnisse aneignen, um so mit dem Pferd eins werden zu können. So ist es notwendig, sich auch über die mechanischen Grundlagen der „lebendigen Maschine“ Pferd eingehend zu informieren, zu lernen, wie es sich bewegt und vor allem was es bewegt. Denn über allem darf man nicht vergessen, dass das Pferd als lebender Sportkamerad uns zu dem macht, was wir sind, nämlich Reiter.
Wir sind überzeugt, dass die neue Generation von Reitern, Ausbildern und Pferdeleuten der „alten“ Generation würdig nachfolgt und diese in manchen Belangen vielleicht sogar übertreffen könnte ... Jedoch nur dann, wenn eine beträchtliche Dosis an Bescheidenheit und Liebe zum Pferd mit dem unbändigen und unermüdlichen Bestreben gepaart ist, die Perfektion durch Mühe, Fleiß und täglicher Aufopferung für und mit dem Pferd zu erlangen. Das Verständnis um die Biomechanik und die Grundfesten der Reitkunst darf an dieser Stelle nicht fehlen. Wer die Biomechanik kennt, dem wird auch der Hauptdarsteller der Reitkunst nicht unbekannt bleiben – das Pferd.
D. Francisco Reina Osuna
Vorwort
Der Pferdesport gewinnt als Breitensport immer mehr an Beliebtheit, die Anzahl der Pferdeliebhaber wird immer größer. Neben den sportlich Ambitionierten gibt es eine Vielzahl von Reitern, die ein solide ausgebildetes Pferd als Selbstzweck sehen, ohne jedoch dieses vorzeitig verschleißen zu wollen. Das Interesse an „komplementären“ Reitmethoden nimmt stark zu, was die Tendenzen hinsichtlich pferdegerechter und vor allem biomechanisch korrekter Ausbildung immer stärker in den Vordergrund stellt.
Mein langjähriger Freund, Reitlehrer und Mentor zu diesem Werk, D. Juan Rubio Martinez, hat mich durch seine unermüdlichen Bemühungen die gymnastizierenden Wirkungen der Reitkunst in ihrem gesamten Umfang zu erfassen gelehrt. Durch stunden- und nächtelange Gespräche über das von ihm Erprobte und Erfühlte war es uns möglich ein System zu finden, das lediglich allein vom Pferd durch seine Anatomie und Biomechanik vorgegeben wird. Dies ermöglicht uns, dieses so edle Tier zu trainieren, ohne dabei Gefahr zu laufen, es schon im Zuge des Trainings vorzeitig zu verschleißen.
Basierend auf trainingsphysiologischen Grundlagen und dem Feingefühl dieses Reitmeisters war es so möglich, ein allgemein verständliches Konzept dem interessierten Reiter und Tierarzt vorzulegen, welches von der Remonte bis hin zum „Problempferd“ anwendbar ist. Da es auch für das Pferd nachvollziehbar ist, wird es von diesem gerne angenommen.
Aus diesem Grunde ist es für Reiter aller Sparten empfehlenswert und sinnvoll, sich an den Richtlinien der systematischen, klassischen Reitlehre zu orientieren, um so den anatomischen und biomechanischen Gegebenheiten des Freizeitpartners Pferd Rechnung zu tragen und dadurch auch unliebsame Widerstände vermeiden zu können.
In diesem Buch wird eine Brücke zwischen der Anatomie und Biomechanik des Pferdes und einem sinnvollen, für das Pferd nachvollziehbaren Ausbildungsweg geschlagen. Dieses Buch soll die Reitkunst auch für den nicht reitenden Tierarzt bzw. medizinisch nicht informierten Reiter transparenter machen, wodurch dem Kameraden Pferd viel Leid erspart werden kann.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Pferden viel Erfolg.
Frühjahr 2006 Dr. med. vet. Robert Stodulka Fachtierarzt f. Physiotherapie und Rehabilitationsmedizin Univ. Lektor FTA Mag.
Danksagung
Ich möchte meinem Freund und Oberbereiter der Königlich Andalusischen Hofreitschule (REAAE) in Jerez de la Frontera, D. Juan Rubio Martinez, und dem technischen Direktor dieser Institution, D. José Maria Sanchez Cobos, sowie dem geschäftsführenden Direktor, D. Francisco Manuel Reina Osuna, recht herzlich danken, dass sie mich in unermüdlicher Art und Weise in reitkunstrelevanten Fragen tatkräftig unterstützt und beraten haben.
Ebenso bedanke ich mich bei dem Leiter der Pferdeklinik der REAAE, Joaquin Cantos Leyba, für die gute tierärztliche Zusammenarbeit an dieser Institution. Besonderen Dank schulde ich Herrn Reitmeister Arthur Kottas Heldenberg für die hervorragende fachliche Unterstützung sowie den Pferden, die immer meine besten Lehrmeister waren.
Herrn Univ. Prof. Dr. Horst König, seines Zeichens Vorstand des Institutes für Anatomie an der Veterninärmedizinischen Universität Wien, bin ich aufgrund seiner hervorragenden fachlichen Beratung und Revision des anatomischen Parts zu besonderem Danke verpflichtet.
Abschließend möchte ich noch meiner lieben Kollegin Dr. Gabriela Wagner für die wunderschönen Illustrationen in diesem Buch recht herzlich danken, da sie trotz großen Zeitdrucks diese rechtzeitig bereitstellen konnte.
Inhalt
I Grundlagen und Basiswissen
1 Geschichte der Reitkunst – Die wichtigsten Haltestellen im Überblick
2 Glossar der Reitkunst
3 Wozu Dressur und Gymnastizierung – Nur „L’art pour L’art“?
4 Auf der Suche nach der Leichtigkeit – „Was ist Legerté?“
5 Biomechanische Grundlagen als Basis eines erfolgreichen Trainings
5.1 Das „gute“ Pferd – Anatomie, Physiologie und Biomechanik
5.1.1 Das Skelett
5.1.2 Muskulatur und Bandstrukturen
Muskeltypen
Die Kopf- und Halsregion
Das Nackenrückenband
Der Rücken – Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und Thorax
Die Vorderextremität
Die Hinterextremität
5.2 Der „gute“ Reiter – die richtige Hilfengebung
5.2.1 Hilfengebung
Stimmhilfe
Zügelhilfen
Schenkelhilfen
Gewichtshilfen
II Medizinische Reitlehre – Ausbildung und Problemprophylaxe
6 Die Ausbildung des Pferdes
6.1 Die Frage nach dem Reitsystem – französisch, spanisch oder doch deutsch?
6.2 Reitweisen und ihre spezifischen Probleme
6.2.1 Dressur
6.2.2 Springen
6.2.3 Doma Vaquera, Western (Reining)
6.2.4 Military
6.2.5 Freizeitpferde
6.2.6 Rennpferde
Galopper
Traber
6.2.7 Gespannpferd
6.2.8 Gangpferde
6.3 Junge Remonte, alte Remonte, Schulpferd
7 Ausrüstung des Pferdes
7.1 Der passende Sattel
7.1.1 Der englische Pritschsattel
7.1.2 Trachtensattel
7.1.3 Westernsättel
7.1.4 Iberische Sättel
7.1.5 Islandsättel
7.1.6 Sitzkissen, elastische Sattelbäume, Sattelbaumbruch
7.1.7 Einfluss der Sattelung auf die Shu-Punkte des Pferdes
7.2 Die passende Zäumung
7.2.1 Grundlagen zur Anpassung des Zaumzeugs
7.2.2 Kriterien zur Auswahl des richtigen Gebisses
Die Kandare
Das Pelham
Die gebisslosen Zäumungen
7.2.3 Einfluss des Gebisses auf Bewegungsstörungen des Pferdes und die Reiterhand
7.2.4 Die Zähne des Pferdes und das Gebiss
7.2.5 Reithalfter und ihre Auswirkungen auf wichtige Akupunkturpunkte am Kopf des Pferdes
8 Der korrekte Trainingsaufbau
8.1 Prävention und Fitness
8.2 Grundlagen des Trainingsaufbaus
8.3 Richtiges Aufwärmen und Abkühlen des Pferdes
9 Longenarbeit
9.1 Allgemeine Überlegungen
9.2 Ausrüstung
9.3 Der Einsatz von Hilfszügeln
9.4 Round Pen
9.5 Die Kommunikation mit dem Pferd an der Longe
9.6 Gewöhnung der Remonte an die Longe – Probleme und deren Behebung
9.7 Longenarbeit des gerittenen Pferdes
9.8 Doppellongenarbeit
10 Skala der Ausbildung
10.1 Takt – Die Qualität der Grundgangarten des Pferdes
10.1.1 Der Schritt
10.1.2 Der Trab
10.1.3 Der Galopp
10.2 Losgelassenheit
10.2.1 Innere Zwanglosigkeit – Mentale Losgelassenheit
10.2.2 Die Dehnungshaltung Vorwärts-Abwärts
10.3 Anlehnung
10.3.1 Beizäumung
10.4 Schwung
10.4.1 Kontrollierter Vorwärtsimpuls vs. Geschwindigkeit
10.4.2 Trabverstärkungen – ein Sonderfall?
10.5 Geraderichten
10.5.1 Die natürliche Schiefe
10.5.2 Wege zum Geraderichten
10.5.3 Reiten in Biegung – Grenzen und Möglichkeiten der Rippenbiegung
10.6 Versammlung
10.6.1 Rückwärtsrichten
11 Einsatz und Nutzen von Konterstellung und Seitengängen
11.1 Reiten in Konterstellung
11.2 Seitengänge
11.2.1 Schulterherein – Konterschulterherein
11.2.2 Travers
11.2.3 Renvers
11.2.4 Traversale
11.2.5 Schenkelweichen
12 Einsatz und Nutzen von Lektionen der Hohen Schule und der klassischen Dressur
12.1 Piaffe
12.2 Passage
12.3 Galopppirouette
12.4 Fliegender Galoppwechsel
12.5 Spanischer Schritt – Paso Español
13 Cavalettiarbeit
14 Mobilisationsübungen an der Hand
14.1 Mobilisationen nach Baucher
14.2 Mobilisationstechniken aus der Physiotherapie zur Verbesserung der Beweglichkeit
14.2.1 Hals
14.2.2 Vorderextremität
14.2.3 Hinterextremität
14.2.4 Rücken und Iliosakralgelenk
14.3 Spanische Handarbeit
14.4 Handarbeit nach der Wiener Schule
15 Langer Zügel
III Problembehebung und spezielle physiotherapeutische Praxis
16 Untersuchungsgang
16.1 Anamnese
16.2 Adspektion in Ruhe und Bewegung
16.2.1 In Ruhe
16.2.2 Vorführen an der Hand
16.2.3 Vorführen an der Longe
16.2.4 Vorführen unter dem Sattel
16.3 Motion-Palpations-Analyse
16.3.1 Kopf und Hals
16.3.2 Vorhand
16.3.3 Hinterhand
16.3.4 Wirbelsäule
16.4 Thermographie
17 Bewegungstherapie – Rehabilitationstrainingslehre
17.1 Unterschiede zum allgemeinen Trainingsprogramm
17.2 Longenarbeit
17.2.1 Korrektur verrittener Pferde an der Longe
17.2.2 Der Rehapatient an der Longe
17.3 Der Einsatz von Hilfszügeln und ihre Bedeutung in der Rehabilitations- und Trainingsphase
18 Ergänzende physiotherapeutische Methoden im Überblick
18.1 Manualtherapien
18.1.1 Dehnungen und Mobilisationen
18.1.2 Osteopathie und Chiropraxis
18.1.3 Massage
Effleurage (Streichungen)
Petrissage (Knetungen)
Friktion (Reibung)
Vibrationen (Schüttelungen)
Tapotement (Klopfungen)
Lymphdrainage
Bindegewebsmassage
18.2 Gerätetherapien
18.2.1 TENS
18.2.2 Softlaser
18.2.3 Magnetfeldtherapie
18.2.4 Therapeutischer Ultraschall
18.2.5 Iontophorese
18.3 Kältebehandlung (Kryotherapie)
18.4 Wärmebandlung
18.5 Akupunktur
18.5.1 Kombinierte Akupunkturpunkt-Mobilisations-Therapie
18.6 Neuraltherapie (Triggerpoints)
19 Rehabilitationsmedizinische Maßnahmen bei spezifischen Indikationen
19.1 Durch den Reiter bedingte Probleme
19.1.1 Taktfehler, Zügellahmheiten, fehlerhafte Gangarten
19.1.2 Überzäumung und falscher Knick
19.1.3 Anlehnungsschwierigkeiten, Maulprobleme, Zungenfehler
19.2 Rückenprobleme
19.2.1 Allgemeine Behandlungsvorschläge
19.2.2 Kissing-spine-Syndrom
19.2.3 Verspannungen, Wirbel- und Gelenkblockaden
19.3 Headshaking
19.4 Sehnenschäden
19.5 Arthrosepatienten
19.6 Beschlag orthopädischer Rehapatienten
Anhang
I Grundlagen und Basiswissen
1 Geschichte der Reitkunst – Die wichtigsten Haltestellen im Überblick
Die Domestikation des Pferdes brachte es mit sich, dass sich aus dem Nahrungslieferanten Pferd ein geschichtsbestimmender Partner des Menschen entwickelt hat. Schon im alten Griechenland wurde vor mehr als 400 Jahren v.Chr. das Pferd gezähmt, geritten und im Kampfe eingesetzt.
Die philosophische und wissenschaftliche Hochkultur der antiken Griechen ermöglichte dem ersten Reitoberst Xenophon (430 v.Chr.), mit dem Wissen um Bewegung und Trainingsaufbau die erste Reitlehre zu verfassen. Er beschäftigte sich eingehend mit dem unabhängigen Sitz, da es zu dieser Zeit noch keine Steigbügel gab. Ebenso widmete er sich aufgrund des philosophischen Hintergrundes, den er als Schüler von Sokrates erhielt, besonders der Einheit Pferd–Mensch–Körper–Seele, die sich auch in der Beschreibung im Umgang mit dem Pferd deutlich widerspiegelt. Er erkannte, dass ein Pferd niemals im Zorn zu strafen sei und vollendete Harmonie nie durch Zwang erreicht werden könne. Damit legte er die Grundlagen für ein losgelassenes, versammeltes Arbeiten mit dem Pferd. Er erkannte auch, dass das empfindliche Pferdemaul durch die Verwendung weicher Trensengebisse erhalten werden muss und dass ein versammelt gehendes Pferd im Kampfe wendiger und schneller zu dirigieren ist. Der Trab wurde nur im Übergang zum Galopp benutzt.
Im Mittelalter (1000–1300) kam es aufgrund der geänderten Kampftechnik und der damit verbundenen Verwendung eines schwereren Pferdeschlages zum Niedergang der klassischen Reitkunst im altgriechischen Sinne. Die durch die Rüstung unbeweglich gewordenen Ritter wurden in hochgezogenen Stechsätteln im Spaltsitz gestreckt auf die Pferde gehoben und hatten nur über sehr lange Kandaren und scharfe Sporen die Möglichkeit, auf das Pferd einzuwirken. Das Lanzenstechen, das als Vorbereitung zum Kampf turniermäßig von den Adeligen betrieben worden war, verlangte nur ein geradeaus gehendes, nicht schreckhaftes Pferd, das unter Einsatz seiner Körperkraft den Gegner aus dem Sattel zu heben vermochte. An eine dressurmäßige Durchgymnastizierung wurde im Mittelalter nicht gedacht, da das Pferd als erhöhtes Podest zu Kampfe galt, dem wenig Leidensfähigkeit zugestanden wurde. Dieser Reitstil wurde auch als „a la brida“ bezeichnet und später in den Kreuzzügen durch den der Mauren ersetzt, die sich mit kürzeren Steigbügeln auf ihren kurzen und wendigen Pferden mittels Pfeil und Bogen besser verteidigen konnten. Dieser Reitstil, der als „a la gineta“ bezeichnet wird, beschreibt auch den Umstand der damals verwendeten Pferdetypen (Berber, Araber), welche auch als Genetten bezeichnet wurden.
In der Renaissance war der Begründer der neapolitanischen Reitakademie (1532), Frederigo Grisone, im 16. Jahrhundert der Erste, der 2000 Jahre nach Xenophon das zweite Grundlagenwerk über die Reitkunst mit dem Titel „Ordini di cavalcare“ verfasste. Hierin werden der Umgang mit dem Pferd, die Zäumung und die Ausbildung detailliert dargestellt. Grisone war es auch, der als Erster Fachausdrücke wie z.B. Volte und Kapriole einführte, um so eine Vereinheitlichung der Reitersprache zu schaffen, und er beschrieb die Hilfengebung genauer.
Der Grundgedanke dieser Reitakademie war die Ausbildung von Pferden für den Krieg und Grisone setzte Lektionen der Hohen Schule zur Verteidigung ein. Er übernahm im Großen und Ganzen die Ideen Xenophons und ergänzte sie beispielsweise durch die Einführung des Steigbügels, wodurch sich der Sitz des Reiters maßgeblich verändert hatte. Durch die stark gepolsterten Stechsättel musste der Reiter eine sehr gerade, fast stehende Position im Sattel einnehmen. Er erwähnte aber, dass ein Mitgehen mit der Pferdebewegung unumgänglich ist, um das Pferd nicht zu stören. Grisone nutzte auch den Trab als Arbeitsgangart, um die Hinterhand zu kräftigen und so mehr Hankenbeugung und dadurch verbundene Versammlung zu erreichen, was als modern anzusehen war.
Leider interpretierte er das Verhalten des Pferdes falsch und versuchte, Widerstände und Unverständnis in der Unterwerfung und Bestrafung des Pferdes zu korrigieren. Er ging davon aus, dass Strafen einen positiven Effekt auf die Ausbildung hätten und das Pferd vor dem Reiter mehr Furcht haben müsse als vor allem anderen, um so bedingungslos zu gehorchen.
Die Schaffung der „italienischen Gewaltschule“ beeinflusste auch in den Jahren 1625–1729 durch den deutschen Reitmeister Löhneysen die Deutsche Reiterei, der ebenfalls ein sehr umfangreiches Grundlagenwerk über die Reitkunst dieser Zeit verfasste. Löhneysen widmete sich sehr der Zäumungsfrage und beschrieb mehrere hunderte Gebissvarianten in seinem Buch „Della Cavalleria“. Er begann die Ausbildung des jungen Pferdes erst mit 5 Jahren und erkannte folgerichtig, dass die Bearbeitung und Aktivierung der Hinterhand für die dressurmäßige Arbeit unerlässlich ist. Ebenso erkannte er, dass der äußere Schenkel zur Erhaltung der Biegung auf der Volte notwendig ist, um ein Ausfallen der Hinterhand zu vermeiden. Obwohl Löhneysen ebenfalls ein Verfechter der Gewaltschule Grisones war, erkannte er, dass auch dem Lob Bedeutung in der Pferdeausbildung beigemessen werden sollte, räumte diesem aber im Vergleich zu Strafe nur geringe Bedeutung ein. Er propagierte den Spaltsitz und unterstrich die Wichtigkeit einer weichen Hand, die angesichts der stark zwingenden Kandarengebisse mehr als notwendig war.
Pignatelli als Schüler Grisones entschärfte das System seines Lehrers und brachte im 17. Jahrhundert zwei wichtige Reitmeister hervor: Pluvinel (1601–1643) und Salomon de la Broue (1553–1610). Letzterer machte durch die Intensivierung und besonders grausame Unterwerfung des Pferdes von sich reden und soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Wesentlich wichtiger und moderner war die Weiterentwicklung des Reitsystems Pluvinels, der erkannt hatte, dass das Pferd Freude an der Arbeit haben muss und dass Anmut und Vollendung niemals durch Zwang erreicht werden können. Für ihn stand auch der Gehorsam im Mittelpunkt, jedoch nahm er als Erster auf konstitutions- und temperamentbedingte Probleme im Zuge der Ausbildung Rücksicht. Er räumte dem Lob sehr große Bedeutung ein und meinte, dass eine Strafe sofort und dosiert dem Widerstand folgen müsse, um so dem Pferd verständlich zu bleiben. Pluvinel stellte in seinem Werk auch den wirklich „guten“ dem lediglich „gut sitzenden“ Reiter gegenüber, was durchweg als modern anzusehen wäre.
Pluvinel gilt als Erfinder der Pilaren, er sah die Lektionen der Hohen Schule als kultivierte natürliche Bewegungsformen des Pferdes. Interessanterweise schrieb er den Spaltsitz vor und bezeichnete den modernen „Dreipunktsitz“ als fehlerhaft.
Zur selben Zeit entwickelte sich in England die Schule des Herzogs von Newcastle, der als Erfinder des „Kopf in die Volta“, das als Vorläufer zum Schulterherein gesehen werden kann, und des Schlaufzügels und Kappzaumes gilt. Er lehnte prinzipiell Pluvinels Pilarenarbeit ab und erkannte den Wert einer beweglichen Hüfte und der Schwerpunktverlagerung nach hinten, um ein Pferd versammelbar zu machen. Allerdings meinte er, um dieses Ziel erreichen zu können, zuerst mit der Bearbeitung des Halses anfangen zu müssen, wodurch all seine Pferde überstellt und mittels Schlaufzügel geritten wurden. Er bezeichnete das Reiten am Innenzügel als „Quintessenz der Reiterei“, was gegen jedwede moderne Lehrmeinung spricht. Obwohl er sich, durch diese Annahme irrend, scheinbar auf einem Seitenweg der Reitkunst bewegte, erkannte er sehr wohl, dass bei einem Pferd, um versammelt gehen zu können, die Hinterbeine eng aneinander vorbeitreten müssen.
1733 erschien das heute noch Gültigkeit besitzende Werk F. R. de la Guerinieres, „Ecole de Cavalerie“. Die Dressurauffassung des großen Meisters beruhte in erster Linie auf wissenschaftlichen, biomechanischen Erkenntnissen, wodurch das Pferd durch die systematische Arbeit ruhig, wendig und gehorsam zu machen und für den Reiter angenehm zu reiten sei. Er beschrieb als Erster detailliert Piaffe und Passage sowie den Galoppwechsel und den Kontergalopp. Des Weiteren modifizierte er das „Kopf in die Volta“ auf gerader Linie, um das uns heute als Schlüssellektion der Reitkunst bekannte Schulterherein zu erfinden. Dadurch konnten die Hanken tätig gemacht und das Pferd gelöst werden. Ebenso meinte er, dass das Pferd in der Pirouette mit den Hinterbeinen springen und sich nicht nur mit der Vorhand um die Hinterhand werfen solle. Interessanterweise betrachtete er den Dreitakt im Galopp als fehlerhaft und verwendete einen vierschlägigen Schulgalopp oder Redopp. Er war der Erste, der für einen Weg vom Leichten zum Schweren warb und den modernen Dreipunktsitz durch Modifizierung der hohen französischen Sättel in Flachsättel einführte. Als allgemeine Ausbildungsmaximen galten für ihn Losgelassenheit, Durchlässigkeit, Gehorsam und Versammlung, was weitgehend der heute gültigen Skala der Ausbildung entspricht. Außerdem verwendete er als Erster die Trense in der Grundausbildung, propagierte stets die Dominanz der Schenkel vor der weichen Hand und beschrieb die Wirkung und Wichtigkeit des äußeren Zügels in der versammelnden Arbeit. Seine Lehren werden noch heute als Grundlage der modernen Dressurreiterei herangezogen und dienen der Spanischen Hofreitschule zu Wien als Basis ihres Wirkens.
Im 19. Jahrhundert kam es aufgrund der starken militärischen Beeinflussung der Reiterei und der Einführung des englischen Vollblutes zu einer kompletten Erneuerung der althergebrachten Reitsysteme. Durch die Schnelligkeit, das Rechteckformat der Pferde sowie das Einfühlungsvermögen fordernde Ausbildungssystem konnten die klassischen Grundsätze im Zuge einer vereinheitlichten Militärausbildung nicht mehr in vollem Umfange zum Einsatz kommen. Oberste Maxime war es, in möglichst kurzer Zeit feldtaugliche Rekruten und Kavalleriepferde zu produzieren, deren Überleben im Feld den künstlerischen Aspekt außer Acht ließ.
Der Deutsche Seidler erfand das Hannoversche Reithalfter, propagierte das Geländetraining für Remonten und erwähnte das erste Mal in der Reitliteratur den Begriff Gymnastik des Pferdes. Irrigerweise versuchte er, durch isolierte Bearbeitung des Halses unter Verwendung spezieller Hilfseinrichtungen, wie z.B. des Spanischen Reiters, den lebenden Reiter zu ersetzen, um so die Ausbildung zu beschleunigen und das Pferd schneller in ein Gebrauchsgleichgewicht zu bringen. Dankenswerterweise sah Seidler in der Schenkelhilfe „die Seele der Reiterei“, wodurch der durch Steinbrecht später geprägte Spruch „Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade“ wieder untermauert werden kann.
In Frankreich lebte von 1796–1873 das leider immer wieder falsch verstandene und missinterpretierte Genie F. Baucher. Aufgrund seines besonderen reiterlichen Feingefühls und Einfühlungsvermögen war es Baucher möglich, neu erfundene Lektionen wie Einserwechsel, Galopp rückwärts etc. zu reiten. Offensichtlich war es ihm nicht vergönnt, diese Gabe auch für den weniger Begnadeten in seinen Büchern niederzuschreiben, wodurch immer wieder der Eindruck der totalen Mechanisierung des Pferdes entstanden ist. Baucher versuchte, das für die Reitkunst notwendige Gleichgewicht zuerst im Stehen durch Biegeübungen an der Hand zu erreichen, um danach das Pferd unter dem Sattel besser beherrschen zu können. Weiterhin entdeckte er das Kiefergelenk und das Genick als Schlüssel zur Hinterhand, was heute im Hinblick auf die Skala der Ausbildung konträr betrachtet werden muss. Trotzdem hatte er Recht, dass das Kiefergelenk frei beweglich bleiben muss, um so Leichtigkeit herzustellen und Einfluss auf das Pferd nehmen zu können, ohne dass es sich verspannt. Denn nur ein zufrieden abkauendes Pferd ist auch in der Lage, das Genick zu entspannen und herzugeben. Baucher hatte auch Recht, wenn er meinte, zuerst sämtliche Spannungen im Pferd beseitigen zu müssen, bevor es geritten werden kann, um so Widerstände zu vermeiden. Dies wäre der erste veterinärosteopathische Ansatz zur Behebung von Wirbelblockaden durch Mobilisationen an der Hand. Die Behauptung, dass Widerstände durch organische Ursachen bzw. Verspannungen erzeugt werden können, ist bis heute noch brauchbar und durchweg hochmodern.
James Fillis (1834–1913) kritisierte das System Bauchers aufgrund seiner statischen Bearbeitung des Pferdes und reformierte das Bauchersche System durch den für die Reitkunst so notwendigen Schwung, den er durch forsches Vorwärtsreiten erreichen wollte. Genauso wie Baucher erfand er viele künstliche Gänge, z.B. den Galopp auf drei Beinen, den Galopp rückwärts, was ihm vonseiten der klassischen Reiterei deutschen Ursprungs wenige Meriten einbrachte. Fillis erweiterte das Ausbildungssystem um das Geländereiten und Springen und versuchte, dass seine Pferde durch aktive Aufrichtung in jeder Gangart immer das Genick als höchsten Punkt tragen – dies auch in den verstärkten Gangarten, wo es eigentlich zu einer Ausfüllung des Rechteckrahmens kommen sollte. Dennoch beeinflusst die Reiterei Fillis bis in die heutige Zeit die Reitwelt und auch die heutige russische Dressurreiterei, da er lange Zeit als Chefreitlehrer beim Zaren tätig war.
Als letzter wichtiger großer Reitmeister des 19. Jahrhunderts wäre Gustav Steinbrecht (1808–1885) zu nennen, der heute als der Klassiker der modernen Dressurreiterei gilt. In seinem Werk „Gymnasium des Pferdes“ beschreibt Steinbrecht unter der Leitidee, sein Pferd vorwärts und gerade gerichtet zu reiten, seine Maximen in der Pferdeausbildung. Ein kontrollierter Vorwärtsimpuls, der nicht mit eiligem Laufen verwechselt werden darf, muss auch in den versammelten und rückwärts angelegten Gangarten stets vorhanden sein. Des Weiteren beinhaltet das Geraderichten die durch Längsbiegung erfasste Hinterhand, die durch deren Schub zuerst in Trag- und dann in Federkraft ihre Aktivität transformiert. Damit wäre in einem Satz die Skala der Ausbildung als Grundlage jeder sinnvollen Gymnastizierung erklärt. Er erkannte auch richtig, dass alle Bewegung von der Hinterhand ausgehen müsse und sämtliche Bemühungen, die das Pferd im Stand gymnastizieren oder ins Gleichgewicht bringen sollen, fehlschlagen müssen, da die Reitkunst ein dynamischer Prozess ist. Als solcher ist auch das Pferd in der Bewegung von Spannungen zu befreien. Steinbrecht betonte immer wieder die Notwendigkeit des „Schultervor“, um sich so die Hinterhand, namentlich das innere Hinterbein, dienstbar zu machen.
Im 20. Jahrhundert führte der Italiener Federico Caprilli den heute noch modernen Springsitz ein, um das Pferd so über dem Sprung im Rücken zu entlasten.
In Zusammenarbeit mit der Kavallerieschule Hannover wurde im Jahre 1912 unter Berücksichtigung der deutschen Dressurarbeit und der italienischen Springarbeit die HDV 12 (Heeresdienstvorschrift 12) unter v. Heydebreck, Redwitz, Bürker und Lauffer entwickelt, die verbindliche Ausbildungsrichtlinien für Pferd und Reiter in der Kavallerieschule darstellte. Sinn dieser Richtlinien war es, die Brauchbarmachung von Remonten im Hinblick auf die lange Gesunderhaltung des Pferdes für den Reitdienst zu gewährleisten. Diese Ausbildungsnormen sind bis heute in Form der Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in der Skala der Ausbildung enthalten und stellen somit die Grundlage eines systematischen Trainings von der Remonte bis zum Grand-Prix-Pferd dar.
2 Glossar der Reitkunst
In diesem Kapitel werden kurz allgemeine Termini sowohl aus der Reitkunst wie auch der Hippologie abgehandelt. Wie die Tiermedizin hat auch die Hippologie ihre eigene Sprache und sprachlichen Bilder. Um Kommunikationsschwierigkeiten zu vermeiden, ist es angezeigt, sich auch als nicht reitender Tierarzt mit den Fachbegriffen der Reiterei auseinander zu setzen, da sich so aus therapeutischer Sicht neue Dimensionen und Möglichkeiten erschließen können.
A
Abkauen Speichelbildung im Maul, resultierend aus einer losgelassenen Kautätigkeit eines in korrekter Anlehnung und an den Hilfen stehenden Pferdes (▶Abb. 2.1).
▶Abb. 2.1 Das Abkauen ist eines der Zeichen für die Losgelassenheit und Entspannung der Mandibula des Pferdes. Man beachte die durchgehende imaginäre Linie ausgehend vom Unterarm bis zum Gebiss
Abreiten Aufwärmphase vor dem eigentlichen Arbeiten.
Abschnauben Befreiendes Abprusten, hervorgerufen durch entspanntes losgelassenes Treten, wodurch das Zwerchfell ohne Spannungen – bei gleichzeitiger Tendenz des Vorwärts-Abwärts-Dehnenwollens des Halses – mit der Bewegung mitschwingen kann.
Abstellung Grad der Schrägstellung vom Hufschlag, wobei das Pferd aber keinerlei Längsbiegung aufzuweisen hat (Schenkelweichen); nicht mit Biegung oder Stellung zu verwechseln.
Abstoßen Zustand, bei dem sich das Pferd durch den Vorwärtsimpuls der Hinterhand in der durchhaltenden Reiterhand in das Gebiss dehnen möchte.
Abwenden Richtungswechsel in der Bahn ins Bahninnere von einer Hand (Seite) auf die andere.
Aktion Bezeichnung für den Grad des Vortritts. Hohe Aktionen der Vorderbeine ergeben sich durch einen kurzen Unterarm und eine lange Röhre. In umgekehrtem Verhältnis zeigt das Pferd eine flache Aktion der Vordergliedmaße. Der Raumgriff kann durch einen langen Oberarm mit schräger Schulter groß sein, wohingegen eine steilere Schulter raumgrifflimitierend wirkt.
Am Zügel Korrekte Position des Pferdekopfes, bei der das Genick der höchste Punkt und die Stirnnasenlinie leicht vor der Senkrechten ist und das Pferd sich in einer leichten, weichen Verbindung zur Reiterhand befindet.
Anfassen Mit den Kreuz- und Schenkelhilfen energisch auf das Pferd einwirken.
Anlehnung Leichte, gleichmäßige, aber dennoch flexible Verbindung des Pferdemauls zur Reiterhand. 3. Stufe der Skala der Ausbildung, die sich progressiv aus Takt (1. Stufe) und Losgelassenheit (2. Stufe) entwickelt.
Anlongieren Erster Kontakt der Remonte mit der täglichen Arbeit an der Longe.
Anreiten Einreiten eines noch ungerittenen Pferdes (Remonte). Übergang von einer Gangart in die nächste.
Arrét Kräftiger, plötzlicher und daher im Maul sehr schmerzhafter Zügelruck.
Auf der Hinterhand Ziel der systematischen Ausbildung, die durch die Anatomie tendenziell überlastete Vorhand durch Verschiebung des Schwerpunktes nach hinten zu entlasten, um so mehr Gewicht auf die Hinterbeine zu bekommen. Die Pferde werden leichter manövrierbar und beginnen sich zu versammeln, wodurch eine größere Aktion der Schulterfreiheit erreicht wird und das Pferd insgesamt eine „Bergauf-Tendenz“ bekommt.
Auf der Vorhand/Hand Tendenz des Pferdes, sich der Lastenaufnahme auf das Hinterbein zu entziehen und sich so auf die Hand des Reiters zu stützen. Pferd zeigt „Bergab-Tendenz“, läuft hinter seinem Schwerpunkt her und ist schwerer zu manövrieren.
Aufnehmen Verkürzen der Gangart, um das Pferd mehr auf die Hinterhand zu setzen; Kürzerfassen der Zügel.
Aufrichtung Kopf-Hals-Haltung mit einem schönen Viertelkreisbogen nach oben, resultierend aus einer systematisch gymnastizierten und daher tragfähigen Hinterhand. Diese Form der Aufrichtung bezeichnet man als relative Aufrichtung. In dieser sollte das Pferd stets bestrebt sein, durch eine Dehnungshaltung vorwärts-abwärts die Anlehnung in die Reiterhand zu suchen. Die aktive, also durch aktive Einwirkung der Reiterhand bedingte absolute Aufrichtung blockiert das Pferd im Rücken, da diese Form der Aufrichtung nicht durch das Durchlaufen einer systematischen Gymnastizierung erreicht worden ist. Hierbei kann man oft den Eindruck gewinnen, als wäre der Hals S-förmig nach unten vorgewölbt, was das Resultat fehlender Rückentätigkeit ist (Auktionspferde).
Aufsatzzügel Hilfszügel, der in Kombination mit dem Ausbinder ein Auftauchen des Kopfes von unten verhindern soll, da der Zügel vom Longiergurt über eine Genickumlenkrolle von oben in die Trense eingeschnallt wird. Verhindert gänzlich ein Aufwölben der Oberlinie.
Ausbinder Hilfszügel, der seitlich in die Trense eingeschnallt wird, um dem Pferd eine Beizäumung zu geben; Longierhilfszügel.
Aussitzen Sitzen bleiben im Sattel während des Trabes oder Galopps. Gegenteil zum leichten Sitz im Galopp, wo der Reiter das Gesäß aus dem Sattel hebt, um so den Rücken zu entlasten. Beim Leichttraben wird nur jeder zweite Trabtakt ausgesessen, um so den Rücken des Pferdes zu entlasten.
B
Bahn Abgeschlossener, meist rechteckiger Raum in den Maßen 20×40 oder 20×60 m, um Pferde reiterlich zu fördern. Rennbahn und Ovalbahn (Isländer) besitzen zwischen den geraden Strecken statt Ecken ovale Verbindungselemente, um so den Rennlauf nicht zu beeinträchtigen.
Ballotade Schulsprung der klassischen Reitkunst, in dem das Pferd mit allen Vieren in die Luft springt und die Hinterhand unter dem Bauch eingezogen wird und nicht wie bei der Kapriole nach hinten ausschlägt.
Barren Unlautere Mittel, Pferden Leistungen abzuverlangen, zu denen sie konstitutionsmäßig oder ausbildungsbedingt nicht in der Lage sein können.
Bascule Fähigkeit des Pferdes, sich über dem Sprung im Rücken rund zu machen, was zu einer verbesserten Springtechnik führt.
Beizäumung Direktes Nachgeben im Genick des Pferdes, sodass die Stirnnasenlinie knapp vor die Senkrechte kommt und das Genick den höchsten Punkt darstellt. Beizäumung sollte aus einer ordentlich entwickelten Anlehnung resultieren. Beizäumung ist jedoch nicht mit Versammlung zu verwechseln.
Biegung Auch Längsbiegung; möglichst gleichmäßige und durchgehende Seitwärtswölbung der Wirbelsäule, beginnend von Atlas bis hin zur Schweifrübe. Hat den Sinn, das Pferd gerade zu richten und das innere Hinterbein zum Tragen zu bringen, wodurch das Pferd besser kontrollierbar wird. Die in den Reitlehren immer geforderte „Rippenbiegung“ ist aus anatomischen Gründen nicht möglich, da die Zwischenrippenräume und die Rippenbreite im Verein mit dem relativ unflexiblen Thorax dieses fast unmöglich machen.
Blecken Zungenstrecken aufgrund fehlerhafter Handeinwirkung des Reiters, wegen Zahnproblemen oder wegen eines unpassenden Gebisses.
Bretthals Gebäudemangel aufgrund eines sehr unterbemuskelten und deshalb sehr flachen Halses, meisten noch vergesellschaftet mit schwerem Genick und unzureichender Länge; Beizäumungsschwierigkeiten sind meistens vorprogrammiert.
Bügeln Bewegungsanomalie in der Hebephase der Vordergliedmaße, bei der die Röhre eine stark seitlich ausgedrehte, pendelnde Bewegung vollführt, welche zu verfrühten Verschleißerscheinungen im Karpalgelenk führen kann. Häufig zu sehen bei Gangpferden (Paso Fino) und Iberern der alten Zuchtrichtungen.
C
Capriole Auch Kapriole; Schulsprung der klassischen Reitkunst, der aus der Piaffe und dem Terre a terre entwickelt wurde. Das Pferd springt mit allen Vieren in die Luft und streicht (schlägt aus) dann in der Luft verharrend.
Cavaletti Auch Bodenrick; vielseitig höhenverstellbare Bodenstangen mit seitlichen Kreuzen, damit sich die Pferde im Falle des Drauftretens nicht verletzen können. Gut geeignet zur Rücken- und Bauchgymnastik, zum Springtraining und zur Gewöhnung an das Springen bei verdorbenen Pferden.
Chambon Hilfszügel, der über Genickumlenkrolle zur Trense führt und zwischen den Vorderbeinen am Gurt befestigt wird. Nimmt das Pferd den Kopf zu hoch, so wird so lange Druck auf die Maulwinkel und auf das Genick ausgeübt, bis es sich in die Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung begibt.
Changement Wechsel der Fußfolge im Galopp. Fliegender Wechsel im Galopp.
Checkgebiss Overcheck; dünnes Gebiss, das den Trabern zum Trensengebiss am Gaumen eingeschnallt wird, damit sie den Kopf unphysiologisch hoch tragen, um so ein Einspringen in den Galopp zu verhindern.
Chukker Spieleinheit eines Polospiels.
Courbette Schulsprung der klassischen Reitkunst, bei dem sich das Pferd auf die Hinterhand erhebt und mehrere Sprünge auf dieser nach vorne ausführt, ohne dabei die Vorderbeine am Boden aufzusetzen (▶Abb. 2.2).
▶Abb. 2.2 Courbette
D
Damensitz Seitsitz der Dame im Damensattel. Die Reiterin hat in dieser Position nur ein Bein zur Hilfengebung zu Verfügung und auf der anderen Seite den Reitstock.
Dreitakt Gangart eines gleichmäßig und rein galoppierenden Pferdes.
Dressur Systematische und zielgerichtete Ausbildung des Pferdes mit dem Ziel, seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu verbessern und das durch das Reitergewicht beeinträchtigte Gleichgewicht des Pferdes wiederherzustellen, wodurch das Pferd wendiger und durch den verminderten Verschleiß in der Ausbildung lang nutzbar erhalten werden soll.
Durchgehen Unkontrolliertes und unregelbares Davonstürmen des Pferdes aufgrund einer Panikreaktion.
Durchlässigkeit Erlernte Fähigkeit des Pferdes, auf feinste Hilfen des Reiters sofort zu reagieren und diese umzusetzen (durchzulassen), um so den Wünschen des Reiters ohne Zeitverzögerung Folge zu leisten. Diese Fähigkeit der Reaktionsbereitschaft ist nur durch einen systematischen Trainingsaufbau im Sinne der Skala der Ausbildung realisierbar und niemals durch den Einsatz von scharfen, zwingenden Hilfsmitteln.
Durchparieren Verringern der Gangart bis hin zum Halt.
F
Falscher Knick Fehlerhafte Kopfhaltung des Pferdes aufgrund zu starker Handeinwirkung oder zu starker Halsung (Hengsthals, Barockpferde), bei der nicht das Genick, sondern der 3. Halswirbel den höchste Punkt darstellt (▶Abb. 2.3). Meist vergesellschaftet mit einer sich hinter der Senkrechten befindlichen Nase, wodurch Paraden das Hinterbein nicht erreichen und so gravierende Mängel in der Durchlässigkeit festgestellt werden können.
Fangen der Kandare Untugend, bei der das Pferd mit den Lippen die Anzüge der Kandare fängt und so unwirksam macht. Durch das Einschnallen eines kleinen Lederriemens, welcher vom Unterbaum (Scherriemenloch) durch den freien Ring der Kinnkette geführt wird, kann dieser Mangel behoben werden. Ebenso verhindern S-förmige Anzüge diese Unart.
Fleißig Pferd mit gutem Vorwärtsdrang und Arbeitseifer.
▶Abb. 2.3 Beim falschen Knick stellt nicht das Genick, sondern der 3. Halswirbel den höchsten Punkt dar. Gerade bei Hengsten der Barockpferderassen kann aufgrund der starken Halsung ein falscher Knick trotz korrekter Ausbildung oftmals nicht vermieden werden. Dennoch muss zwischen einem falschen Knick mit ungenügend engagierter Hinterhand, resultierend aus einer durch zu starke Handeinwirkung erzwungenen Beizäumung, und einem untätigen Rücken unterschieden werden
G
Gamasche Beinschoner aus Leder oder Kunststoff, die auch auf die Sehnen und den Fesselkopf einen stützenden Effekt ausüben können.
Ganaschenzwang Beizäumungsschwierigkeiten durch zu wenig Platz für die Ohrspeicheldrüse, da der Abstand zwischen ventralem Atlasflügel und kaudalem Ganaschenrand zu schmal ist, wodurch die Parotis bei jedem Beizäumungsversuch schmerzhaft gequetscht wird.
Gebiss Mundstück, das ins Maul gelegt wird, um das Pferd beherrschen zu können. Man unterscheidet zwischen Trensengebissen, Kandarengebissen und Pelhamgebissen.
Gebrauchshaltung Haltung, die eine Remonte einnimmt, um sich zwanglos, taktrein und losgelassen bei guter Anlehnung in weiterem Rahmen vorwärts zu bewegen. Pferd erscheint rechteckiger, da die Oberlinie gedehnt wird und die Aufrichtung relativ ist und nicht forciert wird.
Gebrauchstempo Arbeitstempo oder Grundtempo, in dem das Pferd taktrein, losgelassen und schwungvoll treten soll. Daraus können sich versammelte und verstärkte Gangarten entwickeln.
Gegen den Zügel Abwehrreaktion des Pferdes auf zu grobe Handeinwirkung. Das Pferd versucht, dem Reiter durch Gegenziehen die Zügel aus der Hand zu ziehen und so der Anlehnung auszuweichen.
Geraderichten 5. Stufe der Skala der Ausbildung, die aufgrund des gymnastizierenden Trainings die natürliche Schiefe des Pferdes korrigiert. Grundvoraussetzung ist ein Pferd, das sich taktmäßig, losgelassen, in Anlehnung, schwungvoll vorwärts bewegt. Durch vermehrtes Stellen und Schultervor wird die Schulter auf das Becken ausgerichtet, sodass das innere Hinterbein zu einer vermehrten Beugung, d. h. Lastaufnahme, motiviert wird. Dadurch dehnt sich das Pferd an den äußeren, begrenzenden Zügel, der das Gangmaß reguliert. Essenziell, um einen Versammlungsgrad zu erreichen, da nur so Schubkraft in Tragkraft umgeformt werden kann und die Schultern in ihrer Beweglichkeit verbessert werden.
H
Hackamore Gebisslose Zäumung, die über Hebelwirkung auf das Nasenbein wirkt. Findet im Western- und Springsport Verwendung. Falsch verschnallt kann es zu starken Atemeinschränkungen kommen.
Halbe Parade Wichtigstes Kommunikationsmittel zwischen Pferd und Reiter. Ein leichter aufmerksamkeitsfördernder Impuls am äußeren Zügel wirkt direkt auf das gleichseitige Hinterbein, wodurch sich Versammlungsbereitschaft bzw. die Hankenbiegung verbessern lässt. Unabdingbar zum Reiten von Tempounterschieden, Übergängen und vorbereitend zur ganzen Parade zum Halt.
Hanken Die großen Gelenke der Hinterhand: Hüftgelenkt, Kniegelenk und Sprunggelenk.
Hankenbiegung Grundlage der Versammlung. Durch Verringern der Winkel zwischen den großen Gelenken und einer verlängerten Stützbeinphase erscheint das Pferd hinten tiefer und federnder im Gang, wodurch die Aktion der Vorhand freier und ungezwungener wird (▶Abb. 5.19).
Hilfen Möglichkeiten der Einfluss- bzw. Kontaktaufnahme des Reiters mit dem Pferd: Stimmhilfen, Gewichtshilfen (Kreuz), Schenkelhilfen, Zügelhilfen. Sollen sparsam, aber so wirksam wie möglich gegeben werden und können nur dann wirklich effizient sein, wenn sie aus einem unabhängigen Sitz des Reiters kommen. Dieser muss in der Lage sein, seine Hilfen unabhängig voneinander und kontrolliert auf das Pferd wirken lassen zu können.
Hinter dem Zügel Fehlerhafte Kopfhaltung des Pferdes aufgrund zu starker Handeinwirkung, bei der das Pferd in den Ganaschen zu eng wird und mit der Stirnnasenlinie hinter die Senkrechte kommt, wodurch Paraden nicht das Hinterbein erreichen können und sich das Pferd so den reiterlichen Einwirkungen entzieht.
Hinterhandwendung Taktmäßige Drehung des Pferdes um die Hinterhand, die aus dem Halten eingeleitet wird. Die Hinterhand muss dabei, aktiv bleibend, einen kleinstmöglichen Kreis beschreiben, während die Vorhand des Pferdes einen größeren Kreis, in Bewegungsrichtung gestellt, beschreiben soll. Hat versammelnden Effekt, da das Pferd die Hanken beugen muss.
Hippologie Lehre vom Pferd (griech).
Hirschhals Fehlerhafte Halsform, die aufgrund mangelnder Rückengymnastizierung zu einer starken Entwicklung des M. brachiocephalicus (Unterhals) führt und so Beizäumung und Einwirkung auf das Pferd stark erschwert. Meistens eine angerittene Problemzone, verursacht durch zu starke Handeinwirkung, der sich das Pferd durch Gegenwehr zu widersetzen versucht.
Hohe Schule Höchste Stufe der Reitkunst, die von Reiter und Pferd eine vollkommene Übereinstimmung verlangt, um so in den Lektionen miteinander eins zu werden. Zu den Lektionen der Hohen Schule zählen Piaffe, Passage, Spanischer Schritt, Pirouetten, Changements und die Schulen über der Erde wie Levade, Pesade, Courbette und Capriole. Diese Form der Reitkunst wird noch an der Spanischen Hofreitschule in Wien und an der Königlich Andalusischen Hofreitschule in Jerez de la Frontera praktiziert.
K
Kadenz Verlängerung der Beuge- bzw. Schwebephase, wodurch das Pferd erhabener und ganggewaltiger erscheint. In der Passage zeigt das Pferd die größte Kadenz.
Kaliber Verhältnis von Gewicht zu Widerristhöhe beim Pferd.
Kandare Hebelgebiss mit Stangenmundstück, das über eine Kinnkette Druck auf Genick, Laden, Zunge, Gaumendach und Kinnkettengrube ausübt. In Dressurprüfung ab Klasse L vorgeschrieben zur verfeinerten Einwirkung auf das Pferd. Wird blank (2 Zügel) oder mit Unterlegtrense (4 Zügel) verwendet.
Kappzaum Zaum mit Naseneisen und drei Ringen zum Longieren und Anreiten von Pferden (▶Abb. 9.1). Durch den Druck auf den Nasenrücken wird das Pferd veranlasst, im Genick nachzugeben, und so das empfindliche Maul geschont und sensibel erhalten.
Klassisch Harmonisch, in sich vollkommen, geschlossen.
Kleben Untugend des Pferdes, bei der es der Herdentrieb unmöglich macht, das Pferd von der Gruppe zu entfernen und wegzureiten. Das Pferd kann sich durch Steigen, Bocken und Hakenschlagen dieser Situation zu entziehen versuchen.
Klettern Geländetraining am Berg zur Kräftigung der Hinterhand sowie zur Verbesserung der Koordination und Trittsicherheit des Pferdes.
Kurzkehrt Lektion im Schritt, bei der das Pferd aus der Vorwärtsbewegung eine Hinterhandwendung durchführt, ohne dabei den Takt und den Rhythmus des Schrittes zu verlieren.
L
Lade Zahnloser Teil im Pferdemaul (Diastema), in dem das Mundstück aufliegt.
Lancade Das Pferd begibt sich in Pesadenstellung und führt nur einen Courbettensprung aus.
Leichttraben Gegenteil von Aussitzen. Nur bei jedem zweiten Trabtempo wird ausgesessen, wodurch der Rücken des Pferdes entlastet wird (▶Abb. 2.4).
Lektion Einzelübung in der Dressur.
Levade Schulsprung der klassischen Dressur, bei dem sich das Pferd aus der Piaffe derart setzt, dass es die Vorhand erhebt und in einem Winkel von weniger als 40 Grad in den Sprunggelenken kurzfristig in dieser Position verharrt (▶Abb. 2.5). Ist die Winkelung größer, d. h. steiler, spricht man von Pesade.
▶Abb. 2.4 Leichttraben
Longe Leine von 8–12 m Länge zum Bewegen des Pferdes im Kreis um den Ausbilder.
Longieren Bewegen des Pferdes an der Longe im Kreis um den Ausbilder zur Erlangung von Takt, Losgelassenheit, Anlehnung und Schwung.
Longiergurt Assessoire zur Arbeit an der Longe mit vielen Ringen, um dort Hilfszügel einschnallen zu können oder das Pferd an den Sattel zu gewöhnen.
▶Abb. 2.5 Levade
Lösen Vorgang während der Aufwärmphase, in dem sich das Pferd aufgrund taktmäßig losgelassener Tritte unter dem Reiter entspannt und in Form der Anlehnung seinen Weg mit dem Hals vorwärtsabwärts in die Tiefe sucht, um so die Oberlinie aufzuwölben und den Rücken tätig zu machen.
Losgelassenheit 2. Stufe der Skala der Ausbildung und Grundvoraussetzung jeglicher sinnvoller Trainingsarbeit mit dem Pferd. Aus der dem Pferd schon angeborenen inneren Zwanglosigkeit, welche die Grundlage einer angerittenen körperlichen Losgelassenheit darstellt, kann sich über das Finden des dem Pferd eigenen Taktes selbige einstellen. Ein losgelassenes Pferd bewegt sich zufrieden, freudig, taktmäßig und schwungvoll vorwärts und wird stets bemüht sein, seinen Weg in die Tiefe nach vorwärts-abwärts suchen zu wollen. Bei solchen Pferden kann man rhythmisches Schnauben im Galopp oder ein gleichmäßiges Muskelspiel in der Lendenpartie beobachten. Losgelassene Pferde wirken niemals gestresst oder angespannt und vermitteln einen zufriedenen und motivierten Eindruck. Schlauchgeräusche bei männlichen Pferden oder eingeklemmte bzw. schiefe Schweife sind stets ein Signal mangelnder oder fehlender Losgelassenheit, wodurch jegliche weitere Lektionen in ihrer Ausführung sinnlos werden, da die Grundlage nicht gefestigt worden ist.
M
Martingal Reithilfszügel mit zwei Ringen, durch die die Zügel geführt werden, damit ein Kopfschlagen des Pferdes unterbunden wird. Findet Einsatz im Springsport.
Mezair Schulsprung der klassischen Reitkunst. Levade mit Raumgewinn. Nach jeder Erhebung der Vorhand wird diese wieder aufgesetzt und mit einem kleinen Sprung vorwärts erhebt sich das Pferd erneut zu einer Levade.
N
Natürliche Schiefe Angeborene Einseitigkeit des Pferdes aufgrund der Lage im Mutterleib und der torpedoartigen Form des Rumpfes. Pferd spurt mit der Hinterhand seitlich versetzt neben den Trittsiegeln der Vorderhufe.
P
Parade Kommunikationsmittel zwischen Pferd und Reiter in Form von leichten Zügelimpulsen im Verein mit Schenkel und Gewichtshilfen. Halbe und Ganze Parade, wobei letztere zum Halten führt, während erstere Tempounterschiede sowie Gangartenwechsel einleiten soll.
Passage Schwebetrab, der sich klassischerweise aus der Piaffe entwickelt. Die Schwebephase ist derart verlängert, dass sich das Pferd mit hoher Knieaktion und Hankenbiegung kraftvoll von einem Tritt in den nächsten bewegt, ohne dabei viel Raumgewinn zu haben.
Pelham Halbkandare, Gebiss, das die Wirkung von Trense und Kandare in einem vereinen soll. Die Hebelanzüge sind kandarenähnlich und beweglich und besitzen auf Mundstückhöhe einen zusätzlichen Ring für ein zweites Paar Zügel. Gut geeignet für Pferde mit kurzen Maulspalten.
Piaffe Trab auf der Stelle. Höchster Versammlungsgrad im Trab, wodurch das Pferd insgesamt kürzer und in der Kruppe abgesenkt erscheint bei lebhaft aktivem Treten der Hinterbeine, ohne den Trabrhythmus zu verlieren.
Pirouette Drehung des Pferdes im Galopp um die Hinterhand, wobei die Hinterhand einen kleinstmöglichen Kreis bei erhaltener Längsbiegung und ohne Verlust des Galopprhythmus vollführen muss. Das Pferd benötigt zur Ausführung dieser Lektion eine sehr gut gymnastizierte, tragfähige und versammelbare Hinterhand.
R
Reitkunst Eine durch systematische Schulung des Pferdes erreichte möglichst vollkommene reiterliche Harmonie zwischen Mensch und Pferd.
Renvers Seitengang und Konterübung zum Schulterherein. Das Pferd ist in Bewegungsrichtung gestellt und gebogen und bewegt sich auf 4 Hufschlägen abgestellt am Hufschlag seitwärts, wobei der Kopf in die Bahnmitte gerichtet ist.
Rittigkeit Mentale und physische Eigenschaft eines sehr gut und systematisch durchgymnastizierten Pferdes, das aufgrund der verbesserten Koordinationsfähigkeit die Reiterhilfen durchzulassen imstande ist und so dem Reiter ein angenehmes Reitgefühl vermittelt, da das Pferd jederzeit das ausführen kann, was dieser von ihm möchte.
Rollback Lektion aus dem Westernsport. Rasche Wendung um die Hinterhand aus dem Galopp, um einen Richtungswechsel von 180 Grad zu erreiten.
Rückwärtsrichten Diagonale Bewegung des Pferdes nach hinten, um den Gehorsam und die Durchlässigkeit zu prüfen.
S
Schenkelweichen Seitengang, der gänzlich ohne Längsbiegung durchgeführt wird. Soll dem Pferd ohne Erschwernisse den seitwärts treibenden Schenkel begreiflich machen und zählt so zu den Basisseitengängen in der Remontenausbildung.
Schlauchgeräusch Zeichen von Verspannungen und mangelnder Losgelassenheit. Aufgrund einer Verspannung des M. retractor penis kommt es im Präputium zu einer Vakuumbildung, die mit einem rhythmischen Geräusch verbunden ist. Tritt nur bei männlichen Tieren auf.
Schlaufzügel Hilfszügel, der zwischen den Vorderbeinen eingeschnallt wird und über die Trensenringe in die Reiterhand läuft, um dem Pferd eine Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung zu zeigen. Richtet missbräuchlich angewendet großen Schaden an!
Schränken Kreuzen der Beine im Seitengang.
Schulgangarten Höchste Vollendung der Versammlung in allen drei Grundgangarten. Schulschritt, Schultrab und Schulgalopp zeichnen sich durch besonders wenig Raumgewinn, jedoch große Erhabenheit in der Bewegung und stärkste Hankenbiegung aus.
Schulpferd In allen Lektionen der klassischen Reitkunst ausgebildetes Lehrpferd.
Schulterherein Seitengang auf drei Hufschlägen, wobei des Pferd gegen die Bewegungsrichtung gestellt ist und den Kopf in Bahnmitte gerichtet hat. Grundlage für das Geraderichten und für alle versammelnden Übungen, da das innere Hinterbein aktiviert und die äußere Schulter frei wird.
Schweifschlagen Unmutsäußerung gegenüber dem Reiterschenkel und Zeichen mangelnder Losgelassenheit; führt meistens zu Verspannungen im Rücken, da sich das Pferd nicht loslässt.
Schwung Ein durch Takt, Losgelassenheit und Anlehnung kontrollierter Vorwärtsimpuls, der dem Pferd durch Einsatz der treibenden Hilfen mehr Esprit und Ausstrahlung verleiht. Grundlage der Kadenz und Versammlung, darf nicht mit Eilen oder Laufen verwechselt werden.
Skala der Ausbildung Systematisches Regelwerk, basierend auf den anatomischen und psychischen Erfordernissen, um ein Pferd korrekt aufzubauen und auszubilden, ohne es schon während der Ausbildungsphase zu verschleißen. Die 6 Stufen sind konsekutiv und untereinander nicht beliebig austauschbar:
Takt
Losgelassenheit
Anlehnung
Schwung
Geraderichten
Versammlung
Sliding Stop Lektion aus der Westernreiterei, in der das Pferd aus vollem Galopp auf der Hinterhand rutschend zum Stillstand kommt, wobei die Vorderbeine vorn mitlaufend das Rutschen der Hinterbeine unterstützen.
Spanischer Schritt Schrittartige Bewegung, bei der das Pferd seine Vorderbeine abwechselnd horizontal nach vorn ausstreckt, wodurch es bei gleichseitigem Untertreten der Hinterhand erhabener und majestätischer wirken soll (▶Abb. 12.5 a). Verbessert die Schulterfreiheit und Aktion der Vorderbeine.
Spin Lektion aus der Westernreiterei, in der sich das Pferd aus einer trabartigen Bewegung heraus mehrere Male sehr schnell um die Hinterhand dreht.
T
Takt Gleichmäßiger, rhythmischer Bewegungsablauf einer Gangart. 1. Stufe der Skala der Ausbildung. Takt, Losgelassenheit und Anlehnung führen dazu, dass das Pferd in der Lage ist, über die treibenden Hilfen des Reiters Schwung zu entwickeln. Ein taktrein gehendes Pferd muss nicht gleichzeitig schwungvoll gehen (z.B. langsamer oder eiliger Takt).
Taktfehler Unregelmäßigkeiten im Takt, die aufgrund mangelnder oder fehlerhafter reiterlicher Einwirkung zustande kommen und so die Grundgangartqualität negativ beeinflussen.
Tour Zirkel mit verschiedenen Durchmessern (20 m, 10 m, 8 m, 6 m).
Travers Seitengang auf 4 Hufschlägen, in dem das Pferd in Bewegungsrichtung gestellt und gebogen ist, den Kopf gegen die Wand gerichtet hat und sich seitlich bewegt. Aktiviert das äußere Hinterbein und befreit die innere Schulter. Auf der Diagonale fortgesetzt entwickelt sich aus diesem Seitengang die Traversale.
Traversale Seitengang, der sich aus dem auf der Diagonale fortgesetzten Travers heraus entwickelt.
U
Über dem Zügel Anlehnungsfehler, der aufgrund mangelnder Gymnastizierung und grober Reiterhand zustande kommt. Das Pferd trägt seinen Kopf weit vor der gedachten Senkrechten und entzieht sich durch Absenken des Rückens den reiterlichen Einwirkungen.
Übereilt Zu schnelles Tempo in einer Grundgangart, oftmals vergesellschaftet mit erhöhter Trittfrequenz bei verkürzter Trittlänge. Man gewinnt den Eindruck, das Pferd eile dem Schwerpunkt nach vorne nach.
Übertritt Fähigkeit des Pferdes, mit den Hinterhufen über die Trittsiegel der Vorderhufe zu fußen.
V
Verkanten Schiefstellung des Kopfes im Genick durch ungleichmäßige und fehlerhafte Handeinwirkung, wodurch ein Ohr höher als das andere ist.
Versammlung 6. und letzte Stufe der Skala der Ausbildung, die ein vollkommen equilibriertes und durchgymnastiziertes Pferd voraussetzt, um die Lektionen in der größtmöglichen Leichtigkeit durchführen zu können.
Verstärkung Kontrollierte Schwungentfaltung mit Tritt- bzw. Sprungverlängerung, ohne jedoch den Takt der Grundgangart zu verlieren und eiliger zu werden.
Vierschlag Fehlerhafter Galopprhythmus, in dem die zweite diagonale Phase unterbrochen ist und so der Dreitakt zu einem Vierschlagrhythmus wird. Meist hervorgerufen durch zu starke Handeinwirkung und Verspannungen im Rücken des Pferdes.
Volte Kleinster leistbarer Kreis, den ein Pferd in der Lage ist zu beschreiten. Die Barockvolte oder das Karree ist ein kleines Viereck mit abgerundeten Ecken, welche das Versammeln der Hinterbeine stark unterstützen kann.
Vorhandwendung Lösende Übung, in der das Pferd – mit, in oder gegen die Bewegungsrichtung gestellt – mit der Vorhand einen kleinen Kreis beschreibt und mit der Hinterhand um diese wendet. Verbessert die Akzeptanz des seitwärts treibenden Schenkels.
Z
Zähneknirschen Anzeichen von starken Spannungen und mangelnder bzw. fehlender Losgelassenheit.
Zügellahm Taktfehler, der nur beim Reiten auftritt, resultierend aus Spannungen in Rücken, Hals oder Kruppbereich und meist hervorgerufen durch eine zu starke Handeinwirkung aufgrund eines unrhythmisch treibenden Reiters infolge eines mangelnden unabhängigen Sitzes.
Zungenstrecken Untugend, die sich durch zu harte Reiterhand oder falsch angepasstes Gebiss entwickelt, indem das Pferd die Zunge entweder über das Gebiss nimmt oder seitlich heraushängen lässt, um sich so dem schmerzhaften Druck im Maul zu entziehen.
3 Wozu Dressur und Gymnastizierung – Nur „L’ar t pour L’ar t“?
Betrachtet man die Anatomie bzw. die Wirbelsäule des Pferdes, wird klar, dass diese aufgrund ihrer Form großen statischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt wird. Die Wirbelsäule stellt die brückenartige Verbindung der Hintergliedmaßen mit der Vorhand dar und ist dorsal durch das Nackenrückenband und ventral durch die Linea alba sehnig verspannt, wodurch wir dem Prinzip der parabolen Bogensehnenbrücke folgend eine elastische „Einrahmung“ des Pferdes erreichen. Durch das hohe Eigengewicht der Eingeweide wird auf die Wirbelsäule ein der Schwerkraft folgender Dauerzug nach ventral ausgeübt, durch den es zu einer Annäherung der Dornfortsätze kommt. Durch eine reflektorische Kontraktion der Bauchmuskulatur wird diesem Druck entgegengearbeitet. Des Weiteren verbringt ein in der Natur lebendes Pferd fast 20 Stunden mit der Nahrungsaufnahme, wodurch sich aufgrund der tiefen Kopfhaltung auch ein starker Zug auf das Nackenrückenband ergibt. Durch die Ausrichtung der Procc. spinosi, die sehr stabilitätsgebend sind, kommt es unter Ausnutzung der Hebelwirkung zu einem Anheben der Widerrist- und Brustwirbelsäulenpartie bis hin zur Mitte des Thorax. Dadurch wird diesem Absenken der Wirbelsäule physiologischerweise entgegengewirkt. Durch das zusätzliche Reitergewicht verstärkt sich die Zugwirkung, wodurch klar wird, dass es ohne zusätzliches muskelkräftigendes Training für das Pferd sehr schwer wird, das Reitergewicht tragen zu können, ohne selbst Schaden zu nehmen.
Beobachtet man eine Remonte frei an der Longe, wird man sehr schnell feststellen, dass sich das junge, noch unequilibrierte Pferd nur sehr schwer oder eigentlich gar nicht gebogen und gleichmäßig auf der Kreislinie bewegen kann. Die Pferde schauen nach außen, fallen mit der Schulter in Richtung Mitte des Zirkels und brechen zumeist mit der Hinterhand nach außen weg, was als Zeichen mangelnder Trag- und Schubkraft und vor allem fehlenden Gleichgewichtes gilt (▶Abb. 3.1 und 9.4a).
In diesem Zusammenhang sei auch der besondere Umstand der so genannten „natürlichen Schiefe“ erwähnt. Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, das eigentlich bei allen Vierbeinern ausgeprägt ist, sich jedoch beim Reitpferd als besonderes Ausbildungsproblem darstellt, da ein Pferd auf beiden Händen gleichmäßig arbeiten sollte.
Definition
Unter der „natürlichen Schiefe“ versteht man eine angeborene Seitigkeit, die einerseits aufgrund der Lage des Pferdes im Uterus und andererseits durch seine „Dreiecksform“ erklärbar wird.
Diese „Dreiecksform“ impliziert eine breite, antriebsstarke Hinterhand, die in Richtung Kopf immer schmaler wird. Durch die anfänglich noch fehlende Koordination und Autoequilibration wird der Schub aus der Hinterhand nicht geradlinig auf die Wirbelsäule übertragen, sondern schrägläufig nach vorne. Dadurch spurt die Hinterhand seitenversetzt und das Pferd bewegt sich auf einer Hand lieber als auf der anderen. Es entstehen Muskelverkürzungen der scheinbar besseren, also hohlen/konkaven Seite und die „steifere“ Seite ist schlechter biegbar.
Deshalb muss eines der Ziele der richtigen Gymnastizierung die gleichmäßige und symmetrische Ausbildung beider Körperseiten sein, damit das Pferd in der Lage ist, alle Lektionen möglichst gleichwertig auf beiden Händen auszuführen. Im Falle von Wirbelblockaden oder osteopathischen Läsionen ist es wichtig, diese vor dem Training korrigieren zu lassen, damit die Grundbeweglichkeit der Wirbelsäule wiederhergestellt wird. Andernfalls lassen sich aufgrund der daraus resultierenden reflektorischen Schonhaltungen Verspannungen und Widerstände nicht vermeiden.
Zweites Ziel der Gymnastizierung muss die Herstellung des Gleichgewichtes unter dem Reiter sein. Erst wenn das Pferd durch korrekte Longenarbeit ohne Hilfszügel durch die Autoequilibration ins Gleichgewicht gekommen und somit in der Lage ist, sich taktrein, rhythmisch und schwungvoll auf der großen Zirkellinie (20 m) zu bewegen, sollte man versuchen, eine Anlehnung über die Verwendung eines lang eingeschnallten Hilfszügels zu verlangen. Da der Hals für die Balancefindung und Gleichgewichtserhaltung essenziell ist, dürfen Hilfszügel niemals zu früh und vor allen zu eng, d. h. zu kurz, eingeschnallt werden. Ansonsten läuft man Gefahr, die Vorwärtsbewegung zu zerstören, Spannungen im Rücken und Hals aufzubauen und Widersetzlichkeiten vorzuprogrammieren.
▶Abb. 3.1 Fehlende Autoequilibration und Balance bei der jungen Remonte (links) bedingen eine Außenstellung und ein nach innen Drängen auf der Kreislinie. Trotz sorgfältiger Gymnastizierung und Geraderichtung ist es dem Pferd aufgrund anatomischer Gegebenheiten (Becken breiter als Vorhand) nicht möglich, eine von der Schweifwurzel bis zum Nacken durchgezogene Kreislinie zu halten (rechts)
Nach dieser Phase sollte das Pferd in der Lage sein, sich bei gleich langen Hilfszügeln immer wieder leicht nach innen abzudehnen und zu biegen und die Längsbiegung der Kreislinie aufzunehmen.
Da wir uns hier erst in den ersten drei Stufen der Skala der Ausbildung bewegen (Takt, Losgelassenheit, Anlehnung), kann man vom Pferd aufgrund mangelnder Fähigkeit, sich gerade zu richten, noch keine vollkommene Längsbiegung verlangen.
Ein grober Fehler wäre, in diesem Stadium den inneren Hilfszügel zu verkürzen, um eine Innenstellung aufrechtzuerhalten. Dadurch kommt es zu einer progressiven Verkrampfung der Halspartie, das Pferd verliert das Gleichgewicht und die aus der Hinterhand generierte Suche der Anlehnung in Dehnungshaltung wird durch ein Fixieren des Halses nach innen sehr erschwert.
Ist es dem Pferd gelungen, seine Balance auf der Kreislinie zu finden, sollte sich der Reiter behutsam auf das Pferd setzen und es durch seinen unabhängigen Sitz nicht unnötig in der Gleichgewichtsfindung beeinträchtigen. Ein zu frühes Beizäumenwollen in diesem Stadium macht eine vernünftige Rückentätigkeit unmöglich und bremst die Schwungentfaltung und den Takt des Pferdes.
Merke
Das Pferd muss die Anlehnung durch Aufwölben der Oberlinie aufgrund des engagierten Hinterbeines suchen wollen und nicht der Reiter dem Pferd eine Form aufzwingen.
Dies ist ein grundlegender Fehler, der in der Pferdeausbildung immer wieder gemacht wird. Das Pferd muss in diesem Stadium im Hals möglichst freibeweglich, vielleicht im Round Pen, sein Gleichgewicht unter dem Reiter suchen dürfen. Hat es dieses gefunden, ergibt sich die Anlehnung von selbst. In dieser Phase wird das Pferd herausfinden – sofern es der Reiter lobt, wenn es Ansätze in Richtung Dehnungshaltung gemacht hat –, dass das Tragen des Reitergewichtes mit einem aufgewölbten Rücken leichter fällt als mit einem durchhängenden (▶Abb. 3.2).
▶Abb. 3.2 Durch die korrekte Dehnungshaltung nach vorwärts-abwärts erweitert sich der Ganschenwinkel und hebt sich der Widerristbereich. Dadurch wird ein größerer Raumgriff möglich. Durch die Aufrichtung verlagert sich der Kraftarm Hals nach oben und hinten, sodass der Raumgriff verringert und die Hanken stärker belastet und gebeugt werden
Abhängig davon darf das Pferd hierbei nicht in eine muskuläre Übermüdung geraten. Deshalb sind anfänglich kurze Reitintervalle von 10 Minuten ausreichend.
Wann ein Pferd die einzelnen Phasen erfolgreich absolviert hat, ist von Pferd zu Pferd verschieden und soll nicht durch Zeitvorgaben eingegrenzt werden.
Im Zuge dieser systematischen Trainingsarbeit kommt es zur Ausbildung und Kräftigung der wichtigen Muskelpartien an Rücken, Hinterhand, Bauch und Hals, die das Pferd befähigen, uns schadlos tragen zu können.
Man darf niemals vergessen, dass der Reiter größtenteils am thorakolumbalen Übergang sitzt, der aufgrund fehlender knöcherner Unterstützung, jedoch mit erhöhter Beweglichkeit ausgestattet ist. Deshalb ist er auch für Verspannungen und osteopathische Läsionen sehr anfällig und fragil. Lässt man diesen gymnastischen Aufbau des jungen Pferdes unbeachtet, ist es dem Pferd nicht möglich, seine Bewegungsabläufe derart zu koordinieren, um zu einer guten Qualität der Grundgangarten zu kommen. Dies führt durch die fehlende Durchlässigkeit des Pferderückens zu einer „Zweiteilung“ des Pferdes. Der Schub aus der Hinterhand versiegt in der Mitte der Brustwirbelsäule bei durchgedrücktem Rücken, wodurch das für die Versammlung notwendige Aufwölben nicht zustande kommen kann. Der Restschwung wird dann mehr oder weniger unelastisch von der Vorhand aufgefangen, wodurch die Gelenke und Sehnenpartien verstärkten Belastungen ausgesetzt werden. Aufgrund der zusätzlichen Belastungsmomente der Vorhand kommt es über die muskulokinetischen Ketten zu Verspannungen der Halswirbelsäule, woraus wiederum Anlehnungsschwierigkeiten und Rittigkeitsprobleme entstehen. Deshalb kommt der Gymnastizierung des Pferdes jeden Alters so große Bedeutung zu, denn nur ein harmonisch funktionierender Körper ist auch in der Lage, sportliche Höchstleistungen zu bringen.
4 Auf der Suche nach der Leichtigkeit – „Was ist Legerté?“
Vergleicht man Pferde in den gleichen Lektionen der klassischen Reitkunst in verschiedenen Ländern, fällt auf, dass sich vor allem in den romanischen Ländern (Spanien, Portugal, Frankreich) Pferde mit einer tänzerischen Leichtigkeit scheinbar spielend in Piaffen, Passagen oder Pirouetten tummeln, die man in den nördlichen Gefilden seltener oder fast nie auf den Turnierplätzen zu sehen bekommt. Trotzdem führen diese Pferde auch diese Lektionen korrekt, rhythmisch, taktrein und mit entsprechendem Versammlungsgrad aus. Aber es gibt einen Unterschied.
Definition
Unter der von der Französischen Schule geprägten „Legerté“ versteht man keine neue Form von Leichtigkeit, sondern vielmehr die feine Abstimmung des Spieles mit dem Gleichgewicht des Pferdes, das durch entsprechende Vorbereitung frisch, agil und selbstständig erhalten worden ist.
Dieses Reiten am fast durchhängenden Zügel in höchster Versammlung ist das Resultat jahrelanger Vorbereitung unter der Prämisse, die Ausstrahlung und Persönlichkeit des Pferdes zu erhalten und nicht zu brechen (▶Abb. 4.1).
Dieses Ziel zu erreichen ist jedoch nicht von einem gewissen Pferdetyp, sondern vielmehr von einem systematisch aufbauenden Training abhängig. Viele Pferde beherrschen zwar perfekt gewisse Lektionen, punkten aber im Wettbewerb nicht so hoch, da ihnen Ausdruck und Personalität „weggeritten“ worden sind. Durch das Mechanisieren von Lektionen ohne für das Pferd erkenntlichen sinnvollen Aufbau kann es bestenfalls zu mechanisierten Turnierautomaten, jedoch nie zur Schaffung von Kunst kommen.
Denn „Legerté“ kann niemals durch Zwang von außen, über Hilfsmittel oder Gebisse erreicht werden, sondern ergibt sich von innen durch die mentale Losgelassenheit, wodurch die Bereitschaft des Pferdes zur Mitarbeit und seine individuelle Persönlichkeit in den Vordergrund gestellt werden.
▶Abb. 4.1 Maximale Legerté, demonstriert vom Autor auf dem Schulhengst Galante der REAAE. Der Hengst piaffiert energisch und der Reiter lässt ihn durch Entspannung der Schenkel und Absenken der Hand arbeiten und strahlen, ohne das Pferd in seiner Balance zu stören. Das Pferd kaut zufrieden ab und signalisiert höchste Konzentration
Ebenso spielt in diesem Zusammenhang der Begriff „Mise en main“ eine Rolle, der nichts anderes beschreibt als das Absenken und Weglassen der Hand des Reiters. Dadurch soll dem Pferd die Möglichkeit gegeben werden, sich selbsttätig in der vom Reiter verlangten Lektion so lange zu bewegen, bis von ihm etwas anderes verlangt wird. Ein auf leichte Hilfen abgestimmtes und auf den Reiter stark fixiertes Pferd wird diesen Anforderungen gerecht werden können. Spannungen in Hals und Rücken, die normalerweise durch zu starke Handeinwirkung erzeugt werden, sind hier fast ausgeschlossen, da sich diese Leichtigkeit in der Hand aus einer tätigen Hinterhand bei aufgewölbter Oberlinie und relativer Aufrichtung von selbst ergeben soll.
Merke
„Wiederhole oft, begnüge dich mit wenig, lobe viel!“ (N. Olivera)
5 Biomechanische Grundlagen als Basis eines erfolgreichen Trainings
5.1 Das „gute“ Pferd – Anatomie, Physiologie und Biomechanik
Gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich die auf die sportlichen Bedürfnisse ausgerichtete Pferdezucht dergestalt entwickelt, dass man meint, aufgrund der hervorragend veranlagten Zuchtprodukte an einer systematischen Ausbildung des Pferdes sparen zu können, was sich aber bei näherer Betrachtung als Trugschluss herausstellt. Immer wieder stellt sich die Frage nach den Kriterien, die ein so genanntes „gutes“ Pferd ausmachen. Möglicherweise ist ein ruhiges, ausgeglichenes, braves Ausreitpferd für den nicht ambitionierten Freizeitreiter das beste Tier, während der olympiaverdächtige Dressurcrack, der zweifellos die bessere Ausbildung erfahren hatte, für diesen Reiter aufgrund seiner mangelnden reiterlichen Fähigkeiten in gewissem Sinne wertlos bleibt, da er dieses hoch spezialisierte Tier nicht entsprechend nutzen kann. Weiterhin kann das bestveranlagte und ganggewaltigste Pferd mangels entsprechender Arbeitseinstellung auch nur sehr schwer an den Reitdienst herangeführt werden, weshalb sich wieder die Frage stellt, ob es sich hierbei um ein „gutes“ Pferd handelt. Immer wieder sieht man von der Natur nur ungenügend ausgestattete Pferde, die trotz ihrer konformationsbedingten Mängel aufgrund einer sinnvollen Trainingsarbeit und ihrer kämpferischen Arbeitseinstellung ihren Reitern wertvolle Sportkameraden sind.