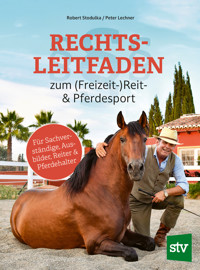
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Autoren beleuchten in ihrem neuesten Buch alle Facetten des Freizeitreitens und des Pferdesports unter Berücksichtigung sämtlicher tierschutzrechtlicher Rahmenbedingungen in Deutschland und Österreich, um darzustellen, wie man diesen wunderbaren Sport mit dem Lebewesen Pferd betreiben kann, sodass beide Beteiligten Freude an ihrer Zusammenarbeit haben. Eine artgerechte Haltung gehört hier ebenso dazu wie eine vorsichtige und liebevolle Ausbildung mit einer Ausrüstung, die speziell an das einzelne Pferd angepasst und ihm angenehm ist. Auch auf viele weitere rechtlich relevante Punkte, wie Verhalten im Straßenverkehr, Registrierung im Vis (Verbrauchergesundheitsinformationssystem), Haftung im Schadensfall und Kauf bzw. Verkauf von Pferden inkl. Wertminderung, wird näher eingegangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert StodulkaPeter Lechner
RECHTSLEITFADEN
zum (Freizeit-)Reit- & Pferdesport
Für Sachverständige, Ausbilder, Reiter & Pferdehalter
Leopold Stocker VerlagGraz – Stuttgart
Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka, A-8143 Dobl/Graz
Titelbild Vorderseite: Marta Woltosz, Rückseite: Bild 2, 4 und 5: Archiv
Prof. Stodulka, Bild 1 und 3: Mag. Saskia Stodulka-Prethaler.
Bildnachweis: Den Bildnachweis finden Sie direkt beim jeweiligen Bild vermerkt.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Inhalt des Buches wurde von den Autoren und vom Verlag nach bestem Wissen überprüft; eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Die juristische Haftung ist daher ausgeschlossen.
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5 / Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-2258-7
eISBN 978-3-7020-2279-2
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2024
Layout: Werbeagentur Rypka, A-8143 Dobl/Graz
Fragen, Wünsche oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns!
www.stocker-verlag.com/rechtsleidfaden-pferdesport-feedback/
Hier finden Sie auch weitere Informationen über unser Programm und können sich für unseren Newsletter anmelden.
INHALT
DANKSAGUNG
PRÄAMBEL
EINLEITUNG
Anwendungsbereich des Rechtsleitfadens für (Freizeit-) Reit- und Pferdesport sowie allgemeine Grundsätze
Hippologische & hippologisch-forensische Begriffsdefinitionen
Das Pferd als soziales Wesen
Sinne des Pferdes
Sehen
Hören
Riechen
Kenntnisse und Fähigkeiten von Personen – Betreuungspersonen
Ausbildung, Training und Nutzung von Pferden und anderen Equiden
Grundlegendes
Trainingsphysiologie & Trainingslehre
Vertrauensbasis als Grundlage der tierschutzkonformen Ausbildung
Lernen und Lernverhalten von Pferden
Hilfen als Kommunikationsmittel in der Pferdeausbildung
Lebens- und Arbeitsraum unserer (Freizeit-)Sportpferde
Ausbildungsbeginn, Einsatz und sportlicher Einsatz
Gesundheitszustand der Pferde für Training und Wettbewerb
Skelettreifung von Pferden
Futter- und Ernährungszustand
Leitfaden zur Schmerzerkennung beim gerittenen Pferd
Das Schmerzgesicht und die Pain Grimace Scale (PGS)
Schmerzskala – Composite Pain Scale (CPS)
Objektive Schmerzbeurteilung nach Univ. Lektor VR Mag. Dr. Reinhard Kaun, frei nach Univ. Uppsala
Beispiel für einen praktischen Fall nach Dr. KAUN
Schmerzbeurteilung beim gerittenen Pferd
Entwicklung und Gesunderhaltung durch zielgerichtetes systematisches und pferdegerechtes Training nach tierschutzkonformen Grundsätzen
Reitergewicht und Pferdebelastung
Tierärztliche Betreuung – Betreuungspersonen im Pferdewesen
Die Ausrüstung von Pferd und Reiter
Grundlegendes zur Ausrüstung
Sattel
Zäumung
Zügel – die feine Verbindung vom Pferdemaul zur Reiter- und Fahrerhand
Der Sporn – die Verfeinerung der Schenkelhilfe
Peitschen und Gerten
Unerlaubte Hilfsmittel und Manipulationen
Unerlaubte Eingriffe
Doping
Dopingmittel und Dopingformen
Dopingproblematik, Dopingkontrolle
Weitere rechtlich relevante Punkte für den Reiter und Pferdehalter
Straßenverkehr
Reiten im Wald
Pferdetransport
Registrierung im VIS
Zäune
Kauf/Verkauf
Gewährleistung
Schadenersatz
Irrtum
Verkürzung über die Hälfte
Haftung des Reitstallbetreibers
Tierhalterhaftung
Wertermittlung eines Pferdes nach dem Schätzwertmodell von Univ. Lektor VR FTA Mag. Dr. Reinhard Kaun©
Bewertung eines Pferdes nach werterhöhenden und wertmindernden Faktoren
HorseTAX® nach Prof. Stodulka & Dr. Lechner
I. Bewegungsapparat
II. Innere Erkrankungen
III. Wertminderung von Zuchtstuten nach Univ. Prof. Dr. J. & C. Aurich
Die Autoren
Prof. Mag. Dr. Robert STODULKA
RA em. Mag. Dr. Peter LECHNER
LITERATUR
Die Equidenhaltungs-Verordnung
MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE HALTUNG VON PFERDEN UND PFERDEARTIGEN (EQUIDEN)
1. Begriffsbestimmungen
2. Allgemeinde Haltungsvorschriften
2.1 Gebäude und Stalleinrichtungen
2.2 Bewegungsfreiheit
2.6 Ernährung
2.7 Betreuung
2.8 Ganzjährige Haltung im Freien
2.9 Almwirtschaft
2.10 Absatzveranstaltungen, Tierschauen und sportliche Anlässe
2.11 Eingriffe
© Mag. Saskia Stodulka-Prethaler
© Archiv Prof. Stodulka
© Mag. Saskia Stodulka-Prethaler
© Mag. Saskia Stodulka-Prethaler
DANKSAGUNG
Ich möchte mich aus ganzem Herzen bei meinem Mentor, Kollegen und Lehrer Herrn Univ. Lektor VR FTA Mag. Dr. Reinhard Kaun bedanken, der uns dankenswerterweise aus seinem unermesslichen fachlichen und menschlichen Fundus wesentliche Erkenntnisse aus seiner über einem halben Jahrhundert gelebten Praxiserfahrung für dieses Werk kostenfrei und uneigennützig zur Verfügung gestellt hat. Ich danke ihm besonders, diesem großen Visionär und Humanisten, für das Vorleben einer stets makellosen, unverrückbar klaren und auch, wenn notwendig, mutigen Haltung, zu seiner Meinung zu stehen und diese zu vertreten, seine profunde Fachkenntnis und die Inspiration auf vielen Ebenen. Tempora mutantur et nos mutamur in illis!1
Danke, geschätzter Herr Kollege!
Prof. Dr. Robert Stodulka
1 Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen.
PRÄAMBEL
Das Wohlergehen des Pferdes in Sport, Freizeit, Haltung und Zucht ist stets vor allen anderen und vor allem wirtschaftlichen Interessen von Funktionären, Reitern, Züchtern und Besitzern zu stellen und hat im Einklang mit modernen hippologischen Erkenntnissen und den damit in Verbindung stehenden gesetzlichen Grundlagen (mod. nach OEPS, Pferdesport & Spiel, S. 4) zu stehen.
EINLEITUNG
Das Pferd begleitet den Menschen schon seit gut 6.000 Jahren auf seinem Weg in die Zivilisation und hat formgebend und maßgeblich unser kulturelles und soziopolitisches Leben ermöglicht und dieses beeinflusst. Vom anfänglichen Fleischlieferanten über die Nutzung als Trag- und Zugtier ließ es sich bald durch die Domestikation und Selektion auf gewisse Merkmale bedingt reiten und ermöglichte so dem Menschen das Überwinden von großen Distanzen. Damit war es maßgeblich an der Besiedelung der Welt beteiligt.
Als Kriegspferd lebensnotwendig, wurde es dann in Renaissance und Barock zu einem stolzen Begleiter der Herrscherhäuser und zum Vergnügen gehalten. Im 19. Jh. musste es mit der Eisenbahn und den Maschinen in Konkurrenz treten und drohte fast durch diese ersetzt zu werden, doch konnte die enge, jahrtausendelang aufgebaute soziale Verbindung zum Menschen dies verhindern. Später, im 20. Jh., wurde es zuerst beim Militär eingesetzt, um dann im Zivilleben wieder als Freizeit- und Sportpartner Zeit mit dem Menschen verbringen zu können. Angelangt im 21. Jh. hat sich ein Paradigmenwechsel im Umgang und Zusammenleben mit dem Pferd eingestellt, den man nicht ignorieren kann.
Das Pferd hat zu seinen ursprünglichen Aufgaben noch mit dem Betätigungsfeld als „Companion Animal“, als Freizeitpartner- und Gesellschaftstier, einen neuen Bereich in der Konvivenz2 mit dem Menschen gefunden, was unmittelbare Auswirkungen auf die Art, wie mit Pferden umgegangen werden soll und muss, gezeitigt hat. Heute steht das Sein mit dem Pferd und dessen Haltungsbedingungen in vielen Bereichen mehr im Vordergrund als die sportliche gymnastische klassische Ausbildung des Pferdes, um dieses möglichst lange gesund und leistungsfähig zu erhalten.
Diese neue Entwicklung steht jedoch nicht zwingend im Kontrapunkt zu einer sportlichen Nutzung des Pferdes, soferne diese im Sinne der die Natur des Pferdes respektierenden klassischen Förderung entspricht. Richtiges Reiten und Trainieren eines Pferdes ist angewandter Tierschutz. Daher soll das Zusammenführen pferdegerechter Haltungs- und Trainingsaspekte nach neuen und auch alten hippologischen Gesichtspunkten das Zusammenleben mit dem Pferd auch im 21. Jh. bereichern und in neuem Lichte erstrahlen lassen.
Ethiker hinterfragen die „Nutzung von Tieren“ im Allgemeinen und es wird eine SLO (Social Licence to Operate) verlangt, welche zusätzlich zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Tierschutzgesetzes (TschG), der Equidenhaltungs-Verordnung (VO) und anderen tradiert hippologischen Grundsätzen und neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen das Hippologische Genre vor neue Herausforderungen stellt, welche es im Sinne der Pferde zu lösen gilt.
Prof. Stodulka auf dem PRE-Hengst Quilate
© Marta Woltosz
Die vorliegenden österreichischen Leitlinien als Rechts- und Praxisleitfaden zum (Freizeit-)Reit- & Pferdesport sollen basierend auf dem österreichischen TschG und der Equidenhaltungs-VO in Anlehnung an die deutsche Leitlinie einen Leitfaden zum pferde- und tiergerechteren Umgang bieten und in erster Linie neben der Haltung die pferdesportlichen Aspekte und die tierschutzkonforme Umsetzung herausarbeiten. Auch wurden der Übersichtlichkeit und Didaktik halber Definitionen und Textabschnitte aus diesem deutschen Leitfaden unter Angabe der Quelle übernommen und, wenn notwendig von den Autoren modifiziert und an die österreichischen Gegebenheiten adaptiert. Das vorliegende Werk beabsichtigt nicht die Deutsche Leitlinie Pferdesport zu ersetzen, vielmehr stellt diese eine wichtige fachliche Grundlage für die österreichische Betrachtungsweise des hippologischen Geschehens dar.
Da der Rennsport durch andere Verbände geregelt wird, findet er in diesem Text vorerst noch keine Berücksichtigung!
Im Anhang ist noch die fachlich sehr gehaltvolle Equidenhaltungs-VO angelegt, welche diesen Rechtsleitfaden zum Reit- und Pferdesport abrunden und so eine kurze hippologische Zusammenschau bieten. Denn: Richtiges (pferdegerechtes) Reiten ist angewandter Tierschutz!
2 Zusammenleben
ANWENDUNGSBEREICH DES RECHTSLEITFADENS
FÜR (FREIZEIT-)REIT- UND PFERDESPORT SOWIE ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Das Pferd gilt schon seit Jahrhunderten als „nobelste Eroberung des Menschen“ (Buffon) und die Reitkunst sowie der Reitsport als wichtige Charakter- und Lebensschule für den Menschen. Das Pferd ist seit Jahrtausenden domestiziert und so in einem besonderen soziopolitischen Kontext mit dem Menschen zu sehen. Die klassische Reitlehre wie auch das Pferd haben Jahrtausende miteinander in enger Verbindung unsere gesellschaftliche Entwicklung und die des Abendlandes geprägt.
Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Konservierung der Asche, weshalb sich auch der Reitsport und die Stellung des Pferdes in unserer Welt verändern dürfen, ohne jedoch die Essenz zu verlieren. Die klassische Reitkunst der Spanischen Hofreitschule und der Deutschen Reitlehre sind bereits immaterielles UNESCO Weltkulturerbe, weshalb es auch gilt, diese kulturelle Errungenschaft mit unseren heutigen Pferden zu erhalten und diese zum Wohle des Pferdes einzusetzen, damit dieses viele Jahre lang gesund und leistungsstark mit uns zusammenleben kann.
Aus Angst, etwas am Pferd falsch machen zu können, nicht mehr zu reiten, kann aus fachlicher Sicht auch nicht die Lösung sein. Die Sportverbände und viele selbstständige Ausbilder und Reitmeister unserer Zeit bieten hierfür viele sinnvolle Fortbildungsmöglichkeiten.
Die vorliegende Leitlinie soll eine praktische Richtschnur, gestützt auf die rezenten wissenschaftlichen und hippologischen Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte sowie basierend auf der Klassischen Reitlehre, bieten, um das Pferd noch viele weitere Jahrhunderte (freizeit)-sportlich in unserem Lebensumfeld einbinden zu können. Es gilt, das Reiten und den Pferdesport unter Bedachtnahme des Tierschutzes in seiner reinen Form zu erhalten und sie ins nächste Jahrhundert führen zu können, wie dies schon von unseren Vorvätern für uns getan worden war. Im Fokus dieser Leitlinie steht die Nutzung des Pferdes als (Freizeit)Reit- und Sportpartner unter Berücksichtigung sämtlicher tierschutzrechtlicher Rahmenbedingungen.
Das Pferd begleitet den Menschen seit Jahrhunderten.
© Archiv Prof. Stodulka
Es geht in diesem Kontext um den Erhalt eines Kulturgutes (Pferd und Reitkunst/-sport), das es gilt, für die nächsten Generationen zu bewahren, es weiterzuentwickeln und verantwortungsvoll weiterzugeben.
Bei der Nutzung des Pferdes müssen immer der Tierschutz und die Ethik im Vordergrund stehen, denn richtiges Reiten ist angewandter Tierschutz.
© Marta Woltosz
HIPPOLOGISCHE & HIPPOLOGISCH-FORENSISCHE BEGRIFFSDEFINITIONEN
In diesem Kapitel werden hippologische Grundbegriffe näher erläutert und auch die in der deutschen „Leitlinie für Pferdehaltung und Pferdesport“ und „Tierschutz im Pferdesport“ (bmel.de) sowie dem Handbuch Pferd und anderer Equiden des österreichischen Bundesministerium für Gesundheit enthaltenen und anzuwendenden Definitionen übernommen, um einen einheitlichen Sprachgebrauch in der Verwendung von hippologischen Fachbegriffen sicherzustellen.
Der deutschen Leitlinie wird rechtlich der Status eines antizipierten Sachverständigengutachtens verliehen und dient sohin als Argumentationsgrundlage in Tierschutz- und Haltungsfragen vor Gericht. Sollten aus hippologischer Tradition österreichische Aspekte besondere Berücksichtigung finden müssen, so werden diese entsprechend eingearbeitet.
Die Dressur ist für das Pferd da und nicht umgekehrt.
© Mag. Saskia Stodulka-Prethaler
Anbindehaltung3: bezeichnet eine Haltung, bei der jedes Tier einzeln auf einem Standplatz durch eine Anbindevorrichtung fixiert ist.
Absolute/aktive Aufrichtung: Das Reiten in absoluter/aktiver Aufrichtung steht nicht im Einklang mit der dazu korrespondierenden, in der klassischen Reitlehre geforderten Hankenbeugung, welche je nach Hankenbeugungsgrad eine relative Aufrichtung erzeugt, und ist daher als tierschutzrelevant einzustufen, da wesentliche biomechanische Zentren im Rücken dysfunktional geschaltet werden. Die aktive Aufrichtung ist als Antithese zur Rollkur zu sehen, da diese mit der Hand des Reiters provoziert wird und nicht mehr im Einklang mit der Rückentätigkeit steht.
Anpassungsphase: Sukzessive Anpassung des Organismus an die Trainingsarbeit, um Losgelassenheit und direkte Hilfengebung zu erlernen. Sie stellt die erste Phase der Grundausbildung dar.
Nur ein in Balance gehendes Pferd kann auch gesund bleiben und wird in seinem Wohlbefinden nicht gestört.
© Mag. Saskia Stodulka-Prethaler
Anlehnung: Zustand, den das Pferd über die Dehnungsbereitschaft, an die Hand heranzutreten, zur Reiterhand selbst herstellt, wohingegen der Kontakt lediglich als Verbindung der Reiterhand zum Pferdemaul verstanden wird.
Auslauf4: ist eine vom Stallbereich (zeitweise) getrennte Bewegungsfläche ohne Weidemöglichkeit.
Autoequilibration: Selbstbalancefindung auf der Kreisbahn (Longe) und später dann unter dem Reiter unter Zuhilfenahme der Kopf-Hals-Achse als Balancierstange, um das reiterliche Gleichgewicht finden zu können.
Balance: Durch das Training erworbener Zustand des Gleichgewichtes, der über die Rückentätigkeit zu einem essentiellen Teil für das gesund zu reitende Pferd in Leichtigkeit verantwortlich zeichnet. Im Gegensatz zum physikalischen Gleichgewicht, bei dem sich ein Objekt lediglich in einem Zustand befinden muss, um nicht umzufallen, was aber in diesem Kontext noch keinem hippologischen Topos zuzuordnen ist.
Barren: Tierschutzwidrige Trainingsmethode, die zu erheblichen Schmerzen führt. Ziel ist die Erhöhung der Sensibilität im Bereich der Gliedmaßen durch Anheben der obersten Hindernisstange oder Anschlagen mit einem Gegenstand während des Sprungs (so genanntes aktives Barren) oder durch die Verwendung vom Pferd nicht zu sehender Gegenstände (z. B. dünne Eisenstangen, Drähte) vor, hinter oder über der obersten Hindernisstange (so genanntes passives Barren).
Beizäumung: Beugung des Genicks, welche sich im Zuge der Versammlung von selbst einzustellen beginnt, jedoch letztere nicht zu erzeugen in der Lage ist.
Bestrafung5: Der Vorgang, bei dem der Strafreiz einem bestimmten Verhalten folgt, sodass die Häufigkeit (oder Wahrscheinlichkeit) dieses Verhaltens abnimmt (siehe auch positive Bestrafung und negative Bestrafung).
Positive Bestrafung (Bestrafung durch Hinzufügen): Das Hinzufügen von etwas Unangenehmen, um eine unerwünschte Reaktion zu bestrafen und so die Wahrscheinlichkeit dieser Reaktion zu vermindern. Falsche Anwendung der positiven Strafe kann die Motivation eines Tieres, neue Reaktionen auszuprobieren, reduzieren, zu einer Desensibilisierung gegenüber dem Strafreiz führen und mit Angst/Furcht verknüpfte Assoziationen hervorrufen. Sie entspricht nicht mehr dem jetzigen Stand der Wissenschaft.
Negative Bestrafung (Bestrafung durch Wegnahme): Das Wegnehmen von etwas Angenehmen (z. B. Futter), um die Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Reaktion zu vermindern und so diese Reaktion auszulöschen.
Bewegung, freie6: Die freie Bewegung ermöglicht es dem Pferd, die Bewegung im Hinblick auf die Art der Bewegungsabläufe, Richtung und Tempo bzw. Gangart selbstbestimmt auszuführen. Bewegungen, die das Pferd aus eigenem Antrieb ausführt, sind ein Teil seines natürlichen Bewegungsrepertoires und daher für das Pferd mit den geringsten Anstrengungen verbunden.
Sollst fliegen ohne Flügel und kämpfen ohne Schwert! (Koran)
© Mag. Saskia Stodulka-Prethaler
Bewegung, gelenkte7: Bei einer gelenkten Bewegung werden Bewegungsabläufe, die Art der Bewegung, Tempo und Gangart durch äußere Faktoren beeinflusst bzw. gesteuert; zur gelenkten Bewegung zählen insbesondere das Führen, die Bewegung in einer Führanlage, das Longieren, die Arbeit unter dem Sattel, sportliche Betätigung wie Spring- oder Dressurreiten und das Ziehen von Lasten.
Blistern8: Aufbringen von chemischen Substanzen mit Reiz- oder Ätzwirkung auf bestimmte Bereiche mit dem Ziel, eine lokale Entzündung zu erzeugen. Tierschutzwidrig ist das Aufbringen dieser Substanzen mit dem Ziel, lokal eine Erhöhung der Sensibilität zu erzeugen.
Clipping/Clippen9: Kürzen oder Entfernen von Tasthaaren am Kopf des Pferdes. Die Haare in den Ohrmuscheln haben eine sinnvolle Schutzfunktion und dürfen ebenfalls nicht entfernt werden.
Doping10: Verabreichung von Substanzen an Pferde oder Anwendung verbotener Methoden bei Pferden mit dem Ziel, die natürliche, aktuelle Leistungsfähigkeit, insbesondere bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen, zu beeinflussen.
Feinmotorikphase: 3. Ausbildungsphase in der Medizinischen Reitlehre nach Dr. Stodulka®, in der das Pferd aufgrund fortgeschrittener propiozeptiver Fähigkeiten lernt, die Bewegungen der Hohen Schule auszuführen.
Fitnesskontrolle11: Sie ist nach Beendigung von Geländewettbewerben (Reiten und Fahren) von Tierärzten durchzuführen. Die Pferde werden auf Lahmheiten, Verletzungen und Überanstrengung kontrolliert.
Fluchttier: Pferde sind aufgrund ihrer Biologie Fluchttiere und Beutetiere, die versuchen, bei Gefahr zu fliehen. Dieses Verhalten ist angeboren und auch durch bestes Training nur bedingt modifizierbar.
Forensik: Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht und aufgearbeitet werden.
Ganzjährige Haltung im Freien (ganzjährige Freilandhaltung)12: Dabei werden die Tiere auf einer mit Futterpflanzen bewachsenen landwirtschaftlichen Nutzfläche ganzjährig im Freien gehalten. Die Fläche ist ausschließlich oder zum überwiegenden Teil zum Beweiden der Tiere vorgesehen. Begrifflich abzugrenzen ist die ganzjährige Freilandhaltung vom Weidegang, vom Auslauf und der Offenstallhaltung.
Geraderichtung: Fähigkeit des Pferdes, durch systematische Gymnastizierung die natürliche Schiefe zu kompensieren, indem es die schiebenden und tragenden Hinterbeine der einen Seite zu selbigen auf der anderen Seite werden können lässt. Nur durch die systematische Anwendung des Reitens auf gebogenen Linien in 1. und 2. Stellung sowie durch die Seitengänge ist es möglich, diese Fähigkeit zu erlangen. Die natürliche Schiefe ist nicht durch das Reiten im Gelände von A nach B ohne Gymnastik kompensierbar.
Die Versammlung und die Lektionen in der klassischen Reitlehre sind kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Hier ein Mezair, eine Galoppschule zu zwei Zeiten, das die Hankenbeugung und Federkraft verbessert.
© Marta Woltosz
Gewöhnung (Habituation)13: nachlassende Antwort auf einen wiederholten Reiz, die nicht auf Ermüdung oder sensorische Anpassung zurückzuführen ist.
Heilverläufe: In der modernen regenerativen Medizin zielen sie auf eine vollkommene/bestmögliche Wiederherstellung des Zustandes ex ante (wie zuvor) ab. Folgende Heilungsverläufe für die unterschiedlichen Gewebsstrukturen können aus nachfolgender Tabelle für die forensische Einschätzung auf Entstehungszeitpunkt und Ausheilung entnommen werden.
Durchschnittliche Heilungsdauer von Gewebe und Regenerationstendenz
Muskelverletzung
Grad 1
2–8 Wochen
Grad 2
2–4 Monate
Grad 3
9–12 Monate
Bandverletzung
Grad 1
2–8 Wochen
Grad 2
2–6 Monate
Grad 3
6–12 Monate
Transplantat
12+ Monate
Sehnenverletzung
akut
2–6 Wochen
subakut
2–4 Monate
chronisch
3–9 Monate
Andere Verletzungen
Einriss, chirurgischer Eingriff, Abriss
4–12+ Monate
Knochenbruch
6–12+ Wochen
Gelenksknorpel
9–24 Monate
Meniskus
3–12 Monate
Hilfe: Ein Stimulus, der beim Pferd eine erlernte Verhaltensantwort hervorruft. Der Begriff Signal hat eine analoge Bedeutung, ist aber Reit- und Trainingsweisen unabhängiger.
Die Medizinische Reitlehre nach Dr. Stodulka® ist ein tierschutzkonformes und zertifiziertes Ausbildungssystem für Pferde.
© Mag. Saskia Stodulka-Prethaler
Hyperflexion14: Überbeugung des Genicks oder des Halses als Folge des Reitens oder Longierens mit sehr enger und/oder in Richtung Vorderbrust eingerollter Kopf-Hals-Position des Pferdes (so genannte Rollkur).
Hippologie: Wissenschaft über das gesamte Pferdewesen und das Pferd: Pferdewissenschaft.
Hippologische Forensik: Mit Hilfe kriminologischer Techniken und Rekonstruktionen von Unfällen und Sachverhalten werden das Wissen aus der traditionellen Pferdewissenschaft (Hippologie) vom Sachverständigen in Form seines Gutachtens derart für das Gericht oder den Auftraggeber aufgearbeitet, dass dieses/dieser auf Basis des Sachverständigenbeweises juristische Schlüsse zu ziehen in der Lage ist.
Klassische Reitlehre: Unter der Klassischen Reitlehre wird ein althergebrachtes und fundiertes Ausbildungssystem von Pferd und Reiter subsummiert, welches sich an der Natur des Pferdes, dessen Psyche und Physis orientiert und durch den systematischen Trainingsaufbau auch die Gesunderhaltung und das Wohlbefinden des Pferdes positiv unterstützt.
Kommunikation: Pferde kommunizieren durch Körpersignale miteinander. Aktionen des Menschen bzw. sein Verhalten rufen daher Reaktionen bei Pferden hervor. Die Hilfen sind dabei das Verständigungsmittel zwischen Mensch und Pferd.
Konditionierung15





























