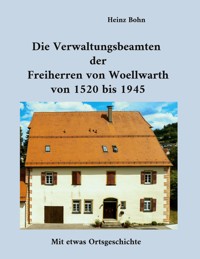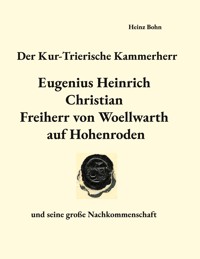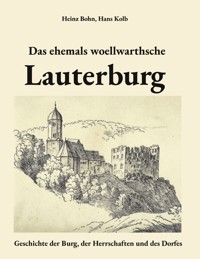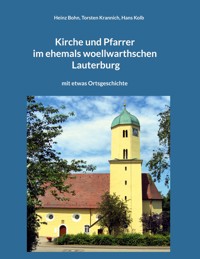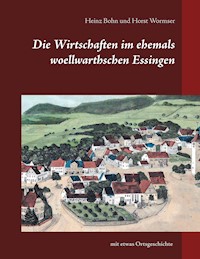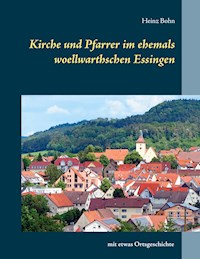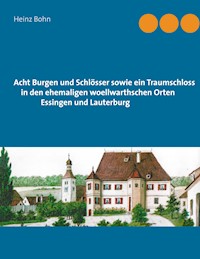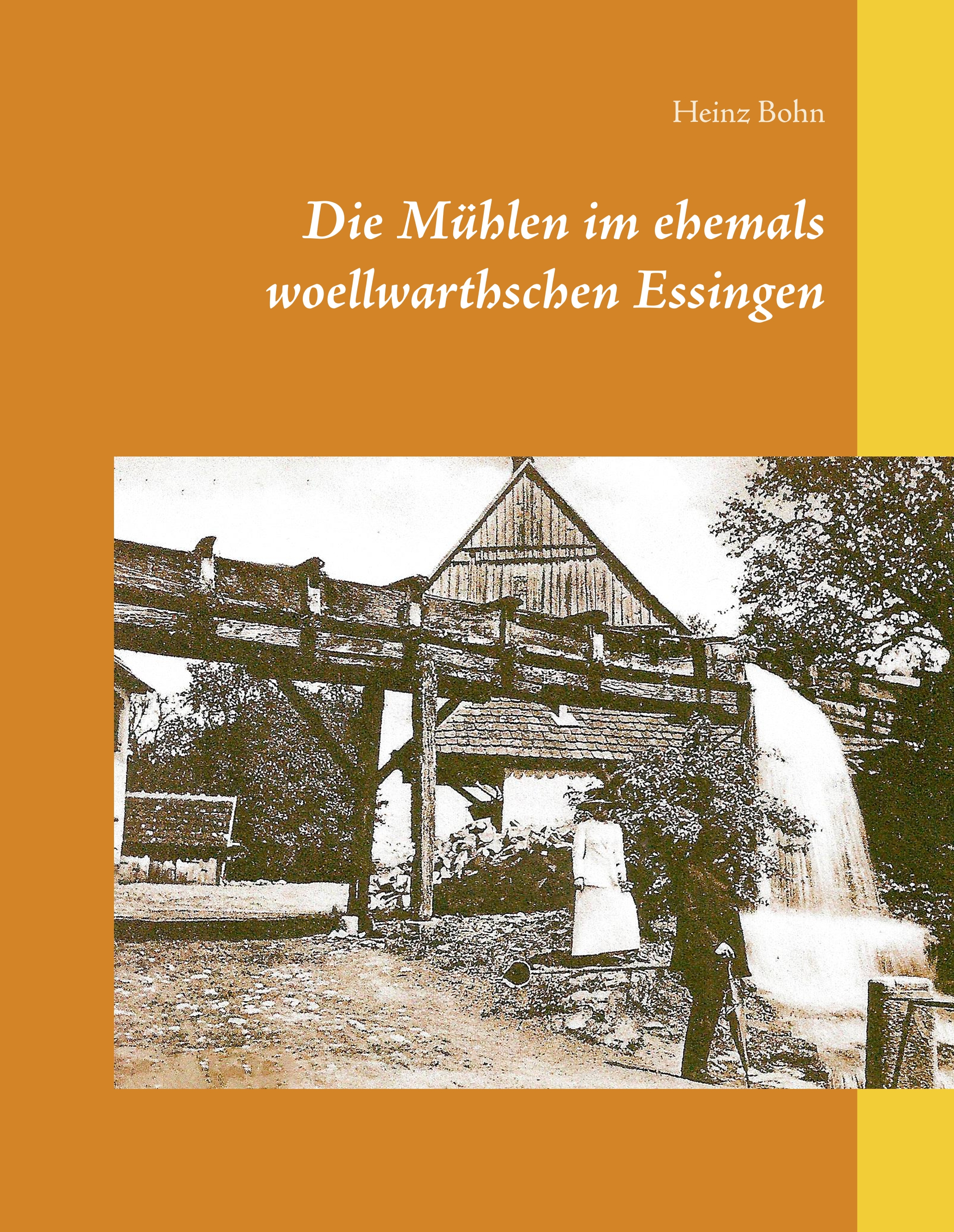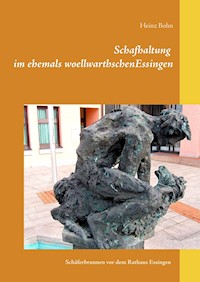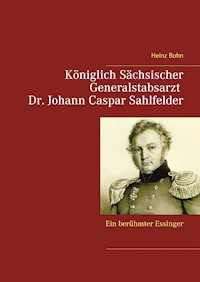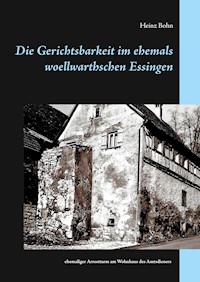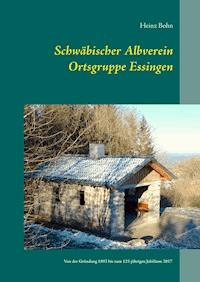Medizinische Versorgung in den ehemals woellwarthschen Orten Essingen und Lauterburg E-Book
Heinz Bohn
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Medizin ist untrennbar mit der Entwicklung von Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur verbunden. Das vorliegende Buch nimmt den Leser mit auf die Reise durch die Jahrhunderte - von den Anfängen der Heilberufe im Mittelalter bis zum heutigen Arztberuf in Deutschland. Ausgangspunkt ist das Wirken der Freiherren von Woellwarth, eines süddeutschen Adelsgeschlechts, das seit dem 14. Jahrhundert in Ostwürttemberg ansässig ist. Die Freiherren von Woellwarth hatten einen prägenden Einfluss auf die regionale Entwicklung, zu der auch die Medizingeschichte zählt. Bereits 1538 übernahmen sie das Patronat der Essinger Kirche und setzten mit der Einführung der Reformation um 1565 wichtige Impulse für die kirchliche und soziale Infrastruktur der Region. Mit der Erlassung von Dorfordnungen und einer eigenen Kirchenordnung im Jahr 1729 gestalteten sie maßgeblich das Gemeinwesen in Essingen und Lauterburg. 1806 wurde ihr Territorium dem Königreich Württemberg einverleibt und dem Oberamt Aalen zugeschlagen. Zahlreiche Biografien lokaler Bader, Wundärzte, Chirurgen und Hebammen sowie historische Quellen veranschaulichen die medizinische Versorgung der ehemaligen woellwarthschen Untertanen. Das Buch schließt mit einem Blick auf die Hebammen und Wehmütter im Wandel der Zeit sowie auf die medizinische Versorgung während der Weltkriege und in der Nachkriegszeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Medicus curat, natura sanat,
„Der Arzt behandelt, die Natur heilt“ geht vermutlich auf die Lehren des griechischen Arztes Hippokrates von Kos (um 460–370 v. Chr.) zurück. Im christlichen Mittelalter wurde der Spruch um „Deus salvat“, Gott rettet, erweitert, um das Zusammenspiel von körperlichen, seelischen und geistigen Voraussetzungen für Heilung zu betonen und die Rolle des Glaubens einzubeziehen
Titelbild des Feldbuches Gersdorff, Ausgabe Bey Hans Schotten zům Thyergarten, Straßburg [1528], im Bestand der U.S. National Library of Medicine, Inv. 2246021R. Bild gemeinfrei.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Heilberufe im Mittelalter
Einfluss der Antike
Einfluss der arabischen Medizin
Klostermedizin
Aufkommen von Spitälern
Berufliche Spezialisierung
Universitäten und akademische Medizin
Zünfte und Regulierung
Zunft der Wasenmeister und Scharfrichter
Bader und Barbiere
Wundärzte
Chirurgen
Anästhesie
Ärzte
Ursprung des Arztberufs
Beginn der modernen ärztlichen Ausbildung
Wissenschaftliche Revolution im 18. Jahrhundert
Ärztliche Reformbewegung im 19. Jahrhundert
Revolutionszeit und Reformen
Entwicklung des Arztberufes in Deutschland
Arztberuf wird zum freien Gewerbe erklärt
Weiterentwicklung der ärztlichen Ausbildung und Berufsordnung
Einführung einheitlicher Prüfungsordnungen
Facharztordnung und Berufsordnung
Bremer Leitlinien 1924
Der Arztberuf heute
Hohe Standards und Verantwortung
Gesellschaftliche Bedeutung
Fazit
Liste der Bader, Wundärzte und Chirurgen in Essingen
Beschreibung der Wundärzte, Chirurgen und Bader
Um 1650 bis 1673 Aygen Jerg (Georg), Bader, Wundarzt und Richter.
Um 1675 bis 1680 Johannes Aygen, Bader und Wundarzt
Ab 1675 bis 1704 Harsch Constantinus Gottfried, Schulmeister, Chirurg und Bader
Um 1680 bis 1733 Roschmann Johann Joseph, Bader und Wundarzt, Schullehrer in Lauterburg
Ab 1700 bis 1744 Harsch Johann Gottfried, Chirurg, Bader und Wundarzt
Das Badhaus
Ab 1704 bis 1754 Mößner Leonhard, Bader und Wundarzt
Ab 1726 bis 1733 Harsch Johann Wolfgang, Chirurg und Bader
Ab 1728 bis 1771 Harsch Johann Jakob, Chirurg und Bader
Gebührenverzeichnis 1759/1760
Ab 1760 bis 1830 Bahrt (Barth) Matthäus, Chirurg
Ab 1740 bis 1778 Mößner Georg Adam, Bader und Schulmeister
1750 bis 1774 Mößner Maximilian, Chirurg
Vor 1780 bis 1818 Borst Johann Caspar, Chirurg
1782 bis 1815 Mößner Johann Georg, Chirurg und Geburtshelfer
Vor 1797 bis 1821 Majer Georg Balthasar, Bader und Chirurg
Vor 1800 bis 1820 Bahrt (Barth) Friedrich Carl, Chirurg
Um 1790 bis 1829 Widmann Melchior, Schulmeister, Chirurg und Barbier
1809 Sahlfelder Johann Caspar, Königlich-Sächsischer Generalstabsarzt
Vor 1818 bis 1876 Forster Franz Anton, Chirurg
1845 bis 1872 Sandherr Philipp Wilhelm Johann, Wundarzt und Geburtshelfer
Vor 1854 bis 1857 Forster Alois Christian, Wundarzt
1847 Oberamtswundarzt Dr. Christlieb in Aalen und Chirurg Knaus von Heubach
Remswasser als Medizin
Vor 1873 Wundarzt Friedrich Andreas Sandherr
1885 bis Januar 1886 Raisch Johann Georg, Chirurg und Geburtshelfer
1886 bis 1893 Kappler Gustav Adolf, Wundarzt
1893 bis 1894 Schurr Johann Robert, Wundarzt, Chirurg, Leichenschauer
1894 bis 1896 Glaser Johann Ludwig, Wundarzt, Leichenschauer
1896 Vollmar Roman, Wundarzt
Um 1905 Braun Caspar, Wundarzt
1905 Ärzte im Oberamt Aalen
Ärztliche Versorgung während der beiden Weltkriege
1895 bis 1956 der Oberlehrer und Homöopath Georg Wachter
Bemerkungen zur ärztliche Versorgung nach 1945
Um 1945 kam Frau Dr. med. Ehlers nach Essingen
Ab Ende der 1950er Jahre Dr. med. Alois Brenner
Praxis Dr. med. Ahmed Esber
1986 bis 2024 Allgemeinmediziner Rainer M. Gräter
1991 bis 2022 Dr. med. Wolfgang Merkle, Internist
Ab 1. Januar 2025 startet die Remspraxis mit Dr. med. Marvin Meßemer und Dr. med. Lennart Kirchhoff
Medizinische Versorgung in Lauterburg
Dr. Merkle aus Heubach
Dr. med. Hugo Karl Wilhelm Cloß
Dr. Franz Keller aus Heubach
Krankheit, Unfälle, Tod- einige Beispiele aus Lauterburg
Hebammen und Wehmütter im Wandel der Zeit
Antike
Mittelalter und Frühe Neuzeit
Woellwarth-Degenfeldsche Kirchenordnung von 1729
Kapitel XII der Kirchenordnung - Von Hebammen und Weh-Müttern
Kapitel XIV der Kirchenordnung – von Begräbnissen
Kirchenweg und Totenweg in sehr schlechtem Zustand
Gebührenverzeichnis für Hebammen aus dem Jahr 1760
Ab dem 19. Jahrhundert
Beschreibung einiger Hebammen und Wehmütter in Essingen
Ursula Stegmayer (* 1589 † 13.08.1669),
Maria Scheuerle (* 1644 † 28.04.1710)
Bedingungen für die Aufnahme von Schwangeren im Klinikum Tübingen
Philippina Königer (* 07.02.1776 † 21.09.1837)
Barbara Bäuerle
Hebamme Holz
Maria Gäbler (* 04.01.1813 † 15.12.1881)
Ursula Veronika Helmer (* 07.01.1855 † 11.12.1895)
Hebamme Albrecht
Dorothea Sturm (* 24.10.1867)
Marie Barth (* 13.06.1893)
Beschreibung einiger Hebammen in Lauterburg
Hebamme Deininger tauft am 8. Dezember 1741 ein Kind
Hebamme Maria Schwarz tauft am 8. Juli 1741 ein Kind
Chirurg und Geburtshelfer Knauß aus Heubach
Walpurga Geißler
Margarethe Unger
Margarethe Rothmann
Anna Wirth
Rosine Baßler
Maria Schmidt
Marie Baur aus Bartholomä Aushilfshebamme in Lauterburg
Elisabeth Krieg gemeinsame Hebamme für Bartholomä und Lauterburg
Nachbemerkung
Vorwort
Die Geschichte der Medizin ist untrennbar mit der Entwicklung von Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur verbunden. Das vorliegende Buch nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte – von den Anfängen der Heilberufe im Mittelalter bis zur Herausbildung des modernen Arztberufs in Deutschland. Ausgangspunkt ist das Wirken der Freiherren von Woellwarth, eines süddeutschen Adelsgeschlechts, das seit dem 14. Jahrhundert in Ostwürttemberg ansässig ist. Bereits 1538 übernahmen sie das Patronat der Essinger Kirche und setzten mit der Einführung der Reformation um 1565 wichtige Impulse für die kirchliche und soziale Infrastruktur der Region. Mit der Erlassung von Dorfordnungen sowie einer eigenen Kirchenordnung 1729 gestalteten sie maßgeblich das Gemeinwesen in Essingen und Lauterburg. Die Freiherren von Woellwarth prägten also maßgeblich die regionale Entwicklung; auch die Geschichte der Medizin blieb von ihrem Einfluss nicht unberührt.
Das Buch zeichnet die Entwicklung der Heilberufe nach, von der Klostermedizin und dem Einfluss antiker sowie arabischer Wissenssysteme über die Entstehung der Spitäler bis hin zur beruflichen Spezialisierung und der Gründung von Universitäten. Es beleuchtet die Rolle von Zünften, Badern, Barbieren, Wundärzten, Chirurgen und Hebammen ebenso wie den Wandel der ärztlichen Ausbildung und die wissenschaftlichen Revolutionen, die das Berufsbild des Arztes nachhaltig veränderten.
Besonders hervorgehoben wird die Entwicklung in Deutschland, wo der Arztberuf im 19. Jahrhundert zum freien Gewerbe erklärt wurde und eine neue Ära der medizinischen Selbstständigkeit und Professionalisierung begann.
Dieses Buch lädt dazu ein, die Ursprünge und den Wandel der Heilberufe im Spiegel der Geschichte neu zu entdecken und zu verstehen, wie eng Fortschritt und Tradition miteinander verflochten sind.
Essingen, im August 2025
Die Freiherren von Woellwarth
Die Freiherren von Woellwarth gehören zu den südwestdeutschen Adelsgeschlechtern, die seit dem Spätmittelalter in ihrem Territorium reichsunmittelbar herrschten. Dies bedeutet, dass sie direkt dem Kaiser unterstellt waren und keinen weiteren Landesherren über sich hatten. Ihre Herrschaft erstreckte sich ab dem 15. Jahrhundert bis zur Eingliederung ihres Hoheitsgebietes im Zuge der napoleonischen Neuordnung Württembergs im Jahre 18061 über wenige Dörfer vor allem im heutigen Ostalbkreis.
Karte Essingen, Lauterburg, Hohenroden
2
1401 erwarb Georg von Woellwarth († 1409, #10)3 das Gut Schneckenroden, später Hohenroden genannt4. Unter seinen Söhnen Georg der Ältere († 1434, #11) und Georg der Jüngere († 1442, #12) teilte sich die Familie in zwei Linien. Die ältere Linie hatte ihren Sitz in Laubach und Fachsenfeld. Diese ältere Linie erlosch mit dem Tod von Karl Reinhard von Woellwarth-Laubach (1818-1870, #119) im Jahre 1870 im Mannesstamm.
Die jüngere Linie der Freiherren von Woellwarth konnte im 15. und 16. Jahrhundert am Nordrand des Albuchs zwischen den Reichsstädten Gmünd und Aalen, der Fürstpropstei Ellwangen und der württembergischen Herrschaft Heidenheim ein Kleinstterritorium5 ausbilden, dessen Mittelpunkt bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 1732 die Lauterburg war; danach wurde die Marktgemeinde Essingen Mittelpunkt und Verwaltungssitz des autonomen Kleinstaates innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Freiherren von Woellwarth waren als Landesherren nicht nur für kirchliche und schulische Belange verantwortlich, sondern auch für das medizinische Versorgung ihrer Untertanen.
Im Zeitalter des Feudalismus war die medizinische Versorgung der Landbevölkerung eine Aufgabe, die zum Teil von der jeweiligen Herrschaft übernommen wurde. Ein wichtiges grundherrschaftliches Regulierungsinstrument für eine gut funktionierende Gesellschaft war neben den Dorfordnungen, der Gerichtsbarkeit, der geistlichen Betreuung durch den Pfarrer und der schulischen Betreuung durch den Schulmeister die medizinische Grundversorgung der Untertanen. Dies entsprach dem damaligen Selbstverständnis von Adel und Obrigkeit, die für das leibliche und seelische Wohl ihrer Leute verantwortlich waren. Die Herrschaft Woellwarth war hier vorbildlich.
Pfarrer und Schulmeister waren meist die ersten Ansprechpartner bei Krankheiten, zumal der Pfarrer nicht nur für die Seelsorge, sondern auch für die Vermittlung medizinischer Hilfe zuständig war. In besonderen Fällen arbeiteten Geistliche, Ärzte und Hebammen zusammen. Im Herrschaftsgebiet der Freiherren von Woellwarth waren verschiedene Berufsgruppen für die Gesundheit der Bevölkerung zuständig:
Bader übernahmen einfache medizinische Behandlungen wie das Schröpfen, das Anlegen von Verbänden und das Ziehen von Zähnen.
Wundärzte und Chirurgen waren für medizinische Behandlungen und chirurgische Eingriffe, die über das Können des Baders hinausgingen, zuständig.
Bei besonders schwereren Erkrankungen konnten auch studierte Ärzte konsultiert werden, die jedoch meist nur für wohlhabendere Kreise zugänglich waren.
Hebammen waren für die Geburtshilfe zuständig und spielten eine zentrale Rolle bei der Betreuung schwangerer Frauen und der Neugeborenen.
1 Essingen, Lauterburg und Hohenroden kamen 1806 unter die Landeshoheit von Württemberg. Grundlage dafür ist das Edikt des Kurfürsten Friedrich (ab 1806 König von Württemberg) vom 21.11.1805 (Mediatisierung). Bis dahin war Essingen ein beim Ritterkanton Kocher immatrikulierter Ort. Essingen war damit vom Jahre 1413 bis 1806 woellwarthisch gewesen, also fast 400 Jahre lang (Ev. Pfarramt Lauterburg, KB Lauterburg, Chronik S. 15). In Essingen geschah die Huldigung der bisherigen reichsritterschaftlichen woellwarthschen Untertanen auf König Friedrich I. am 18. Oktober 1806 unter dem württembergischen Kreishauptmann Geheimrat von Bauer aus Ellwangen auf dem hiesigen Schlosshof, Staatsarchiv Ludwigsburg PL 9/13, Büschel 1583, Ordnungsnummer 1105 (nachfolgend StAL PL 9/3, Bü. ON). Vgl. Ute Bitz / Udo Herkert (Bearb.), Archiv der Freiherren von Woellwarth zu Essingen, Amtsbücher und Akten 1475 bis 1966. Findbuch zum Bestand PL 9/3. Masch. Man. Staatsarchiv Ludwigsburg 2003.
2 Undatiert, doch nach dem Kontext in die Zeit um 1700 einzuordnen. Mit freundlicher Genehmigung durch das Hauptstaatsarchiv Stuttgart (nachfolgend HStAST) A 153 Büschel 218.
3 Die hinter den Namen der Mitglieder der Familie von Woellwarth in Klammer angegebene Nummer, jeweils mit (#) beginnend, entspricht der Nummerierung in: Albrecht Freiherr von Woellwarth (Bearb.), Die Freiherren von Woellwarth. Stammtafeln. Aalen 1949. ND der 2. Auflage 1979.
4 Wolf von Woellwarth, Schloss Hohenroden. Sechshundert Jahre im Besitz der Freiherren von Woellwarth, Hohenroden 2001; Hans-Wolfgang Bächle, Das Adelsgeschlecht der Woellwarth, Schwäbisch Gmünd 2010; Heinz Bohn, Acht Burgen und Schlösser sowie ein Traumschloss in den ehemaligen woellwarthschen Orten Essingen und Lauterburg, Norderstedt 2. ergänzte Auflage 2020, S. 81-121; Torsten Krannich u.a., Evangelische auf der Ostalb. Ein Streifzug durch die Reformationsgeschichte des Dekanats Aalen, in: Evangelische Kirchenbauten im Dekanat Aalen, herausgegeben vom Evangelischen Kirchenbezirk Aalen, Schwäbisch Gmünd 2016, (158-209) 181-187; Gabi Gokenbach u.a., Die Epitaphe der Freiherren von Woellwarth, Essingen 2020.
5 Das Heilige Römische Reich war geprägt von einer Vielzahl von Kleinterritorien, die oft nur aus wenigen Städten, Dörfern oder Landstrichen bestanden. Diese Territorien hatten unterschiedliche Rechtsformen, waren politisch eigenständig, aber dennoch Teil des Reichsverbandes. Ein Beispiel für ein solches Kleinterritorium ist das Herrschaftsgebiet der Freiherren von Woellwarth. Ein kleines, aber funktionierendes Territorium innerhalb des Reiches, welche die Adelsfamilie durch geschickte Diplomatie und Verwaltung sicherte.
Die Heilberufe im Mittelalter6
Die Entstehung der Heilberufe im Mittelalter7 war ein komplexer Prozess, der stark von sozialen, religiösen und wissenschaftlichen Entwicklungen geprägt wurde. Hier ein kurzer Überblick:
Einfluss der Antike
Nach dem Zerfall des Römischen Reiches ging viel medizinisches Wissen verloren. Die antike Humoralpathologie (Vier-Säfte-Lehre) von Hippokrates8 und Galenos9 blieb jedoch ein zentraler Bestandteil der medizinischen Theorie. Dieses Wissen wurde in Klöstern bewahrt und weitergegeben.
Einfluss der arabischen Medizin
Die arabische Welt spielte eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung und Weiterentwicklung antiken Wissens. Werke von Avicenna10 und anderen Gelehrten wurden ins Lateinische übersetzt und beeinflussten die europäische Medizin nachhaltig.
Ein weiterer arabischer Arzt ist Abū Zaid Hunain ibn Ishāq al-ʿIbādī (* 808 in Hira im heutigen Irak; † 873 in Bagdad). Er war ein christlich-arabischer Gelehrter, Übersetzer und Arzt. Sein latinisierter Name lautet Johannitius. Er verfasste das älteste arabische Lehrbuch der Augenheilkunde11.
Darstellung des menschlichen Auges nach Hunain ibn Ishāq. Bild gemeinfrei
Klostermedizin
Im Mittelalter war die Gesundheitsvorsorge stark von der christlichen Fürsorge geprägt, wobei Klöster als Zentren der Krankenpflege und Heilkunst fungierten. Mönche und Nonnen verfügten über grundlegende Kenntnisse zur Heilwirkung von Kräutern und Heilpflanzen. Klosterschulen wie die von Fulda, Reichenau oder St. Gallen waren für die medizinische Bildung von erheblicher Bedeutung12. Die medizinische Theorie basierte überwiegend auf der antiken Humoralpathologie, ergänzt durch lokale Volksmedizin. Die hygienischen Bedingungen waren jedoch schlecht, Seuchen wie die Pest13 und andere Infektionskrankheiten14 forderten regelmäßig zahlreiche Opfer.
Öffentliche Spitäler entstanden, in denen Arme, Kranke und Pilger unentgeltlich versorgt wurden, während wohlhabendere Bürger sich private Fürsorge leisten konnten.
Aufkommen von Spitälern
Mit der Christianisierung Europas entstanden Spitäler, die oft von kirchlichen Institutionen betrieben wurden. Zu den ältesten noch bestehenden Spitälern in Deutschland zählen das 1267 erstmals erwähnte Hospital zum heiligen Geist in Frankfurt am Main, das 1308 gestiftete Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar15 sowie das 1316 gestiftete Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg.
Die Aufgaben der Spitäler waren mannigfaltig und basierten auf den Werken der Barmherzigkeit: Speisung, Aufnahme und Bekleidung der Armen, Beherbergung der Fremden, Pflege der Alten und Kranken sowie Bestattung der Toten. Kommunalisierung, Verpfründung (d. h., die Insassen kauften sich mit der Erwerbung von Pfründen ein) und Spezialisierung waren die Tendenzen, die das Spitalwesen seit dem 14. Jahrhundert in den Städten bestimmten16.
Berufliche Spezialisierung
Im Hochmittelalter begann die Differenzierung der Heilberufe. Bader und Barbiere übernahmen einfache medizinische Aufgaben wie Aderlass, Schröpfen und Wundversorgung. Hebammen spezialisierten sich auf Geburtshilfe. Wundärzte führten chirurgische Eingriffe durch. Akademisch ausgebildete Ärzte (Medici) konzentrierten sich auf die Diagnose und Behandlung von Krankheiten, oft basierend auf der Humoralpathologie.
Gersdorff Feldbuch. Bild gemeinfrei
Universitäten und akademische Medizin
Ab dem 12. Jahrhundert entstanden in Europa Universitäten17, die eine formale medizinische Ausbildung anboten. Zentren wie Salerno und Montpellier wurden berühmt für ihre medizinischen Fakultäten. Hier wurden antike und arabische medizinische Texte studiert und weiterentwickelt.
Zünfte und Regulierung
Im Spätmittelalter wurden Heilberufe zunehmend reguliert. In Württemberg wurden die Heilberufe durch die Große Kirchenordnung Herzog Christophs von 1559 unter die Aufsicht behördlicher Gremien gestellt. Es dauerte aber noch fast 100 Jahre, bis auch die württembergische Handwerkerchirurgie eine eigene Zunft bildete (1658), mit Zunftmeistern, Gebührenordnung u.v.a.
Durch das Zunftwesen wurde ein Dreiklassensystem festgelegt, bei welchem zur niedersten Klasse (Chirurgi impuri18) die Bader, Schröpfer (= Skarifikanten), Scherer und Zahnextrahierer zählten. Diese waren nicht befugt, Lehrlinge auszubilden. Zur mittleren Klasse gehörten die Barbiere (Chirurgi puri) und die Rasierer. Zur oberen Klasse zählten die Operateure, Stein- und Bruchschneider, die „als Meister mit dem Wundmesser besonders umgehen können", sowie die Geburtshelfer (Accoucheure).
Nach der neunjährigen Lehr-, Gesellen- und Wanderzeit wurde das Examen abgelegt. Aber nicht etwa vor Zunftgremien, sondern vor dem staatlich verordneten Prüfungsausschuss, besetzt von Stuttgarter Leibärzten, verstärkt durch einen Chirurgus juratus. 1814 wurde in Württemberg das Zunftwesen der Chirurgen wieder aufgehoben.
Aus den Kirchenbüchern und den woellwarthschen Akten ist leider nicht ersichtlich, welche Ausbildung die hier tätigen Heilkundigen hatten. Der akademische Arzt wurde in den meisten Fällen als Physicus oder Medicus bezeichnet. Aber auch mancher Wundarzt bezeichnete sich als Medicus, für die es eine besondere Gebührenordnung mit 15 Leistungspositionen gab.
Ausschnittt aus dem Gebührenverzeichnis für Malefiz, Chirurgen, Hebammen StAL PL 9-3 Bü 1486 ON 1427.
Erwahnt sei schließlich noch die