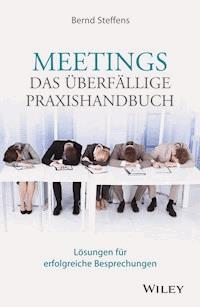
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bernd Steffens bietet ein ganzheitliches und umfassendes Buch zum Thema Meetings. Ausgehend von der vorhandenen Führungs-Un-kultur in Unternehmen werden die Möglichkeiten der Entwicklung einer optimalen Besprechungskultur dargestellt, in der die Rahmenbedingungen einerseits und die Person des Moderators im Umgang mit Autorität, Emotionen, Konflikten und geeigneten Methoden zur kooperativen Entscheidungsfindung andererseits zentral sind. Denn das beste Handwerkszeug taugt nichts, wenn die Besprechungskultur nicht stimmt und die Haltung des Moderators ungeeignet ist. Themen sind weiterhin die Auseinandersetzung mit bekannten Meeting-Mythen, die richtige Planung und Entscheidungsprozesse.
Meetings werden in dem Maße besser, wie Führungskräfte / Moderatoren diese nicht über autoritären Stil (Befehlsketten, Menschen als Maschine) führen, sondern als soziales Netzwerk ernst nehmen, in dem auch emotionale Belange moderiert und zur Auflösung geführt werden.
Im Buch wird lösungsorientiert das Grundproblem angegangen, dass das Verhalten der Teilnehmer oft von Angst (vor Misserfolg, vor Autorität, vor Gesichtsverlust), Ärger (über Abteilungs- und Claimdenken, über eigene unberücksichtigte Bedürfnisse, über das Verhalten anderer) und Eitelkeiten (Beiträge dienen der Selbstdarstellung, Rechthaberei herrscht vor, mangelnde Vorbereitung wird maskiert) geprägt ist. Wird damit konstruktiv umgegangen, helfen auch die genauso wichtigen Handwerkszeuge, zum Beispiel zur Entscheidungsfindung, damit das Meeting zum gewünschten Erfolg führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
1. Auflage 2016
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
© 2016 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung: init GmbH, Bielefeld
Coverfoto: Tired Corporate Personnel Officers At Table© Andrey [email protected]
Satz: inmedialo Digital- und Printmedien UG, Plankstadt
Print ISBN: 978-3-527-50850-1
ePub ISBN: 978-3-527-80800-7
mobi ISBN: 978-3-527-80801-4
Für Maria SophiaundBenjamin, Max, Jonathan, Hannes, Deborah
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Teil I Ineffektive Meetings und erste Ansätze zu deren Überwindung
1. Was eigentlich ist ein Meeting?
2. Frustveranstaltung Meeting – eine Ist-Beschreibung
Das Meeting als Profilierungsplattform?
Effizienz von Meetings, oder: Controlling innerbetrieblicher Kommunikationsprozesse
3. Meeting-Mythen
Mythos 1: Rationalität und Sachlichkeit herrschen im Meeting vor
Mythos 2: Anwesenheit im Meeting signalisiert Interesse
Mythos 3: Kooperation herrscht vor
Mythos 4: Regeln müssen her
Mythos 5: Teilnehmer haben nach dem Meeting den gleichen Wissensstand
Teil II Eine Skizze erfolgreicher Meetings
4. Ein veränderter Blick auf die Menschen im Meeting
Das Meeting ist ein soziales System
Die (noch unpopuläre) dialektisch-kritisch-integrierende Vorstellung vom Menschen
Vorstellungen vom Menschen und deren Wirkungen auf Meetings
5. Konstruktive Haltungen der Teilnehmer im Meeting
Haltung: Ich oder Du
Exkurs zur Unterscheidung von Introversion und Extraversion
Haltung: Meeting-Team oder Meeting-Gruppe
Haltung: Kameradschaft oder Freundschaft oder Feindschaft
Zentrale Haltung: Achtsamkeit und Aufmerksamkeit
Teil III Ergebnisorientierte Moderation – das A und O im Meeting
6. Der Moderator – fit und hellwach
Was meint Moderation?
Optimale Moderation
Exkurs zum Thema Vertrauen
Einige Begabungen – ein Muss für jeden Moderator!
Teil IV Unterstützendes Handwerkszeug
7. Das lästige Drumherum – Planung und Organisation
Vier Meeting-Typen auseinanderhalten
Welchen Zweck verfolgt das Meeting?
Rollenverteilung im Meeting
Die Agenda
Teil V Die Qual der Wahl – Entscheidendes zum Thema Entscheiden
8. Formales zum Thema Entscheiden
Typisches Vorgehen bei Entscheidungen
Entscheidungen sind Teil unserer Handlungen
Neurobiologisch und neuropsychologische Betrachtung von Entscheidungen
Der Entscheidungsprozess
Rückblickende Entscheidungsbewertung
9. Angst, Einschüchterung und Drohung führen zu schlechten Entscheidungen in Meetings
Menschen mit einer grundsätzlichen Angst, zu entscheiden
Menschen, die sich bei ihren Entscheidungen von Drohungen beeinflussen lassen
Menschen, die sich bei ihren Entscheidungen von Autorität einschüchtern lassen
10. Arten der Entscheidungsfindung im Meeting – welche wollen wir?
Die hierarchische Entscheidung
Die demokratische Entscheidung
Die kooperative Entscheidung
Die delegierte Entscheidung
Die konsensuelle Entscheidung
11. Debatte, Diskurs, Diskussion oder Disput?
Das geht tatsächlich: Wie kommen wir trotz kontroverser Meinungen zu einem Konsens?
Exkurs zum Bedingungsdenken
12. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein – alles andere ist von Übel
Anmerkungen
Anhang
Agenda
Geladene Teilnehmer
Checkliste für den Einladenden
Checkliste für den Moderator
Checkliste für den Protokollführer
Checkliste für den Zeitmanager
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Meetings sind heute aus Unternehmen nicht mehr wegzudenken, wenn es um Informationsaustausch und das Zusammentragen von Know-how geht.
Andererseits reagieren die meisten Zeitgenossen schon mit kritischem Stirnrunzeln, wenn sie nur an das Thema Meeting denken.
Das Thema Meeting fristet in unzähligen Unternehmen ein Schattendasein. Die darin schlummernden wertschöpfenden Potenziale sind kaum im Bewusstsein der Verantwortlichen. Dass wirkliche Kooperation im Meeting nicht nur Kosten spart, sondern einen ökonomischen Mehrwert für das Unternehmen erzeugen kann, bestreitet heute kaum noch jemand. Doch wie eine praktische Umsetzung in Meetings aussehen kann, ist vielen nicht klar.
Professionelles Meeting-Management ist mehr als Besprechungsregeln herauszugeben oder Sanktionsmechanismen einzuführen oder Appelle an die Betroffenen zu richten.
Wenn die Kultur einer Zusammenarbeit im Unternehmen analysiert werden will, sind Meetings hierfür ideal. Und gleichzeitig sind Meetings eine entscheidende Stellschraube, wenn es darum geht, im Unternehmen die Zusammenarbeit zu optimieren. Dafür ist allerdings eine ganzheitliche Betrachtung dessen, was ein Meeting ausmacht, wesentlich.
Im Internet findet sich keine Theorie von Meetings – zumindest habe ich eine solche nicht finden können.
In diesem Buch wird also der Versuch unternommen, Elemente zu beschreiben, die für eine ganzheitliche Betrachtung dessen, was Sinn und Mehrwert eines Meetings ausmachen, nötig sind.
In diesem Buch wird davon ausgegangen, dass Meetingkultur ein Teil der Führungs- und Unternehmenskultur ist. Meetings optimieren, ohne dabei die Vorstellung von Menschen – das im Unternehmen geltende Mitarbeiter-Bild – im Blick zu haben, muss scheitern.
Welche Vorstellung vom Menschen prägt unsere Zusammenarbeit im Meeting?Mit welcher Haltung kommen die Leute in ein Meeting? Was kann eine passende Haltung sein?Mit welcher Einstellung wird durch das Meeting geführt und moderiert? Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sind für eine effektvolle Moderation erheblich?Welche soziodynamischen Prozesse wollen wir im Meeting? Wie kommen wir weg vom Konkurrenzdenken hin zu mehr Kooperationsbereitschaft?Dieses Buch wendet sich an Manager, Führungskräfte aller Hierarchieebenen, Moderatoren und nicht zuletzt an Personal- und Organisationsentwickler. Letztere können in der Analyse und Entwicklung der Meetingkultur einen entscheidenden Ansatz finden, im Unternehmen Interaktionsmuster zu verändern.
Sie erhalten Tipps und Anregungen, Meetings für das Unternehmen und die an ihm Beteiligten nachhaltig und langfristig zu optimieren. Sie werden mehr als einmal auch über sich selbst und ihre Haltung zur Zusammenarbeit mit Kollegen reflektieren. Diese Selbstreflexion ist ausdrücklich gewünscht – soll doch dadurch deutlich werden, dass es auch immer an uns, jedem Einzelnen liegt, was aus Meeting gemacht wird. Denn: Wir sind das Meeting!
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Buch stets die männliche Schreibweise verwendet und auf die Ergänzung der weiblichen Schreibweise verzichtet. Damit ist keine Wertung verbunden! Gemeint sind stets Personen des weiblichen und männlichen Geschlechts.
Ihnen, den Leserinnen und Lesern, wünsche ich eine spannende Lektüre und viele Ansätze zu einer Weiterentwicklung Ihrer Zusammenkünfte in Meetings.
Über Anregungen und Verbesserungsvorschläge freue ich mich. Sie erreichen mich über [email protected] oder über den Verlag.
Einleitung
Viele Menschen erleben Meetings als stresserzeugende zeitintensive überflüssige Veranstaltungen: Der Gang ins Meeting wird dann irgendwann zur Tortur. Und mit der Zeit geht den betroffenen Menschen die Begeisterung für Meetings verloren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Meeting im Wirtschaftsunternehmen, im Parteigremium, im Golf-Club, im Sachausschuss, im Kaninchenverein, im Kindergarten, im Gemeinderat, in der Hilfsorganisation oder in der Schule oder einer anderen Institution oder Organisation handelt. Überall werden die gleichen Klagen laut. Interessant wäre, die Frage zu klären, warum sich Menschen in Institutionen wie Behörden, Vereinen und Unternehmen solche Meetings schufen, die ihrer psychischen, emotionalen und sozialen Grundausstattung so wenig entsprechen.
In den beiden letzten Jahrzehnten klagen Führungskräfte in Unternehmen und Organisationen zunehmend über Zeitknappheit und Erfolgsdruck[1]. Druck und Stress betreffen ebenso die Mitarbeiter[2]. Ursache hierfür sind Veränderungen durch Globalisierung beziehungsweise Internationalisierung und dadurch veränderte nationale und internationale Gesetzgebungen, die das Wirtschaften und Managen in Profit- und Non-Profit-Unternehmen massiv beeinflussen. Außerdem spielen kontinuierliche Veränderungen vor allem im Bereich der computergestützten Technologien eine Rolle. In immer schnellerem Tempo kommen neue Produkte auf den Markt, die das Vorgängerprodukt in den Schatten stellen oder überflüssig machen. Denken Sie nur an Schreibmaschinen, Postbriefe, Faxgeräte: Wer braucht die noch? In der Konsequenz verändert sich die Marktsituation immer kurzfristiger und damit die Produktentwicklungen, die Produktionsabläufe, die Anforderungen an die Arbeitsplätze und die Mitarbeiter- und Kundenanforderungen.
Stabile und konstante Größen im Unternehmen, die optimiert werden und sich danach langfristig nicht ändern, gibt es nicht mehr: Heute sinnvolle Hierarchien, Strukturen und Unternehmenskulturen sind morgen unbrauchbar oder wertvernichtend. Das Know-how und Können, die zur Verfügung stehenden Informationen und die zunehmend knappen Ressourcen in Unternehmen werden ständig neu umverteilt. Neben den Ressourcen Geld und Fachpersonal entscheidet dabei eine andere immer knapper werdende Ressource über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen und Organisationen: die Ressource Zeit[3]. Etwaige Wettbewerbsvorteile durch Innovationen verlieren in immer kürzerer Zeit an Wert. Denken Sie beispielsweise an Handys, die von heute auf morgen durch die Innovation Smartphone ihren Wert verloren haben. Der nächste Schritt wird der sein, dass das Smartphone seinen Wert verliert. Wodurch? Wer weiß?
Wer unter diesen Rahmenbedingungen und in diesem ‹Zeitwettbewerb› bestehen will, muss rasant schnell auf interne und externe Veränderungen reagieren. Die Verbesserung der Managementmethoden und Führungsinstrumente, der Verfahren in Produktion und Verwaltung, sowie der Steuerung und Planung allein reichen dafür bei Weitem nicht mehr aus. Das intellektuelle Kapital im Unternehmen einerseits sowie die Art und Weise der Kommunikation im Unternehmen zwischen Mitarbeitern und Führungskräften und zum Kunden und Lieferanten hin andererseits sind heutzutage entscheidend für die Gewinne und Verluste[4] in Unternehmen.
Unternehmer, die das verstanden haben, richten ihr Unternehmen auf die in ihm arbeitenden Menschen aus. Mehr auf die handelnden Personen orientierte Unternehmen (hier ist der Mitarbeiter im Wesentlichen Know-how-Träger, in den möglichst investiert werden sollte) haben gegenüber kapitalorientierten Unternehmen (hier ist der Mitarbeiter im Wesentlichen ein Kostenfaktor, der möglichst gering gehalten werden sollte) deutlich größere Überlebenschancen im Markt, denn: Am Know-how der Mitarbeiter orientierte Wettbewerbsvorteile sind nicht einfach kopier- und übertragbar, demnach nachhaltiger und beständiger[5]. Dieser Vorteil wächst drastisch an, wenn Unternehmen Kommunikationssysteme fördern, die insbesondere die menschlichen Fähigkeiten des Sprechens und Zuhörens nutzen und dadurch in Bezug auf Reaktionsfähigkeit und Lernfähigkeit schnell und effizient sind.
Wenn der skizzierte Alltag von Unternehmen bis hierher stimmig ist, müssten Quantität und Qualität von Meetings auf der Prioritätenliste ziemlich weit oben stehen. In gewisser Weise faszinierend ist, dass das genaue Gegenteil der Fall ist.
Führungskräfte sollen wertschöpfend tätig sein. Dafür müssen sie Ziele formulieren und delegieren, entscheiden und kontrollieren, Menschen entwickeln und fördern[6]. Es gibt unzählige Situationen im beruflichen Alltag, in denen alle Beteiligten in Kommunikation miteinander treten müssen. Denn Kommunikation ist eine notwendige Voraussetzung für alle sozialen Prozesse im Unternehmen[7]. Und Unternehmen sind, zumindest solange dort Menschen und nicht Roboter arbeiten, eine auf Kooperation ausgerichtete soziale Veranstaltung.
Das verwundert, da eine zentrale Aufgabe der Führungskräfte doch die ist, konstruktiv Einfluss auf die zu führenden Mitarbeiter zu nehmen. Bei der oben beschriebenen Kurzfristigkeit der Veränderungen von Produkten und Marktsituationen muss die innerbetriebliche soziale Kommunikation zukünftig zwangsläufig noch mehr an Bedeutung gewinnen. Denn sie ist unverzichtbare Voraussetzung zur Sammlung benötigter Informationen, also für effektives Management[8].
Laut einer Studie sehen 89 Prozent der interviewten Führungskräfte interne Kommunikation als die entscheidende Stellschraube für produktive Führung und optimale wirtschaftliche Ergebnisse[9]. Tendenz steigend.
Eine betriebswirtschaftliche Binsenweisheit ist die, das die Qualität von Entscheidungen unter anderem von der Qualität und Quantität der zur Verfügung stehenden Informationen abhängt. Doch Verfügbarkeit von Informationen alleine reicht nicht aus. Noch entscheidender ist, dass die Informationen knapp und präzise sind, schnell und ohne Verlust weitergeleitet werden, zur richtigen Zeit am richtigen Ort im richtigen Kopf zur Verfügung stehen, um sie zu nutzen. Und wieder sind wir bei der Wichtigkeit der innerbetrieblichen sozialen Kommunikation angelangt.
Haben Sie den Eindruck, im Job nicht ausreichend Informationen zu erhalten? Wohl eher nicht. Menschen im Unternehmen haben in aller Regel kein Informationsdefizit. Sie leiden im Gegenteil unter einer nicht mehr zu bewältigenden Informationsflut. Das Problem der Menschen in Unternehmen heute ist kein Informationsdefizit, sondern ein deutliches Kommunikationsdefizit[11].
Wissen Sie eigentlich, welche Informationen Ihre Kollegen von Ihnen benötigen, um optimal wertschöpfend im Unternehmen tätig sein zu können?Wissen Ihre Kollegen, welche Informationen Sie von denen benötigen, um optimal wertschöpfend im Unternehmen tätig sein zu können?Wenn Sie beide Fragen spontan mit ‹Nein› beantworten, sind sowohl Sie als auch Ihre Kollegen orientierungslos, was den Umgang mit der Informationsflut angeht. Welche brauchen Sie? Welche sollten Sie weiter geben?
Wie gesagt: die soziale Kommunikation lässt zu wünschen übrig. Der klassische und bis heute typische Raum für soziale und koordinative Kommunikation sind Meetings.
1. Was eigentlich ist ein Meeting?
Die Begriffe Sitzung, Besprechung und Meeting werden sowohl in Unternehmen als auch in der Literatur weitestgehend gleichbedeutend verwendet. Was die Verwendung im deutschen Sprachraum angeht, sind diese Bezeichnungen untereinander austauschbar. Wenn in diesem Buch durchgängig die Bezeichnung Meeting verwendet wird, dann deshalb, weil dieser der englischen Sprache entlehnte Begriff im deutschsprachigen Raum weit verbreitet und selbstverständlich geworden ist. Die Bezeichnung Meeting gilt im allgemeinen Bewusstsein als progressiv und modern, die Bezeichnung Besprechung gilt als veraltet.
Regelrecht unmöglich ist es dagegen, in der Literatur eine auch nur im Ansatz einheitliche inhaltliche Füllung oder gar Definition dieser Begriffe zu finden.
Meeting leitet sich vom englischen Verb to meet ab, was so viel bedeutet wie: jemanden treffen, sich begegnen, jemanden kennenlernen, aneinanderstoßen, aneinander geraten, sich auseinandersetzen. Synonyme für die Bezeichnung Meeting können sein: Beratung, Konferenz, Sitzung, Zusammenkunft, Zusammentreffen, Unterredung, Besprechung, Briefing, Jour fixe, Konsultation, Abstimmung, Veranstaltung, Tagung, Symposium, Kongress, Treff, Treffen, Versammlung, Pourparler, Session … Die Liste lässt sich beliebig weiterführen.
Ein Meeting oder eine Besprechung ist unter anderem ein ausführliches Gespräch über eine bestimmte Sache oder Angelegenheit[12] und bezieht sich in Verbindung mit Verben wie ›anberaumen‹, ›durchführen‹ oder ›abhalten‹ zumeist auf die Arbeitswelt[13] und Organisationen.
Vereinfacht ausgedrückt ist demnach ein Meeting ein zielgerichtetes Zusammentreffen mehrerer Personen.
In der vielbeachteten und häufig zitierten Studie von Monge, McSween und Wyer wird Meeting verstanden als
»a scheduled gathering of three or more people to conduct business relevant to their organization«[14].
Die Studie sieht eine Mindestanzahl von drei Personen vor. Das macht deshalb Sinn, weil dann soziodynamisch in der Zusammenarbeit von einem Team oder einer Gruppe ausgegangen werden kann. Ab drei Personen kann sich nämlich eine typische Team- oder Gruppendynamik entwickeln[15] und mit ihr Muster, nach denen bestimmte Abläufe und Verhaltensweisen erfolgen. Damit sind Meetings ganz klar von Zweiergesprächen zum Beispiel zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem zu unterscheiden[16], die sich durch eine eigene (Paar-)Dynamik auszeichnen.
Meetings sind dann auch tunlichst abzugrenzen von Konglomeraten. Damit sind heterogene Zusammenkünfte von Menschen gemeint, zwischen deren Einzelinteressen keine gemeinsamen leistungsmäßigen Zusammenhänge bestehen: wie beispielsweise eine Menschenansammlung an der Kasse beim Einkauf im Supermarkt. Oder an einer Bushaltestelle.
Der Begriff Meeting wird – neben zielgerichteten persönlichen Face-to-Face-Zusammenkünften, bei denen die Teilnehmer zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind – auch für elektronisch unterstützte Telefon-, Video- oder Web-Konferenzen genutzt. Situationen, bei denen sich die Kommunikationspartner virtuell gegenüber sitzen und sich nicht im selben Raum befinden, wären dann also auch unter den Begriff Meeting zu fassen. Bis hierher zusammen gefasst ist ein Meeting
»a focused interaction of cognitive attention, planned or chance, where people agree to come together for a common purpose, whether at the same time and the same place, or at different times in different places«[17].
Face-to-Face-Meeting meint, das mehrere Personen körperlich an einem Besprechungsort präsentisch zusammen kommen, sich gegenseitig mit allen Sinnen wahrnehmen und miteinander interagieren können. Mit Sicherheit werden Telefon-, Video- und Webkonferenzen zukünftig anzahlmäßig zunehmen. Bei dieser Form Konferenz gelten spezielle weitere Aspekte soziodynamischer Art, die – wegen ihrer zusätzlichen Komplexität – in einem eigenen Buch behandelt werden müssten.
Wer von Ihnen mit der Moderation eines Face-to-Face-Meetings oder auch einer Telefonkonferenz vertraut ist, weiß, dass die Moderation einer TelKo wesentlich mehr Anstrengung, Aufmerksamkeit, Disziplin und Konzentration erfordert. Wortbeiträge etwa, die länger als eine Minute dauern, führen bei der TelKo zum Abschalten. Beliebtes Verhalten: Mikrofone werden auf ‹stumm› gestellt, der TelKo-Teilnehmer verlässt (kurzfristig) sein Büro, parallel werden andere Aufgaben erledigt. Wortbeiträge stehen bei einer TelKo oft zusammenhanglos nebeneinander – was zur Herausforderung für Moderator und Protokollant werden kann.
Die fast schon routinemäßig öde verlaufenden Face-to-Face-Meetings in Unternehmen gilt es, in einem ersten Schritt zu analysieren, zu verstehen und zu optimieren. Sind diese Schritte erfolgreich getan, können Telefon- oder Videokonferenzen analysiert, verstanden und optimiert werden. Meine Hypothese ist die, das Video-, Telefon- und Web-Konferenzen erst dann effektiv verlaufen, wenn zuvor den Teilnehmern und vor allem dem Moderator klar ist, unter welchen Umständen ein Face-to-Face-Meeting optimal verlaufen kann.
Außerdem liegen meines Wissens zu Video-, Telefon- und Web-Konferenzen noch keine Langzeitstudien vor, aus denen sich fundierte Optimierungsvorschläge erarbeiten ließen.
Kehren wir wieder zurück zu der Frage, was ein Meeting ausmacht. Einige Studien legen Wert auf die Dauer der Zusammenkunft in einem Meeting. Von mindestens wenigen Minuten[18] bis mindestens fünfzehn Minuten Dauer[19] ist die Rede. Eine bestimmte Mindestdauer als notwendiges Merkmal für Meetings heranzuziehen, lässt sich nur schwer begründen, weil Mindestzeitangaben nicht für jede Situation und jeden Ort und jedes Thema universell gültig sein können.
Meetings in Unternehmen werden dann noch in der Literatur unterschiedlich klassifiziert. Fredmund Malik unterscheidet zwischen der großen, formellen Sitzung, der Routine-Sitzung, den Sitzungen von Arbeitsgruppen, und der kleinen Ad-Hoc-Sitzung[20]. Patrick Lencioni unterscheidet dagegen zwischen dem täglichen Check-In, der wöchentlichen Lagebesprechung, der monatlichen Strategiekonferenz und der vierteljährlichen Manöverkritik[21]. B. Pietschmann unterscheidet zwischen dem Versammlungs-, Entscheidungs-, Motivations-, Informations- und Kreativitätscharakter von Meetings[22]. Vermutlich sollen die Bezeichnungen auf die verschiedenen Zwecke, Inhalte und Zielrichtungen von Meetings hinweisen.
Eine passgenaue Abgrenzung einzelner Meeting-Arten voneinander bleibt ausgesprochen problematisch, da die
»in praxi nicht immer ohne weiteres möglich ist, da in einem Meeting durchaus mehrere der genannten Inhalte thematisiert werden können und die Übergänge fließend sind[23]«.
Zusammengefasst lassen sich in der Literatur für Meetings fünf Kriterien ausmachen:
Anzahl der teilnehmenden Personen, unterschiedliche Sichtweisen dieser Personen zu den Themen,intentionales Zusammenkommen und Zielorientierung, formeller förmlicher Charakter, räumlicher und zeitlicher Rahmen.Eine in diesem Sinne passende Umschreibung für Meetings findet sich bei Schwartzman:
»A meeting is a social form that organizes interaction in distinctive ways. Most specifically a meeting is a gathering of three or more people who agree to assemble for a purpose ostensibly related to the functioning of an organization or group (e. g., to exchange ideas or opinions, to make a decision, to formulate recommendations). A meeting is characterized by multi-party talk that is episodic in nature and participants develop or use specific conventions for regulating this talk. The meeting form frames the behaviour that occurs within it as concerning the „business“ of the group or organization.«[24]
Teil IIneffektive Meetings und erste Ansätze zu deren Überwindung
2. Frustveranstaltung Meeting – eine Ist-Beschreibung
Die technischen Kommunikationsmöglichkeiten im Unternehmen wie E-Mail- oder Fax-Mitteilungen, Telefon-, WebEx- oder Videokonferenzen, Aktennotizen, Protokolle, Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen werden vermutlich noch weiter anwachsen. Doch die menschliche Fähigkeit, sie adäquat mental zu verarbeiten, zu steuern und zu kontrollieren, wächst erheblich langsamer[25]. Unsere menschlichen Möglichkeiten zur Konzentration und Aufmerksamkeit sind nicht unbegrenzt. Darauf verweisen Neurobiologen seit Jahren. Und dennoch steigen im Unternehmen die Erwartungen an alle Mitarbeiter aller Hierarchieebenen, was Zeit- und Aufmerksamkeitskapazitäten angeht, weiter an. Wie schon erwähnt: Vor allem der Faktor Zeit wird ein knappes Gut werden:
»Die Zeit ist nämlich nicht spar- oder lagerfähig und vergangene Zeit kann nicht zurückgeholt werden«[26].
Nicht mehr Kapital und Information sind die entscheidenden Faktoren, was die Engpässe im Unternehmen angeht, sondern Zeit und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter.
Damit stellen sich zwei wichtige Fragen:
Wie viel Ihrer Zeit verbringen Sie in Meetings?Wann lässt dort Ihre Aufmerksamkeit nach?Führungskräfte schätzen den Mehrwert eines mündlichen Austauschs am Telefon oder in Gesprächen und Face-to-Face-Meetings deutlich höher ein als schriftliche oder elektronische Information, und das unabhängig von Branche, Alter und Ausbildungsniveau[27]. Gleichzeitig beklagen sie die Art und Weise, in der Meetings ablaufen[28]. 80 Prozent der Führungskräfte geben an, dass 60 Prozent der Meetings unproduktiv seien[29]. Mir scheint das noch untertrieben. Was ist das Problem von Meetings?
Patrick Lencioni bringt das Empfinden vieler Menschen auf den Punkt:
»Erstens sind Besprechungen langweilig, ermüdend, einschläfernd und trocken. Selbst wenn man nichts Besseres zu tun hätte, zählt das Herumsitzen in monotonen, geistlosen Sitzungen, Konferenzen oder Auswärtsbesprechungen zu den schlimmsten (Un-)Tätigkeiten des modernen Wirtschaftslebens. Und die Sache wird nicht besser, wenn man, wie die meisten Teilnehmer dieser Veranstaltungen, durchaus Besseres zu tun hätte. Zweitens sind Besprechungen ineffektiv. Und das wiegt weit schwerer. Der verständlichste Grund für die Abneigung gegen Meetings liegt darin, dass sie zum Unternehmenserfolg nur wenig beitragen. Angesichts voller Terminkalender ist es ziemlich frustrierend, Energie und Zeit in eine Tätigkeit investieren zu müssen, die keinen adäquaten Ertrag abwirft.«[30]
Dem ist nichts hinzu zu fügen!
Das Meeting als Profilierungsplattform?
Beobachtungen und Analysen legen den Verdacht nahe, dass kostspielige Missstände in Meetings weniger aus dem Unvermögen einzelner Moderatoren, sondern stärker aus mehr oder weniger gepflegten Arten und Weisen des Miteinanderumgehens resultieren. Verhaltensmuster, die nicht nur im Meeting eine Rolle spielen, sondern insgesamt Ausdruck der Zusammenarbeitskultur im gesamten Unternehmen sind.
Statt gemeinsam Probleme zu lösen, werden zum Beispiel Antipathien ausgelebt, Lösungsvorschläge zerredet oder Aggressionen an anderen Teilnehmern abreagiert.
Und in der verhängnisvollen Überzeugung, dass das die soziale Kommunikationsfähigkeit positiv hervorheben würde, werden oft auch noch destruktive Kämpfe ausgetragen: Sich Durchsetzen gegen andere und das Rechtbehalten gegenüber anderen[31].
Lange Passagen in unzähligen Meetings sind von sieben ganz typischen Merkmalen geprägt:
Wortbeiträge dienen der Selbstdarstellung des Redners.Latent werden verdeckt Konflikte zwischen Personen ausgetragen.Mangelnde Vorbereitung wird kaschiert.Diskussionen der Rechthaberei herrschen vor.Oberstes Ziel ist nicht das gemeinsame Optimieren von Ergebnissen, sondern das Durchsetzen egoistischer Claim-Ansprüche.Agendapunkte lassen nicht erkennen, was noch zur Disposition steht und was bereits vorentschieden ist.Nicht das bessere Argument, sondern der rhetorisch Gewieftere setzt sich durch.»Hält man sich vor Augen, dass in einem mittleren Unternehmen mit 300 Angestellten, die im Durchschnitt zweimal pro Woche in einem etwa zweistündigen Meeting sitzen, 50 000 bis 60 000 Stunden jährlich in Meetings verbracht werden und dadurch zwischen 2,2 und 2,5 Mio. Euro allein an Gehaltskosten verursacht werden, so sind die Verluste bereits bei nur 20 Prozent unproduktiver Zeit beträchtlich. Berücksichtigt man zusätzlich die direkten und indirekten negativen Effekte wie beispielsweise die Effekte auf die Motivation, die Kreativität, die Teamarbeit und die harmonische Zusammenarbeit im Unternehmen, können weitere wertvernichtende Auswirkungen dargelegt werden.«[32]
Hilfsmittel wie Checklisten, Goldene Regeln, Moderationstechniken…, die die Effektivität von Meetings erhöhen sollen, sind allenthalben bekannt. Nicht selten werden sie wie Patentrezepte hingestellt, deren Anwendung ein Meeting erfolgreicher macht. Die Praxis beweist das Gegenteil.
Und so geht es folgerichtig in diesem Buch um die Aktivierung menschlicher Möglichkeiten[34], die soziale und emotionale Kompetenz – mindestens des Moderators – so zu entwickeln, dass das Arbeiten in Meetings den Beteiligten einen Nutzen bringt. Und auch noch Spaß machen kann. Ein Erfolg scheint schon der zu sein, wenn Menschen nach einem Meeting zufriedener sind als vorher.
Von vier Grundannahmen wird in diesem Buch ausgegangen:
1. Im Unternehmen ist ein Meeting immer auch ein Spiegelbild der praktizierten Zusammenarbeit und Führungskultur.
2. Die Moderation von Meetings hat sehr viel gemein mit Führungshandlungen (daher werden Moderation und Führung in diesem Buch in Parallelität gesehen).
3. Erfolg oder Nicht-Erfolg im Meeting hängt wesentlich mit den sozialen und emotionalen Kompetenzen, den Begabungen und der Haltung des Moderierenden zusammen.
4. Im Meeting sind die Haltungen und Einstellungen der Teilnehmer wesentlich für erfolgreiche Zusammenarbeit. Handwerkszeug und Technik spielen eine sekundäre Rolle.
Effizienz von Meetings, oder: Controlling innerbetrieblicher Kommunikationsprozesse
Bei meinen Recherchen zum Buch fand sich nur wenig Literatur, die sich mit der Effizienzkontrolle von Meetings befasst.
Zugegeben, eine Effektivitäts- und Effizienzmessung für Faceto-Face-Meetings dürfte nicht einfach sein. Das erklärt dann auch plausibel, weshalb dieser Messung in Unternehmen wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Menschen in Unternehmen verbringen heute bis zu drei Viertel ihrer Arbeitszeit in Meetings. Und das, obwohl die zeitlichen Ressourcen der Mitarbeiter sowie die Konzentration und Aufmerksamkeit die Hauptengpässe im Arbeitsalltag darstellen.
»Für Missstände in Meetings und für suboptimale Kommunikationsprozesse wird neben der fehlenden oder unqualifizierten Vorbereitung des Meetings vornehmlich das Kommunikationsverhalten der Meetingteilnehmer verantwortlich gezeichnet.«[35]
Systematische Erfolgskontrollen der Interaktionen im Meeting sind alles andere als einfach. Für erfolgreiche und effiziente Kommunikationsprozesse sind neben intersubjektiven und sachlichen Faktoren auch die Sozialbeziehungen und die emotionalen Befindlichkeiten der Teilnehmer wesentlich, die niemals situations- und menschenunabhängig betrachtet werden dürfen[36]. Hinzu kommt die Beobachterabhängigkeit der Wahrnehmung. Das Beobachtete wird halt durch den Beobachter bestimmt.
Alexandra Rausch greift bei ihren Analysen auf Konzepte zurück, die genau das berücksichtigen: Das Konzept des radikalen Konstruktivismus, wonach jeder Mensch sich seine Bilder von der Welt, von anderen, von sich und Meetings konstruiert. Des Weiteren greift sie das Konzept der Metakommunikation auf, das die Tatsache nutzt, dass Menschen dank ihrer reflexiven Eigenschaften über ihre zwischenmenschliche Kommunikation kommunizieren können[37].
Rausch konnte in ihrer Arbeit nachweisen, dass sowohl das Kommunikationsverhalten als auch der Beziehungsaspekt den Prozess und damit die Effektivität und den Prozess von Meetings beeinflussen.
»Anstelle von idealen Patentrezepten (gemeint sind Checklisten, Handlungsanleitungen, Schulungen, Kommunikations- und Präsentationstrainings, Anm. d. V.) die erfolglos in Unternehmen verbreitet werden, sollten vielmehr die menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten aktiviert werden … Nachhaltige Ergebnisse erfordern eine langfristige Perspektive, Kontinuität und das Commitment aller Beteiligten.«[38]
Anders formuliert: Wo es drauf ankommt, ist einmal die Etablierung einer unternehmensweiten – bis in Meetings hinein wirkenden – nachhaltigen Führungs- und Zusammenarbeitskultur, und damit einhergehend die individuelle Reflexion und gegebenenfalls Anpassung der Kommunikationshaltung. Beide Aspekte werden weiter unten noch ausgiebig angesprochen werden.
Mein Vorschlag ist, neben dem Controlling der Kommunikationsprozesse in Meetings noch zwei Kostengrößen ausfindig zu machen:
Die inneren Interaktionskosten: Kosten, die entstehen durch vermeidbare Reibungsverluste unter den am Meeting beteiligten Menschen. Diesen Kosten wird in der Regel erstaunlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl sie erheblich sein können. Diese in Meetings versteckten Demotivationskosten lassen sich grob erheben durch die Summe der Kosten, die anfallen durch (im unternehmensweiten Vergleich)– überdurchschnittliche Fehlzeiten von Teilnehmern (unentschuldigtes Fernbleiben vom Meeting),
– Ausschussproduktion (Themen werden ergebnislos bearbeitet),
– Fluktuation (Verschwinden benötigter Teilnehmer, da die bereits in ein nächstes Meeting müssen).
Die äußeren Interaktionskosten: Kosten, die durch vermeidbare Reibungsverluste mit dem vom Meeting betroffenen Umfeld entstehen. Gemeint sind Projekte, Teams, Abteilungen oder Kollegen die aufgrund der Abwesenheit wichtiger Personen (Entscheider, Führungskräfte, Experten …) in ihrer wertschöpfenden Tätigkeit blockiert werden.Ökonomisch betrachtet ist ein Meeting nur dann effizient, wenn in ihm Leistungen (Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Wertschöpfung) erbracht werden, die den aufgewendeten Personalkosten nicht nur überlegen sind, sondern parallel die Kosten in den oben bezeichneten Positionen senken.
Beispiele, die zur Steigerung der Effizienz von Meeting beitragen sollten:
In einem mittelständischen Unternehmen werden den Führungskräften ab einer definierten Hierarchiestufe „Meetingpunkte“ vergeben. Die Führungskraft kann auf das Geschäftsjahr gesehen 100 Meetingpunkte verbrauchen. Die Höhe der verbrauchten Punkte je Meeting ist bestimmt durch Anzahl der teilnehmenden Personen und Dauer des Meetings. Verbraucht die Führungskraft ihre Punkte nicht voll, erhält sie für das kommende Jahr einen Punkte-Bonus. Damit sollten Anreize geschaffen werden, Anzahl und Dauer der Meetings zu reduzieren.Das Problem: Hat eine Führungskraft gut begründet im September alle ihr zur Verfügung stehenden Punkte verbraucht, kann sie drei Monate lang kein Meeting mehr einberufen. Als das Unternehmen erkannte, das Effektivität von Meetings nicht einfach an Dauer und Anzahl der Teilnehmer fest gemacht werden kann, wurde die Regelung sofort wieder abgeschafft.
Ein Unternehmer kam auf die Idee, die durch Teilnahme am Meeting entstehenden Personalkosten (Stundenkosten) auf die Kostenstelle des Einladenden zu verbuchen. Hier sollten Anreize geschaffen werden, die Zahl der Teilnehmer auf das Nötigste zu begrenzen. An sich ein anerkennenswertes Ziel. Die Reibungsverluste innerhalb der Meetingsnahmen innerhalb eines Jahres jedoch deutlich zu. Weil aus Sparsamkeitsgründen einerseits immer öfter entscheidende Personen fehlten, so dass unbefriedigende bis keine Ergebnisse zustande kamen. Andererseits wurden notwendige Entscheidungen zunehmend autoritär durchgedrückt, Diskussionen untersagt und das bei steigender Unzufriedenheit der Teilnehmer, die ihrer Unzufriedenheit über „sprachlose Verdammung“ des autoritären Moderators (aus dem Fenster schauen, Augen verdrehen, auf die Uhr sehen, Decke anstarren, Teilnahmslosigkeit …) Ausdruck verliehen.Beide Beispiele können als Indiz dafür herhalten, dass das Beziehungs- und Kommunikationsverhalten der Teilnehmer eine entscheidendere Stellschraube für die Verbesserung von Meetings ist.
3. Meeting-Mythen
In diesem Abschnitt findet ein Zurechtrücken weit verbreiteter Vorstellungen dessen statt, was in einem Meeting zu gelten habe. Es sind Illusionen, die sich so hartnäckig halten, das sie zu Mythen geworden sind. Eine Eigenart von Mythen ist, dass die so selbstverständlich werden, dass sie nicht mehr in Frage gestellt werden.
Den Lebenskonzepten der meisten Menschen und auch den Zusammenarbeitskonzepten in Unternehmen liegen individuelle beziehungsweise kollektive Haltungen zugrunde. Gemeint sind Einstellungen und Überzeugungen, in denen sich persönliche wie auch kollektive übernommene Denk- und Verhaltensmuster finden, die über die Jahre fest in den Köpfen zu Selbstverständlichkeiten verankert wurden. Solche Selbstverständlichkeiten können im Zusammenhang mit Kommunikation, Führung oder Personal- und Organisationsentwicklung stehen.
Konsequent müssen also Selbstverständlichkeiten, individuelle oder kollektive, in regelmäßigen Abständen auf Nützlichkeit und Brauchbarkeit überprüft werden, weil ihr Fürwahrhalten unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln beeinflusst. Sofern sie nämlich unbrauchbar sind, prägen sie Leistungs- und Lebensqualität negativ. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie sehr unsere Selbstverständlichkeiten unsere Fähigkeit und Bereitschaft, kritisch zu denken, zu wollen und zu handeln, beeinflusst.
Was gemeint ist, sollen drei historische Aussagen, die Handeln extrem beeinflussten, weil sie zu selbstverständlichen Haltungen wurden, unterstreichen:
»Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.« (Gnaeus Pompeius Magnus)[39], und»Wer nicht gegen mich ist, ist für mich.« (Gaius Julius Caesar) Ein wesentlicher Unterschied: Cäsar erklärte alle Neutralen zu potenziellen Bündnispartnern, Pompeius dieselben zu Gegnern. Cäsars Haltung führte Cäsar zum Sieg im damaligen Bürgerkrieg, Pompeius’ Haltung führte Pompeius zur Niederlage.»Ich bin zwar nicht einverstanden mit dem, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Äußersten dafür kämpfen, dass Sie es sagen dürfen.« (Voltaire)[40]Mythos 1: Rationalität und Sachlichkeit herrschen im Meeting vor
Es ist auffällig, dass Emotionen in der betrieblichen Praxis, und dort vor allem in Meetings, in aller Regel ignoriert werden. Was zählt sind Zahlen, Daten und Fakten und die „Gefühlsduselei“ interessiert nicht. Diese Haltung vertreten nicht wenige Manager und Moderatoren, und das noch mit geschwellter Brust und sichtlichem Stolz, rein der Sache zugewandt zu sein. Denn in der Regel gilt: Wer im mittleren Management Gefühle zeigt, darf entweder das Unternehmen verlassen oder dessen Karriere ist beendet. Die Erwartungshaltung vieler Unternehmensleitungen an das mittlere Management nämlich ist, Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit und kompromisslose Härte in der Sache an den Tag zu legen. Das spricht in dieser Deutlichkeit niemand offen aus. Sachlich wird erklärt und begründet, dass Emotionen im Meeting keine Relevanz hätten und genauso konsequent wird versucht, sie zu verbergen oder, schlimmer noch, abzuwerten. Doch permanent sind sie vorhanden: die Gefühle und Emotionen der Menschen.
In unserem Gedächtnis werden Erlebnisse und Erfahrungen erfolgreich gespeichert, wenn sie mit irgendwelchen Emotionen – angenehmen oder unangenehmen – gekoppelt sind. Mit dieser Kopplung geht unweigerlich auch eine subjektive Bewertung einher: Etwas ist gut oder schlecht, richtig oder falsch, schön oder hässlich und so fort. Zukünftige Erlebnisse werden mit den abgespeicherten Erfahrungen verglichen, und wenn unser Gehirn Ähnlichkeiten zu früheren Erfahrungen bemerkt, entsprechend ähnlich bewertet. Das geschieht alles unwillkürlich, also ohne dass wir es aktiv steuern könnten, und läuft in Bruchteilen einer Sekunde in unserem Hirn ab[41].
Aufgrund lebensgeschichtlich früh geprägter und dadurch entstandener neurobiologischer Vernetzungen im Gehirn kommt es zu auffallenden individuellen Unterschieden in den Fühl-, Denk- und Verhaltensmustern bei uns Menschen, die zu festen Überzeugungen (besser: Haltungen) werden. Diese Unterschiede in den Fühl-, Denk- und Verhaltensmustern entstehen zwangsläufig, da die Sozialisation von Menschen nicht identisch verläuft. Was Frau X nervt, findet Herr Y unter Umständen toll, und umgekehrt.
Frau X und Herr Y sind im Meeting. Beide geraten in einer Fragestellung, wie ein Projekt umgesetzt werden soll, heftig aneinander. Was Frau X für machbar hält, ist für Herrn Y in keiner Weise realisierbar … Gegenseitig werfen sie sich vor, nicht dieselben Ziele zu verfolgen und deshalb auf den jeweils anderen nicht eingehen zu wollen.
Es gibt die weit verbreitete Überzeugung, wenn Menschen unterschiedliche Meinungen in einer Sache vertreten, hätten sie auch verschiedene Absichten. Diese Haltung kann so selbstverständlich werden, dass der Lösungsansatz des Gesprächspartners als solcher nicht mehr wahrgenommen werden kann: Er wird zum Gegner.
Die Einstellung, wenn zwei Menschen unterschiedlicher Meinung seien, hätten sie stets auch unterschiedliche Absichten, ist für Meetings hochproblematisch: Vorhandener Konsens wird dadurch effektiv niedergemacht.
Trotz gleicher Absicht entstehen unterschiedliche Meinungen zu einer Thematik immer dann, wenn ein Teilnehmer eine Rahmenbedingung zur Zielerreichung für erfüllbar hält, die ein anderer für nicht erfüllbar hält. Oder: In der Lebensgeschichte gewachsene Risikofreude von X trifft auf in der Lebensgeschichte gewachsene Risikoscheu von Y.
Führungs- und Moderationskonzepte, die von der Gleichheit und Gleichbehandlung aller Kollegen ausgehen, müssen zwangsläufig ihre Wirkung weitestgehend verfehlen. Die Unterschiede in den Fühl-, Denk- und Verhaltensmustern erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen in der Führung von Mitarbeitern und der Moderation von Meetings – auf der rationalen, emotionalen und sozialen Ebene.
Das Arbeiten in Meetings wird durch sich ständig verändernde, wechselnde äußere Bedingungen und persönliche Befindlichkeiten beeinflusst. Auch wenn Prozesse im Unternehmen für klar und relativ stabil gehalten werden, ist doch ständige Beweglichkeit, Veränderung und Flexibilität (geistige Mobilität) gefordert – gerade und besonders bei den zwischenmenschlichen Kontakten. Grundprinzipien der heutigen Zusammenarbeit sind deshalb die Förderung solcher individueller Flexibilität und der Anpassungsfähigkeit, sich den verändernden Bedingungen Tag für Tag stellen zu können.
So verständlich der Wunsch nach einem universellen idealen Konzept für Meetings, das für alle Teilnehmer und alle Arten von Meetings gilt, auch ist. Ein solches Konzept kenne ich nicht!
Es kommt vielmehr darauf an, Sensibilität zu entwickeln, um den Unterschieden entsprechende Vorgehensweisen und Handlungsspielräume zu erarbeiten, mit denen durch Meetings geführt und moderiert werden kann. Primäres Anliegen dieses Buches ist denn auch der Appell an Führungskräfte und Moderatoren, sich Handlungsmuster anzueignen, die den Unterschieden der einzelnen Teilnehmer und Meetings gerecht werden.
Das erscheint sozial und ökonomisch dringend notwendig, da Veränderungen bei Menschen zu kritischen Instabilitäten führen und dann – mehr oder minder stark – Unsicherheit, Anspannung, Belastung, Druck, Stress, Unlust, Frustration, Unmut, Gereiztheit und Ärger hervorrufen. Gerade hier ist dann eine wertschätzende Auseinandersetzung zwingend angeraten, mit solchen unangenehmen Gefühlen so umzugehen, dass die Sachaufgaben, die Fachaufgaben und die Führungsaufgaben wertschöpfend bewältigt werden.
Klärung: Emotionen sind die menschliche Software im Meeting
Eine brauchbare und nützliche Unterscheidung von Gefühl, Emotion und Affekt bietet Heinemann:
»Emotion betont von seiner lateinischen Wurzel ›movere‹ (bewegen) her gesehen den Aspekt des Bewegt- und Ergriffenseins. Das Wort ›Affekt‹ hat die Wurzel im lateinischen Verb ›afficere‹ (anmachen, anrühren) und meint dasselbe wie Emotion. Im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet ›Affekt‹ die durch einen heftigen Reiz ausgelöste heftige Emotion (zum Beispiel Schmerzensschrei). Der Begriff ›Gefühl‹ ist im Gegensatz zum Affekt eine schwächere Form des Bewegt- und Ergriffenseins, die dem Denken und Erinnern nahe liegt und das Sprechen über Emotionen und Affekte ermöglicht.«[42]
Gefühle lassen sich verstehen als erinnerte Emotionen im Zusammenhang mit erlebter Vergangenheit.
Zur Unterscheidung zwischen Emotion und Gefühl ein Beispiel: Ein äußeres Ereignis – zum Beispiel der Tod eines nahestehenden Menschen – löst unwillkürlich eine Emotion (Trauer) in uns aus. Erzählen wir Wochen später einem Dritten, mit dem wir uns verbunden fühlen, von diesem vergangenen Erleben, werden neben rein rationalen Sachverhalten wie Datum, Situation und den Umstände, Gefühle (re-aktivierte Emotionen) mitgeteilt werden müssen, wenn die Erzählung glaubhaft ankommen soll.
»Emotionen, Gefühle, Affekte sind kein verzichtbarer Luxus. Sie sind wichtig für die Anpassungsleistungen im privaten und beruflichen Alltag und gehören untrennbar zu den Mechanismen der Lebensbewältigung. Angenehme und unangenehme Emotionen, Gefühle und Affekte sind dazu bestimmt, Bedrohungen abzuwehren und Quellen für Energie, Wachstum und Schutz zu erschließen.«[43]
Für Leser, die nunmehr skeptisch den Kopf wiegen, hier eine Einladung, im nächsten Meeting folgende Emotionen ausfindig zu machen:
Angst (etwa vor Misserfolg, vor Autorität, vor Gesichtsverlust), Ärger (etwa über Abteilungs- und Claimdenken einzelner, über eigene unberücksichtigte Bedürfnisse, über das Verhalten anderer),Eitelkeiten (zur Schau gestellt über Beiträge, die der Selbstdarstellung dienen, Rechthabereien),Scham (wenn jemand „erwischt“ wird, der sich mangelhaft vorbereitet hat).Mir ist kein einziges Meeting bekannt, in dessen Verlauf diese vier Emotionen nicht irgendwann zum Tragen gekommen wären.
Ohne Emotionen ist menschliches Verhalten nicht vorstellbar[44]. Für die individuelle Zu- oder Abwendung in Bezug auf ein Meeting-Thema und das daraus resultierende Verhalten ist das Vorzeichen der Emotion (positiv/angenehm, negativ/unangenehm) entscheidend.
Ausdrucksformen von Emotionen
»sind zum Beispiel Interesse, Erregung, Freude, Vergnügen, Überraschung, Schreck, Zorn, Wut, Ekel, Abscheu, Verachtung, Furcht, Geringschätzung, Entsetzen, Angst, Scham und Schuldgefühl. Solche Arten der Emotion haben gravierende Auswirkungen auf psychische Prozesse wie Wahrnehmen, Urteilen, Erinnern, Problemlösen und Bewältigen von Aufgaben. Sie verhindern oder befördern Kommunikationsprobleme und beeinflussen ihre individuelle Verarbeitung«[45].
Hinter der Idee, dass Gefühle und Emotionen im Unternehmen nichts verloren hätten, steckt natürlich eine Geschichte. Sie wird uns im Zusammenhang mit Meetings noch weiter unten beschäftigen.
Die Idee, dass Gefühle und Emotionen im Unternehmen entweder nichts verloren hätten, oder im Führungsalltag und in Meetings allenfalls die positiven Gefühle wie Freude und Lust und positives Verhalten wie Anerkennung und Verständnis die Entwicklung eines Menschen konstruktiv vorantreiben, ist eine fatale unmenschliche Entwicklung, die von nicht wenigen Menschen zum Dogma erhoben wurde. Diese fixe Idee ist eine Erfindung aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, die nur schwer aus den Köpfen heraus zu bekommen ist. Diese fixe Idee führte und führt zur Unterdrückung und Verleugnung insbesondere der unangenehmen beziehungsweise schlecht erlebten Gefühle wie Schmerz, Trauer oder Aggression[46]. Unterdrückung, Verleugnung oder gar Abspaltung der Gefühle gelingt nur auf Kosten individueller Gesundheit.
Dabei fokussiert sich unser Gehirn in erster Linie auf Gefühle und Emotionen, angenehme wie unangenehme. Das macht es deshalb, weil wir Teil der Natur und der Evolution sind. Und in der Natur geht es immer um das Überleben. Unangenehme Gefühle signalisieren Gefahrensituationen, auf die das Gehirn ebenso reagieren muss wie auf Freudenereignisse. Verdrängung und Unterdrückung der unangenehmen Gefühle bewirken körperliche und psychische Erkrankungen und verhindern (Konflikt-)Klärungen im privaten und beruflichen Bereich gleichermaßen. Und sie fördern in der Situation, der Sache, der Kooperation und bei den Menschen unangemessenes und ausweichendes Verhalten.
Die Unfähigkeit, sich und andere mit negativen Befindlichkeiten gesund und konstruktiv auseinanderzusetzen, bewirkte eine Fokussierung auf Regeln und Strukturen[47]. Das lässt sich statistisch festmachen an dem zunehmendem Bedürfnis nach Kontrolle: Jeder Prozess, jeder Handgriff sollte beschrieben und am besten zertifiziert sein, nichts darf ohne Messung und Kennzahlen ablaufen. Misstrauenskultur wächst an, statt Vertrauenskultur – wie anders lässt sich die boomende Literatur und wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Vertrauen erklären?
Tatsächlich sollen Regeln und Strukturen etwas in den Griff bekommen, über das ansonsten erschreckende Sprachlosigkeit im Unternehmen herrscht: die wachsenden Ängste der Menschen über alle Hierarchieebenen hinweg.
Mythos 2: Anwesenheit im Meeting signalisiert Interesse
Was ist der Grund dafür, dass Sie Meetings besuchen?
Weil Sie sich darauf freuen? Weil Sie so auf dem Laufenden bleiben? Weil es von Ihnen erwartet wird? Weil Sie sich nicht ins „Abseits“ stellen wollen? Weil Sie sich profilieren wollen? Weil Sie nicht möchten, das andere über Ihren Kopf hinweg entscheiden? Weil Sie nicht möchten, das schlecht über Sie geredet wird? Weil Sie anschließend die an Sie gestellten Erwartungen besser erfüllen können?Weil Sie so Ihren Job wertschöpfender ausüben können? Weil Sie dort nette Kollegen treffen? Weil Ihnen langweilig ist? Weil Sie masochistisch veranlagt sind? Weil Sie nichts Besseres zu tun haben?Die Liste möglicher Beweggründe, mit denen Menschen ein Meeting aufsuchen, ließe sich noch lange weiter führen.
Natürlich besuchen Menschen Meetings auch, weil sie das Interesse an der Sache hintreibt. Davon auszugehen, dass Anwesenheit stets und grundsätzlich Interesse der Anwesenden signalisiere, ist allerdings ein weiterer Mythos. Wir wissen seit Jahren, dass es kein Mythos ist, dass Menschen in Unternehmen und Meetings Ängste haben. Eine Stichprobenbefragung ergab bereits Mitte der neunziger Jahre, dass fast 60 Prozent der erwerbstätigen Deutschen berufsbedingte Ängste haben. Am stärksten ist die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren (67,58 Prozent). Es folgen: Angst vor Unfällen (67,42 Prozent); Angst, Fehler zu machen (58,98 Prozent); Angst, Wertschätzung zu verlieren (50,93 Prozent); Angst vor Konkurrenten (30,23 Prozent); Angst vor Autoritätsverlust (28,21 Prozent); Angst vor Neuerungen/Veränderungen (27,31 Prozent); Angst, Untergebenen nicht gerecht zu werden (20,37 Prozent). Die Folgen sind Fluktuation, Medikamenten- und Alkoholmissbrauch, Mobbing, Fehlzeiten, innere Kündigungen. Die errechneten Kosten, die durch betriebsbedingte Ängste der deutschen Volkswirtschaft entstehen, belaufen sich auf 56 753 000 000 €[48].
Von mir durchgeführte Umfragen führen zu dem Ergebnis, das die Prozentzahlen heute, etwa 20 Jahre später, tendenziell noch höher ausfallen.
Eine sehr große Furcht ist die, Fehler zu machen oder Wertschätzung zu verlieren.
Klärung: Ängste ernst nehmen
Ängste sind spezielle Emotionen und in Unternehmen sehr viel weiter verbreitet als von Managern und Führungskräften vermutet[49]. Sie nehmen in Anbetracht rasanter Entwicklungen wie Internet, Globalisierung, Internationalisierung und daran geknüpften hohen Erwartungen an die Veränderungsbereitschaft enorm zu. Auch wenn über solche Ängste im Unternehmen sehr selten offen gesprochen wird – oder die gar tabuisiert werden –, bedeutet das keineswegs, dass sie nicht existieren oder keine Rolle spielen.
»Ängste verkörpern einen Erregungszustand des Menschen, mit dem er auf eine gegenwärtige oder vermutete Gefahr reagiert, von der er glaubt, dass sie sein Leben, seine Leistungsfähigkeit oder seine Persönlichkeit bedroht.«[50]
Wenn Ängste als die Antwort auf den Wegfall von Sicherheit, Grenzen der Orientierung und Geborgensein verstanden werden, kommen als Quellen für diesen emotionalen Angst-Zustand folgende Faktoren in Frage:
Wegfall der vertrauten Grenzen des Wirtschaftslebens (das führt zu ungewohnter Konkurrenz, zum Beispiel durch Etablierung neuer Unternehmen im Internet), Abbau von Hierarchien in Unternehmen




























