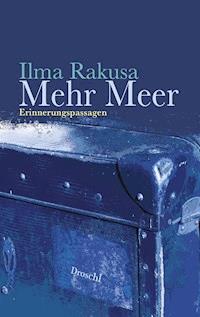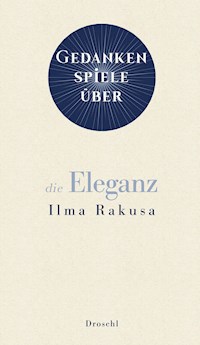19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droschl, M
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Was macht ein Leben aus? Ilma Rakusa spricht über Dinge, die in unser aller Leben bedeutsam sind und mit denen wir uns auseinandersetzen: Freundschaft, Angst, Alter oder Zärtlichkeit und viele mehr. Sie entfacht in uns eine Neugierde und Entdeckerfreude. Das Leuchten in ihren Augen ist den Zeilen anzumerken: beschwingt klingt das »Querfeldein«, die Lust am Flanieren kommt schon während des Lesens, und nach der Hommage an den Granatapfel wird er niemals mehr nur eine einfache Frucht sein. Ein Alphabet des Lebens Zu jedem Buchstaben des Alphabets verfasst Ilma Rakusa Beiträge von A wie Anders bis Z wie Zaun, changierend zwischen Prosa, Gedicht und Gespräch. Sie erzählt und dichtet über ihr bewegtes Leben: Werk, Weltsicht und Weggefährten, Reisen und die schönen Künste, Familie und Kindheit. Ihr gelingt der Kunstgriff, abstraktere Begriffe – wie Träume oder Rituale –, Orte, persönliche Erinnerungen und Erfahrungen kaleidoskopartig zu einem Ganzen zu vereinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Ähnliche
Ilma Rakusa
Mein Alphabet
Literaturverlag Droschl
Anders
Das Lammfellmäntelchen drückte nicht
aber sie schauten
schauten mich an wie eine Blöde
wo kommt die her
was will die hier
bei uns
uns war nicht ich war nicht mein
Mantel meine Sprache mein Kleid
alles anders
du bist anders
kicherten sie
und zeigten mit dem Finger auf mich
ich stand
ich wand mich nicht
blieb
immer draußen am Zaun
lernte beobachten
Bäume und Sträucher meinten es
gut mit mir
wurden weiß gelb grün
wie zärtliche Schleier
ich träumte sie
oder träumten sie mich
wie ich dem Mantel entwuchs?
in der Schule hob ich die Hand nur allein
nie in der Gruppe
die Wir-Spiele liefen an mir vorbei
und keiner hieß mich ein Täubchen
ich gehörte mir selbst
ich genas
Angst
Man sagt, ein Projekt habe nur Gewicht, wenn es auch Schatten habe. Stimmst du dem zu oder findest du diese These fragwürdig?
Nein, die Schatten gehören zu uns, nicht nur zu unsern Projekten, auch zu unserm Wesen, unseren Handlungen. Es gibt immer Unschmeichelhaftes, Problematisches, immer Seiten, die wir an uns selbst nicht mögen.
Die Angst ist eine komplizierte und leidvolle Sache. Denn ob diffus oder nicht diffus: sie mindert die Lebensqualität und ist meist unproduktiv. Mit Ausnahme von Situationen, wo sie uns vor Gefahren schützt. Hätten wir gar keine Angst, würden wir vermutlich auch nicht über Fluchtreflexe verfügen. Ich will die Angst also nicht dämonisieren, tue mich aber dennoch schwer mit meiner Ängstlichkeit. Um mich vor falschen Ängsten zu schützen, habe ich sogar ein »Gedicht gegen die Angst« geschrieben, es gleicht einem Abwehrzauber. Man muss aktiv sein, darf sich von seinen Ängsten nicht unterkriegen lassen.
Oft habe ich mich gefragt, woher meine Ängste wohl kommen. Schon meine Mutter war sehr ängstlich, vielleicht hat sich das vererbt. Es könnte aber auch mit meiner frühen Kindheit zu tun haben, den vielen Umzügen und Unsicherheiten. Trotz der Geborgenheit, die von meinen Eltern ausging, empfand ich das doch als schwierig. Jedenfalls entwickelte ich eine besondere Wachsamkeit. Nicht nur mein Kopf, mein ganzer Körper fährt Antennen aus, sondiert die potentielle Gefahrenlage. Mitunter kann das ganz nützlich sein.
Unangenehm ist, wenn man sich mit diffusen Ängsten herumquält und in einer permanenten Spannung lebt. Eine Freundin von mir pflegt den Satz von Woody Allen zu zitieren: »I had many problems in my life, but most of them never happened.« Das passt auch zu mir. Im Kopf antizipiere ich Dinge, entwickle Angstszenarien – und schließlich passiert nichts oder nichts Schlimmes. Die ganzen Sorgen waren umsonst. Umsonst auch die körperlichen Symptome wie Zittern, Magenweh, Kopfschmerzen. Nur, gespürt habe ich sie sehr wohl. Zum Beispiel, als eine Maschine der Austrian Airlines zwischen Zürich und Graz in starke Turbulenzen geriet und ich eine Stewardess weinend um Hilfe bat. Ich wollte keine Medikamente, wollte nur, dass sie mir wie einem Kind die Hand hält. Das tat dann mein Sitznachbar auf rührende Weise.
Angst hat etwas Lähmendes, und sie zieht einen hinunter.
In meinen Texten versuche ich, leicht zu sein. Zwar sind sie oft melancholisch grundiert, doch hat das nichts mit Angst zu tun. Angst verschließt, mein Schreiben aber tendiert zur Offenheit.
Hilft dir nichts gegen die Angst, auch nicht der Glaube?
Eine gute Frage. Gerade kürzlich, vor einer schwierigen medizinischen Untersuchung, wünschte ich mir, ich hätte mehr Gottvertrauen. Die Angst war wie eine sauerstoffarme Kapsel, in der langsam die Luft ausgeht. Man möchte atmen, möchte mit der Außenwelt kommunizieren, und findet sich immer wieder in dieser Kapsel, wo die Gedanken rotieren und rotieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Da habe ich tatsächlich gehadert mit mir: Warum schaffst du das nicht, warum entspannst du dich nicht, warum sagst du nicht, ich bin in Gottes Hand, komme, was wolle.
Leider bin ich ein Kontrollfreak, der die Zügel ungern aus der Hand gibt. Doch das Leben lässt sich nicht kontrollieren, jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt. Im Alltag lebe ich sehr selbstbestimmt, bin allein verantwortlich für das, was ich tue, und das ist nicht wenig, manchmal belastet es mich auch. Gleichzeitig habe ich Angst, mein Leben könnte ohne strenge Kontrolle aus den Fugen geraten. Das hängt sicher mit meinem Bedürfnis nach Form zusammen. Ich habe einen starken Gestaltungswillen.
Was häufig hilft, sind Musik und Poesie. Sind beispielsweise Gedichte von Ossip Mandelstam, der in seinen Erinnerungsfragmenten »Die ägyptische Briefmarke« diese wundersamen Sätze schrieb: »Die Angst nimmt mich an der Hand und führt mich. Ein weißer Zwirnhandschuh. Ein Handschuh ohne Finger. Ich liebe die Angst, ich verehre sie. Fast hätte ich gesagt: ›Wenn die Angst bei mir ist, habe ich keine Angst.‹ (…) Die Angst spannt die Pferde aus, wenn man abfahren muss, und schickt uns Träume mit grundlos niedrigen Stubendecken.« Schon bin ich beruhigt und getröstet. Wie nach der Lektüre von Märchen.
Alter
Macht dir das Alter Angst?
Unter dem Aspekt, dass ich meine Unabhängigkeit verliere, auf fremde Hilfe angewiesen bin, macht es mir Angst. Ich bin große Freiheit gewohnt, allein schon die Einschränkung des Bewegungsradius würde mir enorme Mühe bereiten.
Natürlich weiß man nie, was einem wann bevorsteht, doch diese Perspektive erfüllt mich mit Sorge.
Dennoch versuche ich mit mentalem Training, mich auf eine Phase des Loslassens vorzubereiten. Und gleichzeitig die Vorzüge des Alters, sofern die Gesundheit mitspielt, nicht aus den Augen zu verlieren: Lebenserfahrung, das Wissen um Prioritäten, ein gewisse Gelassenheit, die Freude am gelungenen Moment. Ich glaube, ich lebe heute bewusster, auch dankbarer, weil vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Einladungen, Aufträge, Lesungen, Reisen regen weiterhin an, das Schreiben sowieso. Aber auch kleine Dinge machen mich glücklich: der Haselstrauch vor meinem Fenster, die Natur im Wechsel der Jahreszeiten, private Alltagsrituale, und immer wieder die Musik. Bach, Monteverdi, Bartók, Akkordeonklänge eines ukrainischen Straßenmusikers. Das kann mich zu Tränen rühren. Und gute Gespräche mit Freunden.
Meine Bewunderung gilt so tapferen Einzelgängern wie der 1938 geborenen Lyrikerin Elke Erb. Wenn ich sie anrufe, erzählt sie mir von ihren Schreibprojekten, zitiert Verse von Ossip Mandelstam, berichtet von ihren Turnübungen und Teebaumöl-Bädern, innerlich immer in Bewegung, wissbegierig, selbstkritisch, voller Fragen und staunend wie ein Kind. So kann man neunzig werden – und alterslos bleiben. Das Leben als work in progress.
Und Friederike Mayröcker, diese Unentwegte. Kein Jahr ohne ein Buch, kein Tag ohne eine Zeile. Und was für Zeilen. »… dieser zerfetzte Blumenstrausz in der Bodenvase in schiefer Haltung mit dem immer noch weiszen Bändchen das sich ringelte nämlich man hatte es im Blumenladen mit der Schere gekämmt dasz es sich kräuselte, i makabrer Lockenwirbel der niedersank, der Traum istizweites Leben.«
Wer sagt denn, das Alter müsse banal und langweilig sein. Muss es nicht.
Bett
Im Fall einer Krankheit ist das Bett die beste Option. Freilich verbinden mich mit Bettlägerigkeit nicht die besten Erinnerungen, obwohl mir Mutter in der Kindheit vorlas, was ich genoss.
Aber das Bett ist in jedem Fall ein Ort der Geborgenheit, ein warmes Nest, das man oft ungern verlässt und in das man sich, sobald die Welt allzu bedrohlich wird, wieder zurückzieht.
Wunderbar hat es Danilo Kiš in seinem Kindheitsroman »Garten, Asche« beschrieben: »Mutter brachte auf ihrem Tablett in dem Einmachglas mit dem Honig und dem Fläschchen mit Lebertran die Bernsteinfarben sonniger Tage ins Zimmer, dichte Konzentrate betäubender Düfte. (…) An wolkigen, düsteren Regentagen blieben die Spuren unserer Finger am Stiel des Löffelchens zurück. Dann weigerten wir uns aufzuwachen und kuschelten uns, bekümmert und unzufrieden, in die Kissen, um die Tage zu überschlafen, die sich eintrübten und nach abgestandenem Fisch rochen.«
Schlafen, träumen, sich wärmen und regenerieren – all das geschieht gewöhnlich im Bett. Auch das Liebemachen. Einen Großteil unseres Lebens verbringen wir hier, keine Kleinigkeit.
Morgens nach dem Aufwachen bleibe ich oft länger im Bett liegen, denn mir kommen tausend Gedanken, die ich nicht verscheuchen will. Oder ich träume einen Traum zu Ende, den ich dann aufschreibe. Auch Lesen im Bett ist eine gute Sache. Das tue ich sitzend, zwei Kissen im Rücken, aus Bequemlichkeit und weil ich so konzentrierter bin. Nur Bett und Laptop bringe ich nicht zusammen, noch nicht.
Ach, diese Betthöhle, mit der Daunendecke als flaumigem Gewicht! Ohne Daunendecke komme ich nur in warmen Gegenden aus. Sonst begleitet sie mich rund ums Jahr. Weich, anschmiegsam, ohne Forderungen zu stellen. Denn natürlich soll das Bett für optimale Entspannung sorgen. (Beziehungscrashs gehören ausgelagert, etc. Ich rede von früheren Erfahrungen, lebe ja schon lange allein.)
Mein Bett: japanisch inspiriert, mit niedrigem schwarzem Gestell und Matratze. Breit, großzügig. Über dem Kopfteil hängt das gerahmte Foto einer Japanerin mit geschlossenen Augen. Beben darf die Erde nicht, sonst riskierte ich, dass das schwere Bild mich erschlägt. Lieber soll die im Stehen Schlafende mich beschützen.
Was ich vom Bett aus sehe? Einen japanischen Riesenfächer, schwarzweiß, und einige blühende Phalaenopsis. Nicht zu vergessen die Bücherwand links, mit Werken zu Philosophie und Literaturgeschichte. Nicht nur nachts unterhalte ich mich mit ihnen.
Berge
Ich bestaune sie von weitem, als etwas Erhabenes, Ehrfurchtgebietendes. In der Schweiz bin ich von Bergen umgeben, doch eine Bergsteigerin ist nicht aus mir geworden. Anders als mein Vater, der schon in jungen Jahren in seiner slowenischen Heimat geklettert ist und später in der Schweiz alle Viertausender bestiegen hat, scheue ich die Höhe, sie macht mir Angst. Kein Ehrgeiz treibt mich, Gipfel zu erklimmen, mir reicht der Anblick aus der Distanz.
Aber ich liebe alpine Gegenden: das Engadin mit seinen azurblauen Seen, das Bergell mit seinen steilen Bergkulissen. Hier ist Alberto Giacometti geboren und aufgewachsen, zwischen dem Granitgrau der Berge, in Dörfern, deren Straßen, Brunnen und Hausdächer aus eben diesem Granit sind. Kein Wunder, ist er zum Maler der Grautöne geworden. Auch seine Skulpturen sind dominant grau. Ein herber Künstler, herb wie sein Tal.
Seit gut fünfzig Jahren besuche ist das Bergell, vor allem das Dorf Bondo. Hier habe ich geheiratet, hier sind meine Eltern begraben. Ich konnte zusehen, wie sich die Generationen ablösten, neue Häuser entstanden, alte Ställe umgebaut wurden, wie die Bauern ausstarben, bis nur noch ein einziger übrigblieb. Verschwunden die Schafherden, die Kühe. Und die Jungen wandern aus.
Der Lauf der Dinge, dachte ich mir. Doch am 23. August 2017 geschah etwas völlig Unvorgesehenes: vom Piz Cengalo lösten sich vier Millionen Kubikmeter Gestein und donnerten bei Bondo zu Tal. Der Bergsturz zerstörte zahlreiche Häuser und Ställe, verschonte allerdings den alten Dorfkern und dank eines Alarmsystems die Einwohner. Ein Riesenglück im Unglück. Seither gab es weitere kleinere Felsstürze und Murgänge, und niemand kann voraussagen, was noch kommt, denn der Berg ist labil. Tauender Permafrost, sagen die Spezialisten, sei die Hauptursache.
Das will so schnell nicht in die Köpfe: dass ausgerechnet ein Berg, Inbegriff der Stabilität, sich bewegt und Unheil anrichtet. Der Schock sitzt tief, auch bei mir, obwohl ich vom Unglück nicht betroffen war. Die evakuierten Dorfbewohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren, aber einige berichten, dass sie die Nacht bei Freunden in anderen Dörfern verbringen, aus Angst. Schließlich sei der Berg, mit dem sie vertrauensvoll zusammengelebt hatten, nun ein Feind. Ein unberechenbarer dazu.
Bondo ist jedenfalls ein anderes, und wohl für lange Zeit. Verschwunden die alte Brücke, verschwunden die Sägerei, die weite Wiese hinterm Dorfrand eine riesige Schutthalde, ein künstlicher Berg.
Ich erzähle dies, weil mein Respekt vor Bergen seither noch zugenommen hat. Mit Bergen ist nicht zu spaßen. Bekanntlich auch nicht mit Vulkanen, diesen Lava- und Aschespuckern. Sie tun, was sie wollen, da ist der Mensch machtlos.
Bergell
Wie Berge wie Steine
steil und Wald
und die Brunnen laut
du reißt die Augen auf
Kastanienmoose Kneipen
sprechende Halme
Heimat
hast du Heimat gesagt?
da ist sie
in den Holzstuben mit
tiefhängender Lampe
am Hang wo die Pilze
sprießen die zarten Gifte
bei den Ziegen
oder sich wiegend im Gras
der Himmel ein Schal
graublau oder gelöchert
egal er ist da
doch einer fehlt immer
der Alte mit Bart
der Maler
der Küster
die Kinderfrau
das Mädchen vom Balkon
sie sind dort
hinterm Finale
am sicheren Ort
schau und schau erneut
ich sehesie wachsen
Blau
Himmel
Meer
Kornblume
Enzian
Novalis’ blaue Blume
Rimbauds blaue Stunde
Yves Kleins Bilder
Marineuniformen
die tiefblauen japanischen Schuluniformen.
Dieses japanische »navy blue« ist meine Lieblingsfarbe, nur eine Spur von Schwarz entfernt, aber verführerisch abgründig. Immer sind es die Nuancen, auf die es ankommt.
Der Sog des dunklen (nachtschwarzen) Blaus. Indigo-Blau.
Die beschützende, weil das Böse abwehrende Wirkung des leuchtenden Blaus. Weshalb in Griechenland viele Türen blau umrandet sind und Amulette diese Farbe tragen.
Blau als Reimwort, auch nicht zu verachten.
Vor meinem inneren Auge sehe ich die Engadiner Seen, alles andere als lau, auch im Sommer kalt, gletscherwasserkalt, und im Herbst gesäumt vom Goldgelb der Lärchen. Das bringt nur die Natur zustande, at her best.
Die Technik laboriert mit Metallischblau und Bildschirmblau. Dazu habe ich ein Farb-Tanka geschrieben:
Auf dem meerblauen Bildschirm
des Laptops die Zeichen
wie Unterwassergeschöpfe
bewegte Wesen
in tiefer Leere.
Braun
Ich erinnere mich an den Landeanflug auf Kairo, an einem Nachmittag im Februar, bei klarem Wetter. Eine Symphonie in Braun, vom zarten Beige über Lehmbraun bis zu zig Sandfarben, das satte Dunkelbraun verstreuter Ackerflächen nicht eingerechnet. Wobei diese Farben sich mit geometrischen Formen verbanden: den Rechtecken der Häuser und Umfriedungen, dem Halbrund der Moscheekuppeln und Grabdenkmäler. Es war das alte, uralte Kairo, das da hingebreitet lag, der Wüste entrissen und doch unverkennbar ein Teil von ihr. Jedenfalls farblich. Ich werde diesen ersten Eindruck nie vergessen.
Wüstenlandschaften sind mir nahe. Keine Wüste gleicht der anderen, und von Eintönigkeit nicht die Spur. Im Gegenteil, man erlebt einen Farbenrausch sondergleichen, und die Horizonte wechseln oft schneller, als einem lieb ist. In diesem Naturspektakel wird das eigene Ich gründlich redimensioniert, eine heilsame Erfahrung.
Nichts gegen Braun also. Und während ich das Wort laut ausspreche, kommt mir unweigerlich die Braunkohle in den Sinn, genauer der Braunkohlegeruch, der meine Kindheit in Budapest, Ljubljana und Triest begleitet hat. Diesem säuerlich-bitteren Geruch folge ich (wie es in einem meiner Gedichte heißt) »wie ein Narr seinem Hut«, ob er mir in Prag, Lemberg oder in der Großen Hamburger Straße in Berlin entgegenschlägt. Er ist ein Stück Heimat, so merkwürdig das klingen mag.
Mit der Farbe Braun hat dies freilich wenig zu tun, auch nicht mit dem Braunbären, der Braunalge und dem Braunbier.
Camera obscura
Nicht die Dunkelkammer des Fotografen, sondern das verdunkelte Siesta-Zimmer meiner Triestiner Kindheit oder mein migränegeplagter Kopf. Das Siesta-Zimmer ist positiv besetzt, als Ort meiner Tagträume und Phantasien. Im Übrigen war es nicht ganz dunkel, durch die Jalousien fiel etwas Licht, gerade genug, dass ich Lichthasen über den Boden oder die Decke huschen sah. Anders das völlige Dunkel in meinem Kopf, wenn die Migräne zuschlug. Diesen Zustand kenne ich bis heute. Schmerz, Lähmung, Einsamkeit. Nichts soll und kann eindringen: kein Licht, kein Geräusch, kein Geruch. Schrecklich, diese Enge und dieses Schwarz. Aber da muss ich hindurch. Und irgendwann öffnen sich die Poren und Sinne, und ich fühle mich wie neu geboren. Jedesmal eine überwältigende Erfahrung. Dostojewskij, ein Epileptiker, hat nach seinen Anfällen Ähnliches erlebt. Desgleichen sein epileptischer Held Fürst Myschkin, im Roman »Der Idiot«. Seine »heilige Krankheit« bescherte ihm Momente höchster Luzidität, was auch auf seine Umgebung kathartisch wirkte.
Dunkel und Licht – ein ewiges Wechselspiel.
Dinge
Reichtum und Last, je nachdem, wie man sich zu ihnen einstellt. Ich liebe Dinge, nicht aus materiellen Gründen, sondern weil sie eine Umgebung bilden, die ich mitgestalte. Und weil mir der Gedanke gefällt, dass sie mich überdauern. In meinem Haus gibt es tausende von Büchern, viele sind mit Widmungen und Unterstreichungen versehen. Daneben Bilder, marokkanische Schalen, venezianische Masken, eine japanische Holzspule mit Goldfaden, viele Mitbringsel von Reisen, Geschenke von Freunden. Jeder Gegenstand hat seine Geschichte und hält mir mitunter den Spiegel vor. Oder redet mit mir: Erinnerst du dich, als wir zusammenkamen, in jenem staubigen Prager Antiquariat? Dein linker Arm steckte im Gips, doch deine Rechte fand mich. Dinge sind Gedächtnisspeicher, Erinnerungskapseln (-katalysatoren), von der Zeit gezeichnet wie wir selbst. Sie verdienen eine gute Behandlung, ja mehr noch: Zuwendung. Ich finde, wir gehen mit ihnen viel zu acht- und lieblos um.
Natürlich haben sie die Tendenz, sich unaufhaltsam zu vermehren, die Bücher tun es karnickelartig. Dann heißt es, sich von diesem oder jenem zu trennen. Um leichter zu werden, beweglicher. Mehrere meiner Bekannten greifen da rigoros durch, verordnen sich eine fast buddhistische Ding-Askese. Bewundernswert. Selber gelingt mir das nicht. Denn die Dinge, die mich umgeben, sind mein Zuhause und Schutz, meine Mikrowelt, die ich selbst geschaffen habe. Ich hänge an ihnen, geradezu existentiell. Das mag eine späte Reaktion auf meine nomadische Kofferkindheit sein, ohne eigenes Zimmer, ohne Spielsachen. Zu einem eigenen Zimmer kam ich erst mit vierzehn, und es bedeutete mir viel. Sofort gestaltete ich es nach meinen eigenen Vorstellungen. Es sollte zu einer zweiten Haut werden, und wurde es auch.
Übrigens ging ich auch mit Provisorien nicht anders um. Das schlauchartige Zimmer, das ich während meines Pariser Studienjahrs bewohnte, verwandelte ich mit wenigen Gegenständen – Klavier, Bettdecke, Plakat, Ansichtskarten – in einen persönlichen kleinen Kosmos. In erster Linie, um in der anonymen Großstadt ein Refugium zu haben, wo ich mich wohl fühlte. Aber auch Besucher sollten wissen, mit wem sie es zu tun hatten.
In meinem jetzigen Haus wohne ich schon seit über dreißig Jahren, und ich zögere nicht, es meine engste Heimat zu nennen. Mit allen Dingen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben und die mir auf Schritt und Tritt eine Geschichte erzählen. Denn das tun sie zuverlässig, es genügt, dass ich ans erstbeste Bücherregal trete.
Die Liebe zu den Dingen habe ich von meiner Mutter und deren Mutter geerbt, definitiv nicht von meinem Vater, der alles so schnell wie möglich wegwarf und nach seinem Tod nichts Persönliches hinterließ. Meine Mutter dagegen war eine Sammlerin vor dem Herrn. Als sie mit fast siebenundneunzig Jahren starb, hinterließ sie unzählige Bücher, Fotos, Diapositive, Ansichtskarten, Briefe, Reisenotizen, Filme, Schals, Taschen, Muscheln, Korallen. Ich kann es nicht aufzählen. Weiß nur, dass das Persönliche aufbewahrt sein will, oder wenigstens der wichtigste Teil davon. Das chinesische Lackschränkchen mit frühen Kinderzeichnungen und einer in Seidenpapier eingewickelten Locke (ihrer eigenen?), die winzige Porzellanuhr in der Vitrine, ein Aquarell, das über ihrem Bett hing. Bin ich sentimental? Wenn ja, dann so wie sie. Und wie ihre Mutter, die aus Rimavská Sobota mit zwei riesigen Holzkisten zu ihrer Tochter gezogen war. Auch sie enthielten tausenderlei Dinge, aus denen sich ganze Biographien herausschälten. Und während ich stockfleckige Tischwäsche, uralte Häkelarbeiten und die Perlen von Rosenkränzen anfasste, versank ich in einer mir unbekannten Vergangenheit.
Aus dieser Begegnung entstanden ein paar Gedichte. Zum Beispiel »Die Schachtel«:
Drei Rosenkränze, zwanzig
Heiligenbilder, fünf Gebetbücher,
fehlt die Wollmütze. Die hast
du doch gebraucht für eisige
Gottesdienste, Jolán. Ich sehe
dein eingefallenes Wangenfleisch,
die knochigen Hände. Fotos
trügen nicht. Oder doch? Dein
Beten rufen sie nicht wach. Und
die Knospen des Rosenkranzes
sind verschlossen. Vielleicht
warst du ein Singvogel, eine
Nonne, ein fernes Geheimnis.
Vielleicht hast du über Notizheften
gezittert und vor dem Kreuz in
der Theklakirche. Mit kaltem
Atem. Ich weiß es nicht. Die
Beichtspiegel schweigen, es
schweigt der Kerzenstummel.
Du hast geglaubt. Oder nicht?
Sonst wäre die Schachtel längst
zugeschneit und dein bettelndes
Haar verstreut. Aber nein. Grab,
Kranz, der Flügel des Engels.
So ruhst du dort, am richtigen
Ort. Niemand wird dich stören.
Dinge inspirieren zu Dialogen, die sich weiter und weiter spinnen. Und selbst ihr Verschwinden ruft nach der Fortsetzung des Gesprächs.
Übrigens gibt es einen Schriftsteller, der sich ungemein subtil mit Dingen beschäftigt hat: Francis Ponge. Sein Buch über »Die Seife«, diesen scheinbar banalen Alltagsgegenstand, ist an Phantasie und Poesie nicht zu übertreffen. Das zeigt schon folgende Charakteristik:
»Dieses Ei, diese platte
Scholle, – diese kleine
Mandel, die sich
so schnell verwandelt
(im Handumdrehen)
in einen chinesischen Fisch
Mit seinen Schleiern, seinen Kimonos
weiten Ärmeln
So feiert sie ihre Hochzeit
mit dem Wasser. Das ist ihr Wasserhochzeitskleid.«
Warum gerade die Seife? Ponge führt lebensgeschichtliche Gründe an: »Auch weil wir damals in grausamer, unvorstellbarer, absurder Weise die Seife (wie verschiedene notwendige Dinge in jener Zeit: Brot, Kohle, Kartoffeln) entbehren mussten, haben wir sie geliebt, geschätzt und nachgerade posthum in unserer Erinnerung genossen, mit dem Wunsch, sie neu zu schaffen im Gedicht … Auf der Suche nach der verlorenen Seife …«
Emotion ist also durchaus im Spiel.
In anderen Texten bringt Ponge Kieselsteine, Kerzen, ja sogar Waschkessel zum Sprechen, nicht zu vergessen seine »Unvollendete Ode auf den Schlamm«. Darin liegt eine gewisse Rehabilitierung der oft zu Unrecht verachteten, stiefmütterlich behandelten Dinge. Mehr noch: ihre Erweckung zum Leben.
Engel
Ob ich an sie glaube, weiß ich nicht so recht, aber irgendwie erscheinen sie mir plausibel. Unsichtbare Wesen, die uns manchmal zur Seite stehen, uns unter ihre Fittiche nehmen, und wieder verschwinden.
Die Ikonographie ist voll von ihnen. Byzantinische Mosaiken und Fresken zeigen sie mit herben Gesichtern, weißgewandet, mit großen Flügeln, androgyn und ehrfurchtgebietend. In Bewegung dagegen sind die eleganten Verkündigungsengel bei Tizian oder Tintoretto. Nur die Barockengel und -putten wirken dümmlich in ihrer Pummeligkeit.
In der Erzählung »Bondo« habe ich einen Engel eingeführt, der aus seiner erhöhten Perspektive Zeiten und Ereignisse überblickt, die unsereins nur bruchstückhaft zu erfassen und wiederzugeben vermag. Er wird mir zum Wort- und Taktgeber. Zu einer Ruhe verströmenden, nahfernen Instanz.
So ganz anders sind Engel ja nicht, wir imaginieren sie als Mittler und erkennen mitunter auch im Menschen engelhafte Züge. Steven Pinker, Psychologe an der Harvard University, stellte denn auch die bedenkenswerte Frage: »Wie können wir die besseren Engel unseres Wesens an die Macht bringen?«
Das setzt voraus, dass wir Engel in uns bergen, und zwar gute und schlechte. Tatsächlich weiß die Angelologie auch um den gefallenen Engel Luzifer, der im Alten wie im Neuen Testament mit Satan gleichgesetzt wird. Doch wird das meist verdrängt.
Wenn ich einen Freund, der mich nach einem doppelten Knochenbruch aus der Provence nach Zürich gefahren und vor dem Eingang des Krankenhauses abgesetzt hat, einen Engel nenne, weiß ich, warum. Und wenn ich meinem erwachsenen Sohn auf Ungarisch immer noch »mein Engelchen« zurufe, hat das seinen guten Grund. Mit dem Wort verbindet sich Güte, Licht und Zärtlichkeit. Halten wir also daran fest.
Esterházy (»Péterke, mein Engel«)
»Er ist kein verruchter Erzengel wie Danilo Kiš, gleichwohl ein Engel. Weder geschlechtslos noch fad, weder heilig noch hehr, aber doch. Ein zarter Lockenkopf mit schelmisch blickenden Augen und weichem Händedruck, mit feinbesaiteter Seele und elastischem Gang. Geht er nicht auf Zehenspitzen (on tiptoe)? Das wippt und schwebt, und wenn er erzählt, formen seine Hände etwas Rundes: zwei Parenthesen um ein imaginäres Kleinod.
Sein Lachen: eine Sache für sich. Es kommt Rabelais’sch aus dem Bauch, herzhaft und groß. Doch am schönsten ist, wenn er sich wundert. Der ganze Mann ein Kind: ›Ach, oh!‹ Mit singendem Tonfall, man kann ihn nur mögen für solche innocence.
Dabei ist er kein Naiver. Sein vertrackter Witz folgt der Losung: ›Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.‹ Mit mathematisch grundierter Paradoxiefähigkeit treibt er alles zärtlich auf die Spitze. Da stehen wir dann, düpiert, amüsiert, bereit, ihm die schneidendsten Anwürfe zu verzeihen. Denn auch seine Stacheln streicheln, so ist es nun mal bei Engeln.«
Das schrieb ich 1999 und bin ihm danach viele Male begegnet, in Berlin und Budapest, Zürich und London, ja selbst in meinem Geburtsort Rimavská Sobota, wohin uns eine Lesung führte und wo wir ungebührlich viel lachten. Wir lachten auch ausgiebig an einem Abend in der Berliner Auguststraße 83, zu dem neben mir Imre Kertész mit seiner Frau geladen war. Es gab pikante Gulaschsuppe und kräftigen Rotwein, gegen Mitternacht wetzten die Herren die Wortsäbel, unter großem Gelächter. Dann folgten politische Witze.
Wenig später verließen die Esterházys die geräumige Gastwohnung. Als ich ein letztes Mal vorbeikam, um mich zu verabschieden, sah ich Péter verzweifelt in seinem Zimmer, umgeben von zig Plastiktüten, und noch immer stapelten sich Bücher, Papiere, Zeitungsartikel. Wegwerfen geht nicht (er ist ein Sammler wie ich), doch wie die vielen Zettel und sonstigen Haufen verpacken, ohne dass ihre »Ordnung« Schaden nimmt? Was nämlich nach Unordnung aussieht, ist keine. Péter reibt sich nervös die Hände, runde, sinnliche Hände, die den exzellenten Koch verraten. (Nie habe ich erfahren, wie er das Ordnungsproblem gelöst hat.)
Esterházy: barock und pfiffig, paradox und a bisserl melancholisch, liebt Gedankenpirouetten, Spiel, Camouflage, Alberei. Das Veto gilt biederer Vereinfachung und vorwitzigem Besserwissen ohne Humor. Auf diese Weise sind so wunderbare Bücher wie »Die Hilfsverben des Herzens«, »Das Buch Hrabals«, »Harmonia Caelestis« oder »Die Markus-Version« entstanden. Und der immerkluge Gesprächsband »Die Flucht der Jahre«.
Über das im Angesicht des Todes geschriebene »Bauchspeicheldrüsentagebuch« nur soviel: es kennt keine Larmoyanz. Das nennt sich Würde, Contenance. Péterke, du bist ein Engel.
Zum allerletzten Mal sah ich Esterházy auf der Budapester Buchmesse im April 2016. Schmal stand er in den hinteren Reihen, als ich aus »Love after love« las. Später signierte er mir ein Buch, und zum Abendessen trafen wir uns alle in einem Lokal, in das der Magvető Verlag seine Autoren geladen hatte. Er saß nicht neben mir, doch konnte ich mich mit ihm unterhalten. Wobei er lieber zuhörte, was andere ihm zu erzählen hatten. Zu meinem Erstaunen bestellte er Deftiges und trank dazu Rotwein. Niemand hinderte ihn. Noch vor elf wurde er plötzlich unruhig und forderte seine Frau auf, ein Taxi zu bestellen. Sie ließ sich etwas Zeit. Da erhob er sich ungehalten, zog den Regenmantel an und verließ grußlos das Lokal. Ich sah ihn auf die Straße eilen, der helle Mantel flatterte im Wind. Dieses Rückenbild ist mir geblieben. Leicht unscharf wie ein verwackeltes Foto.
Péter starb am 14. Juli 2016, beigesetzt wurde er in der Familiengruft in Ganna. Ich vermute ihn in Engelsgesellschaft, doch mit Gourmetköchen.
Erinnerung
Was bedeuten dir Erinnerungen, wie gehst du mit ihnen um?
Es sind viele – und werden natürlich immer mehr. In meinem Alter blickt man schon mehr zurück als nach vorn, die Vergangenheit staut sich, während die Zukunft schrumpft. Mein Erinnerungsbuch »Mehr Meer« habe ich mit Ende fünfzig geschrieben, einem starken inneren Drang gehorchend. Jetzt oder nie, als hätte ich keine Wahl. Tatsächlich ließen mich einige frühkindliche Erlebnisse und Bilder nicht in Ruhe, sie bildeten gleichsam Erinnerungskristalle, an die sich weitere Erinnerungen hefteten. Doch erst während des Schreibens wurde aus den Splittern ein Kaleidoskop. Plötzlich fielen mir Dinge ein, die ich für vergessen und verschüttet hielt, aus einem Geruch entwickelte sich eine Geschichte. Ein banaler »Mohrenkopf« wurde zu meiner Madeleine.
Das Gedächtnis ist faszinierend in seiner Vertracktheit – und tückisch. Was es ausspuckt, muss nicht objektiven Tatsachen entsprechen. Erinnerungen sind formbar, können sich im Lauf der Zeit verändern. Vor allem wenn man sie mit anderen teilt, werden sie »überschrieben«, umcodiert. Immer wieder habe ich mich gefragt, ob meine Erinnerungen an Triest von damals stammten oder aus späteren Erzählungen meiner Mutter. Vielleicht sind sie das Ergebnis einer Doppelbelichtung? Wie auch immer, irgendwann setzt sich eine Version fest, behauptet sich als authentisch und wahr. Wobei es sich um eine sehr subjektive Wahrheit handelt.
Beim Schreiben kommt hinzu, dass die Phantasie rasch zur Hand ist. Kaum tut sich eine Erinnerungslücke auf, springt sie hinein und füllt sie aus. Dies geschieht fast unbewusst, aber höchst erfolgreich. Dann haben wir, statt einer rudimentären Skizze, plötzlich ein farbiges Bild vor uns, anschaulich und sinnlich. (Von Ausschmückung würde ich aber nicht reden, das klingt zu dekorativ.) Verboten ist das nicht, jedenfalls nicht in einem autofiktionalen Buch wie »Mehr Meer«, das sich dem Memoiren-Genre von der ersten Seite an verweigert.
Im Kapitel »Garten, Züge« habe ich meine Erinnerungen imaginär ergänzt und erweitert, indem ich in lyrischen, durch Kursivierung ausgezeichneten Passagen das Paradiesische des Gartens und das Bedrohliche der nächtlich rangierenden Züge verdichtete. Es gibt Litaneien von Blumen- und Pflanzennamen und andere, düstere, die an Deportationen denken lassen. Klar, entstammen diese Passagen nicht der Kinderperspektive.
An mehreren Stellen des Buchs habe ich die Erinnerungsarbeit offengelegt und reflektiert, man soll mir nicht Naivität nachsagen. So heißt es im Kapitel »Vergessen«: »Erinnerung ist Erinnerung, auch wenn sie da und dort Lücken aufweist. Es gibt Risse im Film. Pausen. Ist das schlimm? Der Körper hat das Recht, sich zu entlasten. Auf eine Tabula rasa ist er nicht aus.«
Ich weiß nicht, ob ich Annie Ernaux zustimme, die in »Die Jahre« schreibt: »Wie das sexuelle Verlangen ist auch die Erinnerung endlos. Sie stellt Lebende und Tote nebeneinander, reale und imaginäre Personen, eigene Träume und die Geschichte.« Die Erinnerung? Es gibt meines Erachtens nur Erinnerungen in der Mehrzahl, und diese bilden kein Kontinuum, sie sind durchlöchert von Vergessen. Und manchmal liegen sie so tief vergraben, dass man sie wie einen Schatz heben muss. Wobei dieses »Heben« schnell gehen kann. Ein Zufall, ein Gespräch, ein Foto, ein Geruch – und plötzlich steigt etwas auf und ist da. Heureka!
Aber Erinnerungen können doch auch verblassen.
Manche tun es, weil sie von neuen Erlebnissen überlagert werden. Nach meiner Erfahrung verblasst nur, was nicht so wichtig war. Anderes ist frisch, als wäre es vor einer Woche geschehen. Der Körper speichert, doch die Engramme sind höchst unterschiedlich. An die Geburt meines Sohns kann ich mich lebhaft, in allen Details, erinnern. An einen Liebesschmerz vor zwanzig Jahren ebenfalls. Empfindungen, vermischt mit gestochen scharfen Bildern – und jederzeit abrufbar.
Das gilt auch für viele Eindrücke aus meiner frühen Kindheit. Einige waren angstbesetzt: die fauchend rangierenden Nachtzüge in Ljubljana; die Bora in Triest, die an einem hellichten Wintertag auf dem Viadukt von Barcola das Dach eines Zuges wegriss; der Skorpion unter meinem Kopfkissen …
In »Mehr Meer« verwendest du mehrmals den Ausdruck Palimpsest. Gilt das für das Leben ebenso wie für die Erinnerung?
Das Bild gefällt mir: ein beschriebenes, abgeschabtes und wieder neu beschriebenes Pergament. Die Idee der Schichtungen und Überlagerungen. Nun ja, man tut gut daran, seine eigenen Verkrustungen von Zeit zu Zeit wegzukratzen, um lebendig zu bleiben. Um das Staunen nicht zu verlernen. In jedem von uns steckt das Kind von damals, und dieses Kind reckt mahnend den Finger: schau hin, fall nicht in die Routine. Ich mag das Kind in mir, dieses neugierige Wesen. Und versuche mir den staunenden Blick »wie zum ersten Mal« zu erhalten. Egal, ob ich schon 5795 Sonnenaufgänge und mehr gesehen habe, der von heute verdient meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Überhaupt: was gilt es nicht alles zu entdecken und in das bereits Erlebte einzulagern. Irgendwie glaube ich daran, dass nichts verloren ist. Und mit Edith Piaf: »Je ne regrette rien.«
Einsamkeit
Einsamkeit spielt in deinem Denken und Schreiben eine wichtige Rolle. Warum?
Bewusst beschäftigt mich das Thema etwa seit meinem elften Lebensjahr, als ich anfing, Dostojewskij zu lesen und über das Menschlich-Allzumenschliche nachzudenken. Einsamkeit ist eine menschliche Grundbefindlichkeit, niemand kommt um sie herum. Sie kann bedrückend sein, aber auch beglückend. Weshalb viele Sprachen zwei Ausdrücke für sie haben. Im Englischen spricht man von »loneliness« und »lonesomeness« für die negative Einsamkeit, von »solitude«, wenn sie positiv gemeint ist (wie in Purcells »O solitude, my sweetest choice…«), das Russische unterscheidet zwischen »odinočestvo« und »uedinenie«. Darüber habe ich mir in meiner Dissertation zum »Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur« einige Gedanken gemacht. Die Idee kam von meinem Slawistikprofessor, und er lag nicht falsch. Ich bin zweifellos einsamkeitsaffin, kann der Sache viel abgewinnen.
Insbesondere dem positiven, schöpferischen Aspekt der Einsamkeit. Das begann mit dem »Zimmer für mich allein«, das mir Raum für Stille und Kontemplation bot. Auch anderswo suchte und fand ich Nischen des Nicht-Trubels: in Kirchen, Parks usw. Schon früh bin ich allein gereist. Die Ungeschütztheit solchen Unterwegsseins hat meine Sinne geschärft und immer wieder zu wunderbaren, unverhofften Begegnungen geführt. Nein, ich bin nicht menschenscheu oder ungesellig, ich brauche nur eine gesunde Portion Einsamkeit, um im Gleichgewicht und schöpferisch zu sein.
Das soll nicht nach Idealisierung klingen. Denn es gibt genug ungesunde Aspekte der Einsamkeit. Ein Zuviel reicht, um unglücklich zu sein. Mit Erschütterung las ich, dass in Großbritannien 2018 ein »Ministry of Loneliness« ins Leben gerufen wurde, da nach Angaben des Roten Kreuzes gut 13 Prozent der Bevölkerung, also mehr als neun Millionen Bürger, sich allein fühlen und etwa 200.000 Senioren höchstens einmal im Monat ein Gespräch mit Freunden oder Verwandten führen. Ein deprimierender Befund. Und laut Ärzten gefährlich, könne Einsamkeit doch Herzkrankheiten, Angstzustände, ja Demenz befördern.
Selbst in Russland, wo Einsamkeit zu Sowjetzeiten als westlich dekadentes Phänomen verpönt war, findet man nun Sachbuch-Ratgeber, wie der Einsamkeitsfalle zu entkommen sei. Einige sind von der orthodoxen Kirche finanziert, die sich in der Pflicht sieht, für religiöse Geborgenheit und Gemeinschaftlichkeit zu sorgen. Und tatsächlich Erfolge erzielt. Die Gotteshäuser sind voll. Andererseits schreitet die Vereinzelung, zumindest in den Großstädten, weiter voran, wenn auch weniger schnell als im Westen.
Seit Jahrzehnten sammle ich Bücher zur Einsamkeit – philosophische, soziologische, literaturgeschichtliche, literarische –, immer neue kommen hinzu. Zwei Anthologien mit dem Titel »Einsamkeiten« habe ich selber herausgegeben. Die Mehrzahl Einsamkeiten ist zutreffend, denn es gibt zahllose Spielarten dessen, was wir auf die Schnelle als Einsamkeit bezeichnen. Eine der traurigsten heißt: Einsamkeit zu zweit. Ziemlich neu und beängstigend ist die Einsamkeit des Computer-Autisten (-Junkies), der nur noch virtuell kommuniziert, bis seine Berührungsängste in bezug auf die Wirklichkeit in einer Entzugsklinik enden.
Mein Herz schlägt für den stillen, konzentrierten Dialog mit dem Buch. Zu dem auch das Schreiben gehört. Wie heißt es doch in Kafkas Brief an Felice (14./15. Januar 1913): »Schreiben heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß … Deshalb kann man nicht genug allein sein, wenn man schreibt, deshalb kann es nicht still genug um einen sein, wenn man schreibt, die Nacht ist noch zu wenig Nacht. Deshalb kann nicht genug Zeit einem zur Verfügung stehen, denn die Wege sind lang, und man irrt leicht ab …«
Klingt das anachronistisch? Für mein Ohr nicht, die ich es nicht fertigbringe, in Zügen, Cafés, Flugzeugen zu schreiben, sozusagen »en passage« und »en route«, obwohl eine anonyme Umgebung das Alleinsein nicht stört. Der Lärm tut es, die Unruhe.
Schönes Paradox: Was in der Kapsel des Alleinseins schreibend entsteht, hat viele Stimmen. Und ist adressiert. Nicht ans Ich, sondern an andere. Hallo, let me reach you. Dieser Ruf ist jeder Zeile immanent.
Dass meine literarischen Figuren oft einsam und nomadisch sind, unverwurzelt und suchend, hat in erster Linie mit mir und meiner Imagination zu tun. In zweiter Linie aber mit unserer zunehmend zugigen, von Migrationen geprägten Welt. Menschen, wie ich sie in meinem Erzählungsband »Einsamkeit mit rollendem r« schildere, gibt es heute zu Tausenden. Ihr Inneres allerdings trägt oft meine Züge, ebenso wie ihre Sprache. Bei mir kenne ich mich nun mal am besten aus. Doch die Schicksale meiner Figuren erfinde ich frei, unter der Hand entstehen da Biographien, die meiner eigenen nicht im Geringsten gleichen. Ich muss nur lange genug in mich hineinhorchen. Womit wir wieder beim Alleinsein wären.
Vorhin hast du Kafka zitiert. Gibt es Äußerungen anderer Autoren zur Einsamkeit, die dich besonders beeindrucken?
Da könnte ich viele nennen, von Camus bis Ingeborg Bachmann und Elias Canetti. Besonders originell ist, was der große Naturbewunderer H.D. Thoreau in »Walden« schreibt: »Gott ist allein – aber der Teufel ist weit entfernt vom Alleinsein; der hat Gesellschaft genug; er ist Legion. Ich bin nicht einsamer als ein einzelnes Wollkräutchen oder eine Löwenzahnblüte auf der Weide, eine Pferdefliege oder eine bescheidene Biene. Ich bin nicht einsamer als der Wetterhahn, der Nordstern, der Südwind, ein Aprilschauer, Januartauwetter oder die erste Spinne in einem neuen Haus.« Das klingt für heutige Ohren etwas seltsam, aber warum nicht. Vielleicht sollten wir unsern zeitgenössischen urbanen – und digitalen – Solipsismus relativieren.
Freundschaft
Ohne Freundschaften könnte ich nicht leben oder, zugespitzter, überleben. Da geht es um Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Treue, um eine Liebe, die – jenseits aller Erotik – maximale Zuwendung und Akzeptanz bedeutet. Was Kritik nicht ausschließt, keineswegs. Freunde sollen einem einen Spiegel vorhalten, sie haben das Recht, einen zu necken, zu hinterfragen, mit unangenehmen Tatsachen zu konfrontieren. Immer vorausgesetzt, sie tun es loyal.