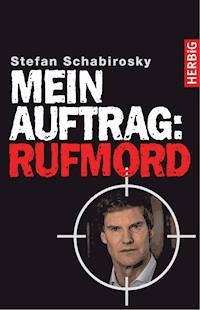
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Es ist die groesste Rufmord-Kampagne der deutschen Wirtschaftsgeschichte: Mehr als zehn Jahre lang setzte ein Insider alles daran, das Ansehen des bekanntesten deutschen Unternehmers der Finanzwelt zu ruinieren. Carsten Maschmeyer und der von ihm gegruendete AWD waren Zielscheibe von Stefan Schabirosky. Im Auftrag des groessten AWD-Konkurrenten entwickelte dieser seinen teuflischen Plan. In seiner dramatischen Enthuellungsgeschichte beschreibt der ehemalige Handelsvertreter, wie er Staatsanwaelte taeuschte, Boersenkurse manipulierte und Deutschlands Top-Journalisten instrumentalisierte. Ein wahrer Krimi, der die Wirtschaft, Medien und Politik in ihren Grundfesten erschuettern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: 2017 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagfoto: Isadora Tast
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Satz und eBook-Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7766-8269-4
Inhalt
1 | Beschnüffeln mit dem Auftraggeber
2 | Der Deal auf dem Flughafen
3 | Mein Einstieg in die AWD-Welt
4 | Gier oder Angst
5 | Mein ganz persönliches Nine Eleven
6 | Mein Abschied vom AWD
7 | Ein Unglück kommt selten allein
8 | Die Hatz beginnt
9 | Erste Schritte im Mediendschungel
10 | Die Meute hat Blut geleckt
11 | Dem Jackpot ganz nah
12 | Wo die Zitronen blühn
13 | Im Spiegel der Presse
14 | Als Rufmörder mit dem Latein am Ende
15 | Der große Datenklau
16 | Wetten gegen den AWD?
17 | Der Tschakka-König macht dem AWD Konkurrenz
18 | Kampf an allen Fronten
19 | Wirft Maschi das Handtuch?
20 | Die DVAG spielt auf Zeit
21 | Mein Flop an der Börse
22 | Als falscher Kronzeuge für den NDR
23 | Zu Weihnachten: das geklaute Herz des AWD
24 | »Vor Gericht und auf hoher See …«
25 | Fake News oder was? – Maschmeyer wird zum NDR-Hauptdarsteller
26 | Meine Wohnung wird durchsucht
27 | Medialer Spießrutenlauf
28 | Endlich: Zwei Angebote
29 | Wie Friedrich Bohl aus mir einen Spion machen wollte
30 | »Die Schöne und das Biest«
31 | Als ich endlich aufgewacht bin!
Epilog
Die Dokumente
Wie alles anfing
Das vorläufige Ende
Nachschlag
Alles bezahlt
Im engsten Kreis
Die Süddeutsche Zeitung spielt mit
Der stern spricht mit Maschmeyer und mir
Der SPIEGEL will mehr
Der Vernichtungsfeldzug
Das Fernsehen darf nicht fehlen
Krieg im Netz
Mandant will nicht genannt werden
Sturm im Blätterwald
Friedrich Bohl veranlasste meine Zahlung
Mit der DVAG ins Geschäft gekommen
Glossar
Anmerkungen
Quellenverzeichnis
»Ach, wenn wir schon von Werteverfall reden wollen, da kommen mir viel eher die Usancen in den Vorständen großer deutscher Konzerne in den Sinn. Da wird häufig nach der Maxime gehandelt: Was dem anderen schadet, nützt mir. So etwas ist natürlich kein Wert, sondern ein ›Unwert‹.«
Reinfried Pohl, Gründer der Deutschen Vermögensberatung (DVAG)[1]
1 | Beschnüffeln mit dem Auftraggeber
Sie hatten mich nach Frankfurt eingeladen. Hamburg – Frankfurt, Hin- und Rückflug mit der Lufthansa. Das kostete im Oktober 2003 noch richtiges Geld. Ich hielt das für ein gutes Zeichen. »Die wollen dich, Stefan«, sagte ich mir, als das Flugticket vor mir auf dem Schreibtisch lag. »Die brauchen dich.«
Der Flieger hob um Viertel nach elf in Hamburg ab und landete eine Stunde später in Frankfurt. Das Wetter am Main war genauso bescheiden wie an der Elbe. Aber ich musste nicht raus in den Regen. Das Sheraton Hotel ist über einen langen, breiten Gang mit dem Terminal verbunden. Den stiefelte ich entlang und kontrollierte mein Outfit in den Glasfronten: dunkelbrauner Anzug, weißes Hemd, dunkelrote Krawatte, silberne Manschettenknöpfe, schwarze, durchgenähte Schuhe. So war ich auch bei meinen Kunden aufgetreten. Seriös.
Wir waren um eins in der Lobby des Sheraton verabredet. Jetzt war es Viertel vor. Ich scannte die riesige Empfangshalle nach meinem Ansprechpartner ab. Er war noch nicht da. Also setzte ich mich an einen kleinen, runden Tisch mit drei Sesseln ein Stück abseits der Bar und bestellte eine Cola mit Eis und Zitrone.
Ich war nicht nervös. Konzepte vorgestellt hatte ich bei Kunden schon hunderte Mal. Das kann ich. Auf eineinhalb Seiten hatte ich meine Strategie zusammengefasst. Ein Fünf-Punkte-Plan zur Zerstörung der Firma, für die ich elf Jahre gearbeitet hatte. Einen Titel hatte ich dem Ganzen auch gegeben: »Unternehmen Donnerwetter«. Hörte sich ein bisschen großspurig an. Aber der Plan hat funktioniert.
Kurz vor eins sah ich ihn kommen. Joachim Ernst war ein sportlicher Typ um die fünfzig. Wir hatten im Sommer in Hamburg Kontakt aufgenommen. In den nächsten Jahren sollte er eine Art ›Führungsoffizier‹ für mich werden. Ernst arbeitete allerdings nicht für die Stasi. Er war Direktor bei der Deutschen Vermögensberatung AG. Das war ein dicker Brocken: dreißigtausend Mitarbeiter, vier Millionen Kunden, zwanzig Milliarden Vermittlungsumsatz im Jahr. Ernst unterstand das ganze Heer der Vertriebsmitarbeiter der DVAG. Hatte er mir in Hamburg erzählt.
Über mein Angebot konnte Joachim Ernst trotzdem nicht allein entscheiden. Er hatte einen zweiten Mann im Schlepp. Scherzend kamen sie durch die Sheraton-Lobby auf mich zu. Ernsts Begleiter war vielleicht zehn Jahre älter als er. Er hatte schüttere Haare und ein weiches Gesicht mit einem vollen, fast weiblichen Mund. Bekleidet war er konservativ und nicht übermäßig teuer.
Ich stand auf, als die beiden Männer an meinen Tisch traten. Joachim Ernst begrüßte mich und stellte seinen Begleiter vor.
»Herrn Bohl kennen Sie ja sicherlich. Früherer Kanzleramtsminister. Die rechte Hand von Helmut Kohl.«
»Na selbstverständlich. Guten Tag, Herr Bohl.«
Ich schüttelte die weiche Hand des Ex-Politikers und ließ mir meine Überraschung nicht anmerken. Friedrich Bohl war Vorstand für »Konzernsekretariat, Recht, Öffentlichkeitsarbeit, Verbände« und galt als zweiter Mann der DVAG. Nach Kohls Abwahl war er, wie andere CDU-Politiker vor und nach ihm, mit einem gut dotierten Job beim Frankfurter Finanzdienstleister versorgt worden. DVAG-Gründer Reinfried Pohl gehörte seit langem der CDU an. Der Milliardär spendete fleißig für die Partei. Er galt als enger Freund Helmut Kohls.
Bohl, Pohl, Kohl. Mich schwindelte bei diesen großen Namen aus Wirtschaft und Politik. Es war wohl eine Art Höhenrausch. Mit Männern dieser Flughöhe hatte ich noch nie zu tun gehabt. Ich stamme aus einer Kleine-Leute-Familie aus Norderstedt bei Hamburg.
Friedrich Bohl machte mir die Sache leicht. Er hat eine sehr warme, fast herzliche Art im Umgang. Und er war sehr an dem interessiert, was ich zu bieten hatte. Schließlich kam ich von der Konkurrenz, die seinem Unternehmen schwer zu schaffen machte. DVAG-Chef Reinfried Pohl war zwar der Platzhirsch unter den deutschen Finanzdienstleistern, aber ein junger Herausforderer machte ihm das Rudel streitig. Sein Name: Carsten Maschmeyer; er hatte seinen Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD) 1988 gegründet, fünfzehn Jahre nach der Entstehung der DVAG. Doch der Vorsprung der Frankfurter schmolz, weil der AWD deutlich schneller wuchs. Die AWD-Zahlen sprachen für sich: Jetzt schon sechstausend Mitarbeiter, eineinhalb Millionen Kunden, 12 Milliarden Vermittlungsumsatz im Jahr. Höhere Steigerung bei Kunden, Mitarbeitern, Bewerbern, überall holte Maschmeyers Firma auf. Es war ein Kampf der Giganten. Es ging um mehr als dreißig Millionen Finanzverträge und um insgesamt fünfhundert Milliarden Euro Vertragsvolumen. Zwei Milliardäre, beide jeweils an der Spitze der zwei größten deutschen Finanzvertriebe, standen sich in diesem Kampf mit ganz unterschiedlichen Beratungssystemen gegenüber: der eine, einst befreundet mit Bundeskanzler Helmut Kohl; der andere mit dessen Nachfolger im Kanzleramt, Gerhard Schröder. der eine bewahrend, konservativ; der andere aufstrebend, innovativ. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Newcomer aus Hannover die DVAG von der Spitze verdrängen würde, da die Frankfurter im Versicherungsbereich fast ausschließlich die Produkte der an ihr wesentlich beteiligten Muttergesellschaft, der Generali Gruppe anboten. Die Frankfurter hatten also ein Problem gegenüber der unabhängigen Herstellerauswahl des AWD. Und ich war der Mann, der ihnen helfen konnte, es zu lösen.
»Nun, Herr Bohl, wie sie von Herrn Ernst sicher wissen, habe ich elf Jahre für Maschmeyers Allgemeinen Wirtschaftsdienst gearbeitet«, begann ich. »Ich habe hervorragende Kunden aufgebaut. In der Regel waren das Prokuristen und Geschäftsführer. Ich habe vor allem Lebensversicherungen und Fondsbeteiligungen verkauft. Mein durchschnittlicher Jahresumsatz lag bei vier Millionen, meine Stornoquote unter zwei Prozent. Würden alle Finanzberater so viel Umsatz schreiben wie ich, wäre der Umsatz des AWD von heute auf morgen doppelt so hoch.«
Die Herren von der DVAG sahen mich fragend an. »Und warum sind Sie dann beim AWD ausgeschieden?«
Gute Frage. Hätte ich auch gestellt. Wie vieles im Leben hatte mein Abgang mit einer Frauengeschichte angefangen. Aber das wollte ich den DVAG-Bossen nicht auf die Nase binden. Ich erzählte ihnen von den Vorwürfen, die ich im Anschluss an eine AWD-Tagung einem der Vertriebsdirektoren gemacht hatte. Ich hatte damals kein Blatt vor den Mund genommen und mich richtig in Rage geredet. Daraufhin hatte der AWD meinen Vertrag gekündigt. Das war noch nicht alles gewesen. In einem Gespräch mit einem Rechtsanwalt und dem Justiziar des AWD drohte ich damit, die Kunden, denen ich sogenannte geschlossene Immobilienfonds verkauft hatte, über die Verluste dieses Investments aufzuklären. Der AWD zeigte mich deshalb wegen versuchter Erpressung an. Als das Schreiben der Staatsanwaltschaft in meinem Briefkasten lag, rief ich noch am gleichen Tag bei der DVAG in Frankfurt an und vereinbarte einen kurzfristigen persönlichen Termin.
»Ich will mich an denen rächen, Herr Bohl. Ich kenne alle Interna, auch die Schwachstellen des AWD. Ich weiß, wie man selbst die positiven Dinge total negativ darstellen kann.«
Der Kellner kam an unseren Tisch. Joachim Ernst bestellte noch einen Espresso und ein Wasser. Friedrich Bohl kam auf die Idee, ein Glas Wein mit mir zu trinken. Wir prosteten uns mit einem ausgezeichneten trockenen Weißwein zu. Ich fühlte, dass wir uns einig werden würden. Dementsprechend selbstbewusst trug ich den beiden meinen Schlachtplan gegen den AWD vor. Ich hatte ihn in fünf Punkte unterteilt. Meine Attacken zielten auf AWD-Mitarbeiter, -Bewerber und -Kunden. Analysten, Justiz- und Steuerbehörden und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wollte ich gegen Maschmeyer aufbringen.
Die Herren von der DVAG waren angetan. »Das ist wie ein Krake. Sie greifen von allen Seiten an.« Zum Ende des Gesprächs machte ich ihnen Angst, indem ich ihnen darlegte, dass ein steigender AWD-Aktienkurs dazu führen würde, dass Maschmeyer nach Belieben Finanzvertriebe aufkaufen könnte. Da der Aktienkurs im Verhältnis zu den früheren Höchstkursen sehr niedrig ist, wird das höchstwahrscheinlich schnell passieren. »Dann wird er die DVAG in Umsatz und Gewinn überholen, glauben Sie mir. Außerdem werden die Aktienoptionen der AWD-Mitarbeiter scharf, wodurch diese enorme zusätzliche Einnahmen bekommen. Das können Sie Ihren Leuten nicht bieten.« Das saß.
Blieb nur noch die Frage des Honorars. »Was haben Sie sich denn so vorgestellt?«, fragte Bohl.
»Für mich müsste es eine sechsstellige Summe sein.«
Bohl lächelte fein. »Eine sechsstellige Summe beginnt bei einhunderttausend Euro und endet bei neunhundertneunundneunzigtausend.«
Um Zeit zu gewinnen, nahm ich einen Schluck Weißwein.
Dann geschah etwas Merkwürdiges. Joachim Ernst, der in der Hierarchie unter Bohl stand, stoppte den Honorarpoker. »Das müssen wir zuerst mit der Zentrale abklären«, sagte er in seinem leicht hessischen Singsang. »Danach können wir konkret was dazu sagen.«
Ich vermutete, dass er mit ›Zentrale‹ den DVAG-Chef Reinfried Pohl persönlich meinte. Nach meiner Meinung war er der Einzige, bei dem das Vorstandsmitglied Friedrich Bohl um Erlaubnis bitten musste.
Wir plauderten noch ein paar Minuten, Bohl beglich die Rechnung und wir verabschiedeten uns freundlich. Joachim Ernst wollte sich in der kommenden Woche bei mir melden, um einen neuen Termin abzusprechen. Ich flog zurück nach Hamburg. Über den Wolken schien die Sonne. Ich war guten Mutes. »Stefan, den Auftrag hast du im Sack«, sagte ich mir.
2 | Der Deal auf dem Flughafen
Eine Woche später klingelte mein Telefon.
»Schmidt*, Deutsche Vermögensberatung.«
Es war Joachim Ernsts Sekretärin. Wir wechselten ein paar freundliche Worte, bevor sie mich zu ihrem Chef durchstellte. Der DVAG-Direktor hielt sich nicht lange mit der Vorrede auf.
»Herr Schabirosky, wir würden Sie gern engagieren, möchten die Einzelheiten aber nicht am Telefon besprechen. Besser wir treffen uns noch mal. Wir würden das gern bei Ihnen in Hamburg machen. In zwei Wochen.«
»Sehr schön. Wann genau und wo?«
»Am Flughafen. Kennen Sie das Mövenpick-Restaurant im Terminal 2? Das obere, direkt unterm Dach?«
»Ja, kenne ich. Und wann würden Sie kommen?«
»Ich glaube, wir landen um neun Uhr dreißig. Frau Schmidt bespricht mit Ihnen die Details.«
Als ich zwei Wochen später mit dem Taxi zum Flughafen fuhr, spürte ich ein leichtes Kribbeln. Ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Krimi. Stefan Schabirosky, der Imagekiller, trifft seine Auftraggeber. Nicht im Büro der DVAG in Hamburg, sondern in der Anonymität eines Airport-Restaurants. Das war filmreif.
Um mich abzulenken, unterhielt ich mich mit dem Taxifahrer über den HSV. Bei dem Verein geht einem der Gesprächsstoff nie aus. Dann glitt ich auf Rolltreppen unters Dach des Terminals. Überall spiegelblankes Glas und mattglänzendes Metall. Unter mir das gemeine Volk in Schlangen vor den Check-ins, vor mir das Rollfeld mit den startenden Fliegern. Eine Maschine hob gerade ab und stieg in den Himmel. Genau so fühlte ich mich.
Ich scannte das Restaurant und entdeckte Bohl und Ernst an einem Tisch. Joachim Ernst stand auf, um mir ein Zeichen zu geben, wo sie saßen. Wir begrüßten uns, bestellten Getränke, machten ein paar Scherze und kamen dann zur Sache.
»Nun, Herr Schabirosky, wir haben uns das alles überlegt«, begann Friedrich Bohl. »Ihr Konzept hat uns gefallen. Herr Ernst sagte Ihnen ja bereits, dass wir Sie gerne beauftragen würden. Was halten Sie von einem Beratervertrag als Controller? Sie würden jeden Monat ein festes Einkommen beziehen. Zunächst einmal für ein Jahr. Wir dachten an fünftausend Euro zuzüglich Umsatzsteuer.«
Ich versuchte, nicht zufrieden zu lächeln. »Na ja, von fünftausend Euro kann ich natürlich nicht leben. Aber bei sechstausend ist uns doch allen geholfen.«
Bohl ging sofort darauf ein. »Na gut, dann machen wir eben sechstausend.«
Ich war obenauf und legte noch einen drauf. »Was ist denn, wenn es mir gelingt, Maschmeyer fertigzumachen? Wenn es seinen AWD so nicht mehr geben sollte? Das wäre doch wesentlich mehr wert als sechstausend Euro im Monat. Die bekommt doch jeder Abteilungsleiter.«
»Woran hatten Sie denn gedacht, Herr Schabirosky?«
»Das ist ganz einfach. Wenn es mir gelingt, Maschmeyer und den AWD fertigzumachen, dann möchte ich so viel Honorar, dass ich von den Zinsen leben kann. Den Jackpot sozusagen. Ich stelle mir schon ein paar Millionen vor.«
Damit hatten die DVAG-Männer anscheinend nicht gerechnet. Sie schauten sich irritiert an und schwiegen. Mir war klar, dass ich es höchstwahrscheinlich nicht schaffen würde, den AWD kaputtzukriegen. Falls doch, wäre das für die DVAG bis zu mehreren hundert Millionen wert. Davon wollte ich einen Anteil.
Die Deutschen Vermögensberater versteckten sich zunächst wieder hinter ihrer Zentrale. »Aber ich denke, wir kriegen das hin«, sagte Friedrich Bohl schließlich. »Wir könnten ein Erfolgshonorar in Ihren Beratervertrag aufnehmen.«
»Das hört sich doch gut an.«
»Was haben Sie als Erstes vor, Herr Schabirosky?«
»Als Erstes werde ich mal ein bisschen Unruhe stiften und zwanzig Manager und Direktoren des AWD anonym wegen Steuerhinterziehung anzeigen.«
»Na, Sie sind ja einer.«
»Als Zweites gehe ich an die Presse. Ich werde den Redaktionen stecken, dass die Klagefrist für Fondsanleger, die sich vom AWD falsch beraten fühlen, Ende nächsten Jahres abläuft. Wenn die das drucken, wird Maschmeyer von einer Klagewelle überrollt. Das ist tödlich fürs Image.«
Damals ahnte ich noch nicht, wie einfach es wurde, Carsten Maschmeyer zum Sündenbock zu machen. Dabei trug er an der Schieflage einiger geschlossener Fonds keine Schuld. Verantwortlich waren diejenigen, die diese Fonds aufgelegt und konstruiert hatten, ebenso einige Anwälte und namhafte Wirtschaftsprüfer, die mitunter – mindestens – fahrlässig gehandelt haben.
Für die nächste Zusammenkunft schlugen die Herren von der DVAG den 2. Dezember am gleichen Ort vor. Sie hätten an dem Tag ohnehin eine Firmenveranstaltung in Hamburg. Das passte doch.
Das Mövenpick im Terminal 2 des Hamburger Flughafens sollte für die nächsten sechs Jahre unser konspirativer Treffpunkt werden. Dort habe ich neue Aktionen mit meinem ›Führungsoffizier‹ abgesprochen, Erfolgsberichte erstattet und über Bonuszahlungen verhandelt.
Am 2. Dezember war es so weit: Mir wurde ein Beratervertrag mit der DVAG vorgelegt. In seinem ersten Paragraphen hieß es: »Der Berater wird ab dem 01.12.2003 als selbstständiger Berater eine schriftliche Konzeption für ein Vertriebscontrolling für die DVAG erarbeiten sowie gegebenenfalls nach einer Entscheidung des Vorstands der DVAG, diese Konzeption auch umzusetzen, den Aufbau des Vertriebscontrollings aktiv begleiten.«
Das war vollkommener Quatsch, denn ich hatte weder eine Controller-Ausbildung absolviert noch irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich. Geschweige denn, dass ich jemals als Controller gearbeitet hatte. Es handelte sich um eine Legende, hinter der sich mein wirklicher Auftrag verbarg: eine Rufmordkampagne gegen die unliebsame Konkurrenz. Ihr Ziel: Carsten Maschmeyers AWD.
Ich überflog den Text. Mich interessierte vor allem das Honorar. Es stand in Paragraph 3 und betrug monatlich sechstausend Euro. Wie abgesprochen. Friedrich Bohl zeigte mir noch die Position mit dem Erfolgshonorar, die sie in den Vertrag aufgenommen hatten.
»Also meine Herren, wenn es mir gelingt, dass es den AWD so nicht mehr gibt, dann erhalte ich von der DVAG den Jackpot. Ist das korrekt?«
»Ja, das ist korrekt.«
Dass die Formulierung im Vertrag wachsweich war, hatte ich in meiner Euphorie übersehen. »Zusätzlich kann der Berater, sofern dieser Vertrag bereits ein Jahr läuft, ein einmaliges Erfolgshonorar erhalten.« Ich habe nicht genau genug auf diese Formulierung geachtet. Für mich war dieser Papierkram nichts als Fassade.
Wir unterzeichneten also das Dokument. Friedrich Bohl für die Deutsche Vermögensberatung AG und Stefan Schabirosky als »Berater«. Mit einem Glas Wein stießen wir auf unsere Partnerschaft an.
Ich war begeistert. Für die nächsten zwölf Monate hatte ich einen Beratervertrag, der mir monatlich sechstausend Euro plus Spesen einbrachte. Das gab mir Sicherheit. Sicherheit – so etwas kannte ich bis dahin noch nicht.
3 | Mein Einstieg in die AWD-Welt
Im Leben gibt es Tage, die alles verändern. Bei manchen erinnert man sich an das Datum, bei anderen nicht. Ich weiß nur, dass der Tag, der mein Leben veränderte, ein trüber Samstag im Spätherbst 1990 war. Die letzten Blätter hingen leblos in den Bäumen. Durch die kahlen Äste tröpfelte der Regen. Ich war neunzehn Jahre alt und hatte meine Lehre als Versicherungskaufmann bei der Mannheimer abgeschlossen. Die Firma wollte mich in ein Traineeprogramm stecken, aber dazu hatte ich keine Lust. Es fiel mir schwer, von morgens um neun bis nachmittags um fünf am Schreibtisch zu hocken. Die Monotonie höhlte mich aus, stumpfte mich ab, machte mich unendlich müde. So hatte ich mir das Leben nicht vorgestellt. Das Leben sollte gefälligst Spaß machen. Das Leben sollte bloß nicht herumzicken.
Abends ging ich in die »Tenne«. Der Laden in Hamburg-Alsterdorf war so was von ›in‹. Eine Mischung aus Nachtclub und Disco, mit dicken Ledersofas und gedämpftem Licht. Sie spielten schwarze Musik, Dance Classics. Die Frauen in der Tenne hatten Groove und sahen verdammt gut aus.
Wie immer bestellte ich ein Bier. Daran wollte ich mich so lange wie möglich festhalten. Es kostete acht Mark, damals eine Unmenge Geld für mich. Ich sah mich um und entdeckte einen Bekannten. Matthias lümmelte an der Bar. Wir spielten Tischtennis im selben Verein.
Matthias winkte mich heran. Mein erster Blick fiel auf sein Glas. Whiskey auf Eis. So ein Drink kostete in der Tenne zwölf, ach was, vierzehn Mark. Matthias trug eine Fiorucci-Jeans. Seine Füße steckten in Cowboy-Stiefeln aus Paul Hundertmarks Western Store auf St. Pauli. Ein gelbes Hemd mit kleinem Krokodil spannte über seinem Bauch, am Handgelenk blitzte eine dicke Uhr. Auf seiner Stuhllehne hing eine braune Schott-Pilotenjacke mit Pelzkragen. Made in New York City. Für mich ein unerschwingliches Traumteil.
Matthias gab dem Barmann einen Wink. Schon standen eine Flasche Jack Daniel’s und ein zweites Glas auf dem Tresen. Die Pulle kostete in der Tenne über hundert Mark. Woher hatte der Kerl nur das Geld dafür?
Er erzählte es mir. Matthias war ganz heiß darauf, von seinem Super-Job und seinem Super-Leben zu berichten. Er arbeitete als selbstständiger Handelsvertreter für den Allgemeinen Wirtschaftsdienst, kurz AWD.
»Die Sache läuft richtig gut. Eine coole Erfindung, sag ich dir. Wir bieten dem Kunden die erste wirklich unabhängige Finanzberatung. Wir müssen dem nicht unsere eigenen Produkte aufschwatzen wie Versicherungsvertreter oder die Konkurrenz aus Frankfurt, die vor allem Versicherungen der AachenMünchener bzw. Generali Gruppe verkauft. Bei uns kann der Kunde aus zig Angeboten das beste wählen. Von der Allianz bis zur Zürich-Versicherung.«
Seine kleinen, freundlichen Augen funkelten, als er mir erklärte, wie leicht es sei, mit der Aussicht auf niedrige Versicherungsbeiträge, höhere Auszahlungen, Steuervorteile und staatliche Zuschüsse Menschen neugierig zu machen. »Manchmal hab ich so vielen Kunden die Finanzen verbessert, dass ich fünfzehntausend Mark im Monat verdient hab. Ist das nicht irre?«
Wenn man drei Jahre lang zwischen sieben- und neunhundert Mark Ausbildungsvergütung pro Monat bekommen hat, hören sich fünfzehntausend in der Tat gigantisch an.
Ich schaute mich in der Tenne um. Discoblitze zuckten, Beats pulsierten, Mädchen zappelten auf der Tanzfläche. Und mittendrin thronte Matthias in seinen tollen Klamotten und schlürfte Whiskey. Keine Frage, so wollte ich auch leben.
»Ich ruf dich morgen Abend um sieben an«, sagte Matthias zum Abschied.
Ich lag ausgestreckt auf dem Bett. Es war früher Sonntagabend und ich hatte nichts Besonderes vor. Mein Zimmer war fünf Meter lang und zweieinhalb Meter breit. An der zartgelb gestrichenen Wand hingen ein Michael-Jackson-Poster und die Bundesliga-Stecktabelle vom kicker. In der Ecke stand meine Sporttasche mit den ungewaschenen Klamotten. Ich hatte sie noch nicht an meine Mutter weitergereicht. Mutti war berufstätig, baute Hörgeräte zusammen. Mein Vater war in einer Bosch-Werkstatt für das Kaufmännische zuständig. Wir wohnten in einem Mietshaus in Norderstedt, einer Schlafstadt im Norden Hamburgs. Kein besonders spannendes Pflaster für einen neunzehnjährigen Jüngling, der was erleben will.
Im Flur klingelte das Telefon. Meine Mutter kam ins Zimmer. »Für dich, Stefan. Ein Matthias ist dran.«
Ich schaute auf meinen Wecker. Punkt sieben. Der Typ hielt, was er versprach. Matthias quatschte nicht lange rum. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag in seinem Büro. Es lag in Hummelsbüttel, einem der besseren Stadtteile in Hamburgs Norden. Heute würde ich über die Büroeinrichtung müde lächeln, aber damals beeindruckten mich die schwarzen Ledersofas nachhaltig. Genauso wie die Abrechnungen, die Matthias mir zeigte. Er bekam wirklich in manchen Monaten mehr als fünfzehntausend Mark Provision.
»Und was bedeutet das hier? Stornoreserve 45.000 DM?«
Matthias erklärte es mir. »Der AWD behält von meiner Provision zunächst zehn Prozent ein. Wenn zum Beispiel ein Kunde von mir seine Lebensversicherung bei der Allianz oder wem auch immer innerhalb von fünf Jahren kündigt, muss der AWD als Vermittler einen Teil der Provision zurückzahlen. Und ich eben auch. Wenn das nicht passiert, kriegt der liebe Matthias die Stornoreserve.«
»Nicht schlecht, Frau Specht.« Ich glaubte, dass diese Typen auf dem richtigen Weg waren. Nach dem Motto: Kunde viel Plus, Mitarbeiter viel Geld.
Offensichtlich war ich nicht der Erste, den Matthias als AWD-Mitarbeiter anwarb. »Klares Leistungsprinzip, ehrlicher Karriereplan, freie Zeiteinteilung, unglaubliche Einkommens- chancen.« Er schnurrte die Stichwörter nur so runter.
Matthias hatte sich auch einen kleinen Test für mich ausgedacht. Innerhalb von fünf Tagen sollte ich fünf Analysen einholen. Auf Deutsch: bei fünf potenziellenAWD-Kunden überprüfen, welche ihrer Versicherungen zu teuer waren, wo sie Steuern sparen konnten, wie eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim zu finanzieren sei.
Den Test bestand ich locker. In meinem Bekanntenkreis fand ich leicht fünf Leute, die ihre Finanzen von mir checken ließen. Schließlich war das Ganze für sie kostenlos und unverbindlich. Matthias war zufrieden und lud mich zu einer Unternehmenspräsentation des AWD ein.
Das Grand Elysée Hotel hat fünf Sterne und liegt zwischen Außenalster und Bahnhof Dammtor. Schwere Teppiche, teures Mobiliar, gut gekleidete Menschen. In einem riesigen Seminarraum hatten sich über hundert Interessenten versammelt. Ich fand einen freien Platz in der zweiten Reihe. Vorne am Stehpult hantierte ein Mann an einem Overheadprojektor.
»Das ist Kai-Uwe Harz«, raunte mir mein Sitznachbar zu. Ich hatte keinen Schimmer, wer Harz war.
»Der AWD-Landesdirektor«, flüsterte mein Nebenmann mit Ehrfurcht in der Stimme. Später erfuhr ich von Matthias, dass Harz einer der erfolgreichsten Vertriebsmanager der Szene war. Seine Mitarbeiter nannten ihn »Tiger«. Noch keine vierzig Jahre alt, erzielte er dreihundertfünfzigtausend Mark an Provisionen im Monat. Seine Karriere basierte nicht auf Beziehungen, sondern auf Leistung. Genau mein Ding.
Harz erzählte von den Problemen des Landes, der Altersstruktur in der Gesellschaft, den Rentensorgen der Menschen. Dann stimmte er das Loblied auf den AWD an.
»Der AWD machte im ersten Jahr seiner Existenz eine Milliarde Vermittlungsumsatz, meine Herren. Eine Milliarde! Und es wird ständig mehr.«
Das Goldgestell seiner Brille blitzte. »Was glauben Sie, welche Produkte der AWD anbieten kann?« Schweigen im Saal. Harz legte eine neue Folie auf den Projektor. Auf der Leinwand erschien in Großbuchstaben das Wort »ALLE«.
»Das ist einmalig, meine Herren.«
Ich war begeistert. In der Ausbildung bei der Mannheimer Versicherung hatte ich Kunden überreden müssen, eine Versicherung bei uns abzuschließen und nicht bei der billigeren Konkurrenz. Der Erfolg war bescheiden. Die Leute sind schließlich nicht blöd.
»Fragen Sie den Kunden, was er mit seinem Gewinn machen möchte«, dozierte der »Tiger« und zeigte Folien mit Traumhäusern und schicken Autos, Senioren, die Golf spielten oder sich auf einer Segeljacht tummelten.
Auch für den AWD-Vertreter werde sich die Sache lohnen, versprach Harz. »Jede Woche fünf Kunden, also einen pro Arbeitstag, so können Sie zehntausend Mark im Monat verdienen. Und sie müssen dafür niemanden über den Tisch ziehen. Also, meine Herren, worauf warten Sie noch?«
Warten? Ich wollte nicht warten. Ich war restlos überzeugt. Den Mitarbeitervertrag beim AWD, den Matthias mir am nächsten Morgen vorlegte, unterschrieb ich begeistert.
Nur eine Woche später hatte ich mein erstes Grundseminar. Ich parkte den Fiat Panda, den meine Eltern mir zur bestandenen Führerscheinprüfung geschenkt hatten, unauffällig in einer Ecke, weit weg von den beiden 7er BMWs mit den dezenten AWD-Aufklebern. Ich trug ein dunkelgraues Sakko von Hugo Boss zu meiner besten Jeans. Im Seminarraum angekommen, tippte mir jemand auf die Schulter. Am Revers trug der Mann eine goldene AWD-Anstecknadel mit drei Diamanten. Von Matthias wusste ich, was die drei Brillis bedeuteten: Der Typ war Direktionsmanager, also AWD-Boss von ganz Hamburg. Er bat mich in sein Büro. Einen Platz bot er mir dort nicht an.
»Hat man Ihnen nicht gesagt, dass Sie einen Anzug tragen müssen?«, fuhr er mich an. »Mit Jeans, das geht hier nun wirklich nicht. So können Sie an dem Seminar nicht teilnehmen.«
Mir blieb nichts anderes übrig, als nach Hause zu rasen, in eine Anzughose zu springen und zurück zum Seminar zu hetzen.
Der Mann hatte mir eine Lektion erteilt, die ich nie vergaß: Kleide dich so, dass die Kunden Respekt vor dir haben!
Der Dresscode beim AWD war simpel: Kein Hemd ist dunkler als weiß, kein Anzug heller als dunkelblau. Dezente Seidenkrawatte um den Hals gebunden, vielleicht noch ein Einstecktuch in die Anzugjacke gesteckt – und dann ab in den Einsatz. Ich schaffte mir bald silberfarbene Manschettenknöpfe an, später eine teure Uhr und Schreibzeug von Montblanc. So konnte ich auch bei besser verdienenden Kunden aufschlagen, Geschäftsführern, Prokuristen oder Ärzten. Die wussten, wie teuer das Zeug war, und schlossen daraus auf die Seriosität ihres Finanzberaters. In Billigklamotten konnte man denen nicht kommen.
4 | Gier oder Angst
Mein erstes Verkaufsgespräch führte ich mit Sarah, ich kannte sie seit langem. Sie hatte langes, seidenes Haar, eine tolle Figur und das Gesicht einer Filmschauspielerin. Mit Sarah hätte ich gern noch ganz andere Gespräche geführt, aber sie mochte mich nur als Kumpel, mehr leider nicht. Ihr Vater führte eine Firma für Betonsanierung und war bei unserem Gespräch anwesend. Er war kritisch bis misstrauisch. Trotzdem schloss Sarah eine Lebensversicherung bei mir ab, hundert Mark Prämie im Monat, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich merkte, dass ich Menschen überzeugen konnte. Ich hatte Talent, ich konnte verkaufen. Natürlich dachte ich auch an meine erste Provision – mehrere hundert Mark. Dumm nur, dass Sarahs Vater ihre Versicherung ein paar Tage später wieder kündigte. So fühlte sich also ein Storno an.
»So was soll dir nie wieder passieren, Stefan«, schwor ich mir. Und es passierte mir auch fast nicht wieder. In meinen besten Zeiten lag meine Abschlussquote bei neunzig Prozent, meine Stornoquote nahe null. Diese Zahlen erreichte ich mit einer Taktik, die eigentlich keine war: Ich war authentisch und ehrlich, zählte alle Vorteile eines Produkts auf und verschwieg die Nachteile nicht. Wenn es für den Kunden passte, dann passte es. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich versuchte, leicht und locker rüberzukommen, ohne aufdringlich zu sein. Wenn ein Kunde zwei Wochen Bedenkzeit haben wollte, bekam er die. Genau vierzehn Tage später rief ich ihn an, keinen Tag früher, keinen Tag später. Das zeigte den Leuten: Der Mann ist zuverlässig.
Es gibt zwei Gründe, aus denen ein Mensch ein Finanzprodukt abschließt: Gier oder Angst. Angst ist ein wichtiger Faktor beim Abschluss von Versicherungen. Man fürchtet sich vor den finanziellen Folgen von Krankheit oder Alter. Dagegen helfen Kranken-, Renten- oder Lebensversicherungen. Bei Aktien und Fonds geht es mehr um Gier. Man will mehr aus seinem Geld machen, als es auf dem Sparbuch versauern zu lassen.
Kundengespräche waren für mich Adrenalin pur. Entweder war die ganze Arbeit umsonst gewesen oder ich kassierte eine gute Provision. Im Schnitt dauerte die Arbeit mit einem Kunden insgesamt einen Tag. Ich fuhr hin, nahm die Analyse auf, wertete sie aus und fuhr wieder hin und machte ihm Vorschläge, wie er seine Finanzen optimieren konnte. Ich zeigte ihm, welche seiner Versicherungen er anderswo günstiger bekommen könnte. Im Prinzip war der AWD so etwas wie eine Art frühes Vergleichsportal. Kein Wunder, dass der DVAG diese freie Auswahl ein Dorn im Auge war. Heute ist es selbstverständlich, dass fast jeder die Leistungen verschiedener Versicherungen bei einem Portal checken lässt und das günstigste Angebot abschließt. Damals gab es das noch nicht. Nur der AWD machte das für seine Kundschaft.
Manchmal überlegten die Kunden es sich auch noch mal und kamen zu mir ins Büro. Und mit dem Abschluss war es nicht getan. Beim AWD war es Vorschrift, den Kunden mindestens einmal im Jahr zu besuchen, für Fragen zur Verfügung zu stehen und etwaige Anpassungen zu besprechen. Denn die Verträge liefen oft zehn, zwanzig oder dreißig Jahre.
Mein Konto füllte sich zusehends. Aber ich hatte auch Kosten. Als selbstständiger Handelsvertreter, der nicht beim AWD angestellt war, musste ich für anteilige Büromiete, Telefongebühren, Hotelübernachtungen bei Schulungsveranstaltungen selbst aufkommen. Einen Wagen brauchte ich natürlich auch. Mit meinem Fiat Panda konnte ich beim Kunden nicht auftauchen. Ich entschied mich für einen dunkelblauen VW Corrado mit einhundertneunzig PS. Das geleaste Gerät kostete mich alles in allem zehntausend Mark pro Jahr. Insgesamt waren die Kosten für einen AWD-Mann überschaubar, wenn man sich nicht den allerdicksten Schlitten vor die Tür stellte oder bei der Büroeinrichtung auf Protz schaltete. Außerdem wohnte ich immer noch bei meinen Eltern im Kinderzimmer.
Nach nur eineinhalb Jahren wurde ich zum Geschäftsstellenleiter befördert. »Tiger« Kai-Uwe Harz persönlich steckte mir die goldene AWD-Nadel mit dem kleinen Diamanten ans Revers. Es war im Juli 1992 in Bremen auf einem Treffen aller norddeutschen Vertreter, zu dem auch deren Partnerinnen oder Partner eingeladen waren. Der AWD legte großen Wert darauf, dass die Partner bei solchen Veranstaltungen zugegen waren, da die besseren Hälften gern mal meckerten, wenn der Vertreter abends oder am Wochenende zum Kundengespräch fuhr.
Harz stellte mich kurz vor: Stefan Schabirosky, seit achtzehn Monaten AWD, hat in den letzten drei Monaten viertausend eigene Einheiten geschrieben plus zweitausend mit der Gruppe. Applaus, Applaus, Applaus! Jeder Vertreter im Saal konnte sich ausrechnen, dass ich im letzten Vierteljahr vierzigtausend Mark verdient hatte. Nicht schlecht für einen Einundzwanzigjährigen. Ich schwebte auf Wolke sieben.
Bald wurde ich auch zur Jahresgala des AWD nach Hannover eingeladen, eine Veranstaltung, die einmal im Jahr im Maritim Airport Hotel stattfand. Vor tausend Leuten hielt Carsten Maschmeyer anfeuernde Reden nach dem Motto: schneller, höher, weiter. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der AWD die Konkurrenz aus Frankfurt überholt hätte. Wir johlten alle vor Begeisterung.
Leider war ich auf der ersten Geburtstagsfeier des AWD noch nicht dabei. Da war Maschmeyer auf einen Elefanten geklettert, weil es an diesem Abend um ein Projekt der AWD-Stiftung in Afrika ging. Alte Fahrensmänner erzählten die Story immer wieder gern.
Ganz so spektakulär waren die Veranstaltungen des AWD zu meiner Zeit nicht mehr. Aber auch sie hatten es in sich. Einmal sang Udo Jürgens, ein anderes Mal die Münchner Freiheit. Mal plauderte Thomas Gottschalk, mal moderierte Günther Jauch. Umrahmt wurde die Gala mit einer fulminanten Lasershow.
»Entweder Sie verdienen Ihr Geld mühsam allein oder Sie lassen andere für sich arbeiten«, hatte uns Carsten Maschmeyer auf einem Bundesführungskreis 1993 eingeschärft. Wer als AWD- Vertreter nicht nur Kunden beriet, sondern auch weitere Mitarbeiter warb, bekam von deren Provisionen einen Teil ab. Das hörte sich gut an und ich akquirierte eine Weile neue Leute für den AWD. Bald hatte ich elf Mann unter mir.
Mit den neuen Mitarbeitern war das so eine Sache. Nicht jeder schaffte es, selbst Beratungen durchzuführen. Manche waren im Erklären nicht begabt, andere hatten keine Lust, sich das nötige Fachwissen anzueignen. Das waren sterbende Mitarbeiter, nicht eigenmotiviert und für die Selbstständigkeit ungeeignet. Sie kassierten den Provisionsvorschuss, den ihnen der AWD als Einstiegshilfe auf Darlehensbasis zahlte, und stiegen dann wieder aus. Für ihre so entstandenen Schulden machten sie dann allerdings Maschmeyer verantwortlich. Solche Fälle wurden später für die Journalisten, die ich auf den AWD hetzte, ein gefundenes Fressen.
Dabei hatte es die AWD-Spitze einige Zeit auch mit einem Rundum-Sorglos-Fixum für neue Mitarbeiter versucht. Sie sollten ohne Abschlussdruck ihrer Ausbildung nachgehen und nicht in Versuchung geraten, Kunden, die keinen Bedarf hatten, aus Provisionsgründen etwas aufzuschwatzen. Das haben einige natürlich ausgenutzt. Sie erzählten Geschichten, um weiterhin mehr oder weniger unverdient das Fixum abtanken zu können. Manche Führungskräfte deckten das auch noch. Wenn Mitarbeiter länger dabei waren, hatten ihre Vorgesetzten die Chance, länger mitzuverdienen. Sie erfanden eine Menge Gründe, warum ihre neuen Mitarbeiter weiter das Fixum bekommen sollten.





























