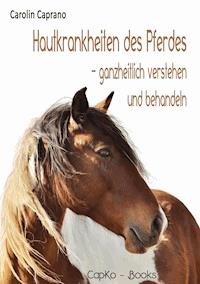Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was sind Effektive Mikroorganismen (EM)? Wie sind sind die EM anzuwenden? Welchen Nutzen haben die Mikroben in einem Haushalt mit Hund? Und: können sie auch im Krankheitsfall helfen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Ratgeber Mein Hund - gesund mit Effektiven Mikroorganismen und möchte umweltbewussten Hundehaltern den Einstieg in dieses interessante Themengebiet so einfach wie möglich machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Ein bisschen Anatomie
Vital-Werte & Co.
Die Notfallapotheke
Effektive Mikroorganismen – was ist das?
Bakterien, die sind doch schädlich… oder?
Die wichtigsten Darreichungsformen
Haltbarkeit der EM-Zubereitungen
Die Sache mit dem Wasser
Mikroorganismen als Futterzusatz für Hunde
Der Hundehaushalt - Alles sauber mit EM?!
Das Dominanzprinzip
Mikroben für gesunde Haut und glänzendes Fell
Zeckenfrei dank EM?
Effektive Mikroorganismen für Hunde im Krankheitsfall
Nebenwirkungen und Gegenanzeigen?!
Nachwort
Lexikon
Literatur- und Quellennachweis
Vorwort
Sie haben schon öfter von Effektiven Mikroorganismen gehört und haben aber keine Idee, worum es dabei eigentlich geht? Oder Sie haben vielleicht schon erste Berührungspunkte mit den EM gehabt und möchten jetzt gerne wissen, wie diese auch in einem Haushalt mit Hunden sinnvoll eingesetzt werden können?
Dann wird Ihnen dieser kleine Ratgeber ganz sicher weiterhelfen können. Er wird Ihnen sowohl eine Einführung in das Thema dieser nützlichen Mikrobenmischung geben als auch Ideen vermitteln, wie Sie diese bei Ihren Hunden und in Ihrem Haushalt anwenden können.
EM können einen wundervollen Beitrag für unsere Umwelt leisten, indem wir auf einen Großteil chemischer Produkte verzichten können, wenn wir stattdessen auf die Lösungen mit den Mikroorganismen zurückgreifen. Und auch beim Einsatz am oder im Hund können wir diesen Weg weiterverfolgen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
Carolin Caprano
Ein bisschen Anatomie
Das Thema dieses Buches sind die Effektiven Mikroorganismen. Doch trotzdem wollen wir vorab einen kleinen Exkurs wagen. Anatomische Basiskenntnisse können nämlich helfen, grundlegende Zusammenhänge leichter zu verstehen. Je mehr Sie als Tierbesitzer selbst wissen und überprüfen können, umso schneller können Sie im Notfall unterstützend eingreifen.
An dieser Stelle erhalten Sie deshalb einen kurzen Überblick über das Skelett mit Gebiss, die Muskulatur und die inneren Organe des Hundes.
Skelett
Das Skelett wird als passiver Bewegungsapparat bezeichnet und bildet das Knochengerüst des Körpers. Wir unterteilen dabei in Schädel, Stammskelett mit Wirbelsäule, Brustbein und Rippen, sowie in die Gliedmaßen.
Das Hundeskelett besteht aus ca. 321 Knochen, von denen viele hauptsächlich im Bereich des Schädels miteinander verwachsen sind. Das übrige Skelett ist gelenkig verbunden.
Die Anbindung zu den Muskeln erfolgt über Sehnen. Die Bänder stabilisieren die Gelenke.
Die Wirbelsäule besteht aus sieben Halswirbeln, dreizehn Brustwirbeln, sieben Lendenwirbeln, drei Kreuzwirbeln (verwachsen zum Kreuzbein) und 20-23 Schwanzwirbeln. Die Rippen bestehen aus dem oberen Rippenknochen, der mit den Wirbeln gelenkig verbunden ist, sowie dem unteren Rippenknorpel. Der Schädel besteht aus den Hirnschädelknochen, die das Gehirn umhüllen, sowie den Angesichtsknochen um Maul- und Nasenhöhle.
Die Vorhand wird von Schulterblatt, Oberarm, Unterarm (Elle und Speiche) und der Hand gebildet. Die Hand besteht aus der Handwurzel, der Mittelhand und fünf Fingern. Die Finger haben je drei Glieder (mit Ausnahme des Daumens mit zwei Gliedern).
Die Hinterhand besteht aus dem Becken, dem Oberschenkel, Unterschenkel (mit Schien- und Wadenbein) und dem Fuß. Der Fuß umfasst die Fußwurzel, die vier Mittelfußknochen mit vier Zehen, welche jeweils aus drei Gliedern bestehen. Das Becken stellt eine feste Verbindung der Hinterhand mit dem Skelett des Stammes her.
Die Knochen sind überall dort, wo Bewegungen zwischen zwei Knochen stattfinden sollen, durch Gelenke verbunden. An den Knochenenden – am Gelenk – ist dieser von Gelenkknorpeln überzogen. Die Gelenkkapsel verbindet dann die Knochenenden und beschreibt die Gelenkhöhle. Die Gelenkschmiere (Synovialflüssigkeit) wird in der Kapsel gebildet, schützt vor Reibung, dient der Ernährung des Gelenkknorpels und trägt zusammen mit dem Gelenkknorpel zur Stoßdämpfung bei.
Gebiss
Anhand des Gebisses einer Tierart kann man auch die Ernährungsweise erkennen. Hunde sind Raubtiere und benötigen deshalb ein starkes Gebiss.
Pro Seite Oberkiefer:
3 Schneidezähne (Incisivi),
1 Fangzahn (Caninus),
4 Backenzähne (Prämolar),
2 Backenzähne (Molar)
Pro Seite Unterkiefer:
3 Schneidezähne (Incisivi),
1 Fangzahn (Caninus),
4 Backenzähne (Prämolar),
3 Backenzähne (Molar)
Muskulatur
Die Muskulatur wird, im Gegensatz zum Skelett, als aktiver Bewegungsapparat bezeichnet. Man unterscheidet in quergestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur, Herzmuskel) und glatte Muskulatur (z. B. in den inneren Organen).
Die Muskulatur des Skeletts hat unterschiedliche Aufgaben und auch entsprechende Formen. Bei der Muskulatur des Stammes handelt es sich in erster Linie um Aufrichter/Strecker, Seitbieger und Versteifer der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Dabei erstrecken sich die einzelnen Muskelfasern über mehrere Segmente und sind kulissenartig in drei Schichten angeordnet. Diese drei Schichten bezeichnet man als oberflächliche, mittlere und tiefe Muskulatur.
An den Gliedmaßen unterstützt die Muskulatur immer entsprechend den Funktionen. Man unterscheidet Stütz-, Auffang- und Schubfunktionen.
Die Muskulatur der Vorhand ist dabei entsprechend ihrer Funktionen wesentlich schwächer als die der Hinterhand. Die Muskulatur von Unterarm bzw. Unterschenkel besteht aus Beugern und Streckern, ist sehnig durchwachsen und geht in lange Endsehnen über. Alle Muskeln sind entweder direkt oder durch eine Sehne mit dem Knochen verbunden.
Innere Organe
Bei den inneren Organen teilen wir ein in
Zu den zuleitenden Luftwegen gehören die Nasenhöhle, der Rachen, der Kehlkopf, die Luftröhre und die Bronchien. Die Luftröhre beginnt dabei im Schlund und besteht aus Knorpelringen. Die Luft wird hinunter in die Lungen geführt, wo sie sich in die Bronchien verteilt. Von dort aus wird die Luft dann in die kleinen Lungenbläschen (Alveolen) geleitet.
Rippen und Zwerchfell begrenzen den Brustraum. Die Lunge nimmt dabei den größten Anteil des Brustraumes ein. Das Herz sitzt ungefähr in der Mitte (etwas mehr links) des Brustraums in Höhe der vierten bis sechsten Rippe und berührt mit seinem tiefsten Punkt das Brustbein.
Das Herz ist in die rechte und die linke Herzhälfte aufgeteilt. Jede Seite hat einen Vorhof und eine Kammer, die jeweils durch Klappen getrennt sind. Die vordere und hintere Hohlvene mündet jeweils in den rechten Vorhof und bringen sauerstoffarmes Blut. Von dort aus wird das Blut weiter in die rechte Herzkammer transportiert, die es wiederum über die Lungenarterie in die Lungen weitertransportiert.
Über die Lungen fließt dann mit Sauerstoff angereichertes Blut über die Lungenvenen in den linken Vorhof und über die linke Herzkammer in die Hauptschlagader (Aorta).
Das lymphatische System besteht aus den Lymphgefäßen, dem lymphatischen Gewebe und der Lymphflüssigkeit. Neben den venösen Gefäßen ist das Gefäßsystem der Lymphe das zweite große „Drainage-System“ des Körpers. An verschiedenen Stellen sind sogenannte Lymphknoten in die Lymphgefäße eingekoppelt. Diese Lymphknoten haben die Aufgabe, die Lymphe zu reinigen, Lymphozyten zu produzieren und Fremdstoffe zu beseitigen.
Die Gefäßsysteme von Blut und Lymphe bilden das Kreislaufsystem, welches sich in den großen Kreislauf (Körperkreislauf) und den kleinen Kreislauf (Lungenkreislauf) aufteilt.
Der Thymus liegt im Brustkorb und ist ein Organ, das sich bis zur Geschlechtsreife zurückbildet und dann nur noch rückständig vorhanden ist. Auch der Thymus gehört zu den lymphatischen Organen und spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Immunsystems.
Die Milz liegt nahe am Magen und ist eng mit dem Blut sowie dem Lymphsystem verbunden. Sie speichert Blut und Eisen, baut rote Blutkörperchen ab, speichert Blutplättchen und baut sie auch ab. Sie bildet außerdem Lymphozyten und Phagozytoseaktivitäten.
Der Verdauungstrakt wird in Kopfdarm, Vorderdarm, Mitteldarm, Enddarm und Darmanhangsdrüsen eingeteilt. Zum Kopfdarm gehören dabei die Maulhöhle mit Zunge, Speicheldrüsen, Rachen und natürlich die Zähne.
Zum Vorderdarm gehören die Speiseröhre und der Magen, der in der Bauchhöhle liegt. Mitteldarm und Dünndarm umfassen den gesamten Darmkanal bis hin zum Dickdarm mit After.
Durch den Brustraum verläuft außerdem die Speiseröhre, über die Nahrung in das Verdauungszentrum im Bauch geführt wird. Das Futter wird durch Muskelbewegungen von der Speiseröhre in den Magen befördert.