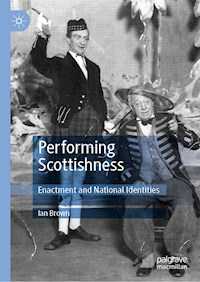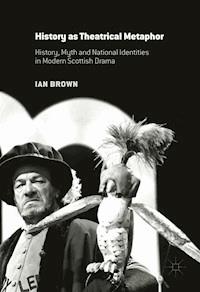9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem vielfach preisgekrönten Buch erzählt der kanadische Journalist und Sachbuchautor Ian Brown vom Alltag mit seinem schwerbehinderten Sohn: Walker wurde mit einem äußerst seltenen genetischen Defekt geboren. Im Alter von 12 Jahren braucht Walker immer noch Windeln, kann nicht sprechen und muss einen Helm und spezielle Armschützer tragen, um sich nicht selbst zu verletzen. Mit schonungsloser Ehrlichkeit und doch voller Humor schildert Brown die Herausforderung, die das Leben mit Walker für ihn und seine Familie bedeutet, und berichtet von den schwierigen Entscheidungen, vor die er sich gestellt sieht, um das Beste für seinen Sohn zu ermöglichen.
(Dieses Buch ist im btb Verlag schon einmal unter dem Titel "Der Junge im Mond" erschienen.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
In seinem vielfach preisgekrönten Buch erzählt der kanadische Journalist und Sachbuchautor Ian Brown vom Alltag mit seinem schwerbehinderten Sohn: Walker wurde mit einem äußerst seltenen genetischen Defekt geboren. Im Alter von 12 Jahren braucht Walker immer noch Windeln, kann nicht sprechen und muss einen Helm und spezielle Armschützer tragen, um sich nicht selbst zu verletzen. Mit schonungsloser Ehrlichkeit und doch voller Humor schildert Brown die Herausforderung, die das Leben mit Walker für ihn und seine Familie bedeutet, und berichtet von den schwierigen Entscheidungen, vor die er sich gestellt sieht, um das Beste für seinen Sohn zu ermöglichen.
IAN BROWN ist kanadischer Journalist und Sachbuchautor. Daneben ist er bekannt als Rundfunk- und Fernsehmoderator. »Mein Sohn ist schwerbehindert« war ein Nummer-1-Bestseller und wurde u.a. mit den drei wichtigsten Buchpreisen Kanadas ausgezeichnet. Ian Brown lebt in Toronto.
Ian Brown
Mein Sohn ist
schwerbehindert
und hat mir
geholfen,
die Welt besser
zu verstehen
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »The Boy in the Moon. A Father’s Search for His Disabled Son«
bei Random House Canada.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Genehmigte Taschenbuchausgabe März 2018
Copyright © 2009 by Ian Brown
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by
vbtb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf
von Peter Power/The Globe and Mail
Covermotiv: Foto © Peter Power
Druck und Einband: GGP Media GmbH, Pößneck
MK• Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-22131-7V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Dieses Buch ist Walker Henry Schneller Brown und seinen vielen, vielen Freunden gewidmet.
Was für ein Ungeist hat jede vorstellbare Entfernung übersprungen, um dich zu packenDu Unglück du Wir können dich nicht sehen: dabei wollen wir so viel fragen, so viel wissen und so viel sehen, wenn wir könnten.Nein. Du lässt uns schaudern.
SOPHOKLES, König Oedipus
Ich mag Schwachsinnige. Ich mag ihre Aufrichtigkeit. Aber, in aller Bescheidenheit, man ist immer für jemand anders der Schwachsinnige.
RENÉ GOSCINNY
Eins
IN DEN ERSTEN acht Jahren von Walkers Leben ist jede Nacht gleich. Bis ins kleinste Detail der gleiche Ablauf, immer in der gleichen Reihenfolge, jede Einzelheit ist alltäglich, und doch ist jede alles entscheidend.
Dieser immer gleiche Ablauf führt dazu, dass die acht Jahre einem lang vorkommen, beinahe endlos, bis ich später versuche, über sie nachzudenken, und dann lösen sich die acht Jahre in nichts auf, denn nichts hat sich verändert.
Heute Nacht wache ich im Dunkeln auf und höre ein gleichmäßiges, mechanisches Geräusch. Etwas stimmt nicht mit dem Wasserkocher. Nnngah. Pause. Nnngah. Nnngah.
Aber es ist nicht der Wasserkocher. Es ist mein Junge, Walker, der grunzt, während er sich wieder und wieder gegen den Kopf schlägt.
Er tut dies, seitdem er knapp zwei Jahre alt ist. Er ist mit einer unfassbar seltenen Mutation auf die Welt gekommen, dem Cardio-Facialen-Cutanen-Syndrom, einem technischen Begriff für eine Kombination von Symptomen. Er ist ganz allgemein behindert und kann nicht sprechen, deshalb weiß ich auch nie, was ihn quält. Niemand weiß das. Es gibt auf der ganzen Welt nur etwas mehr als hundert Menschen mit CFC. Die Anomalie tritt zufällig auf, ein Fehler, der keine spezifischen Gründe oder Ursachen hat; Ärzte nennen das ein seltenes Syndrom, im angelsächsischen Sprachraum sagt man »orphan syndrome«, aufgrund seiner Seltenheit und weil es aus dem Nichts zu kommen scheint.
Ich zähle die Grunzlaute, während ich in sein Zimmer tapse: jede Sekunde einen. Um ihn dazu zu bringen, dass er sich nicht mehr selber schlägt, muss ich ihn wieder zum Schlafen bringen, was bedeutet, dass ich ihn mit nach unten tragen, ihm ein Fläschchen bereiten und ihn mit zu mir ins Bett nehmen muss.
Das hört sich doch leicht an, oder? Aber mit Walker ist alles kompliziert. Wegen seines Syndroms kann er keine feste Nahrung zu sich nehmen, ja nicht einmal ohne Schwierigkeiten schlucken. Weil er nicht essen kann, nimmt er seine Milchnahrung während der Nacht durch einen Ernährungsapparat auf. Die Milchnahrung fließt von einem Nahrungsbeutel, durch eine Pumpe an einem Metallständer angetrieben, über einen Schlauch durch ein Loch in Walkers Schlafanzug in einen raffiniert aussehenden permanenten Zugang in seinem Bauch, der manchmal PEG-Sonde oder einfach »Mickey« genannt wird. Um ihn aus dem Bett zu heben und nach unten in die Küche zu tragen, wo ich das Fläschchen zubereite, das ihn wieder in den Schlaf zurück versetzen wird, muss ich den Schlauch von der Sonde abtrennen. Damit ich das tun kann, muss ich erst einmal die Pumpe abstellen (im Dunkeln, damit er nicht gänzlich hellwach wird) und den Schlauch abklemmen. Wenn ich den Schlauch nicht abklemme, tropft die klebrige Milchnahrung auf das Bett oder den Fußboden (der Teppichboden in Walkers Zimmer ist blassblau: Es gibt darauf Flecken, die sich von all den Malen, an denen ich es vergessen habe, wie die Wüste Gobi anfühlen). Um den Schlauch zusammenzudrücken, schiebe ich einen winzigen roten Plastikhebel herunter. (Das ist mir der liebste Teil dieses routinierten Ablaufs – immerhin eine Sache, die leicht und völlig unter meiner Kontrolle ist.) Ich mache den Reißverschluss seines einteiligen Schlafanzuges auf (Walker ist klein und wächst so langsam, dass er eineinhalb Jahre lang den gleichen Schlafanzug tragen kann), greife hinein, um den Schlauch vom »Mickey« abzumachen, ziehe ihn durch das Loch in seinem Schlafanzug und hänge ihn an den Ständer, an dem auch die Pumpe und der Nahrungsbeutel hängen. Schließe den »Mickey«, mache den Schlafanzug wieder zu. Dann beuge ich mich herunter und hebe Walker mit seinen vollen dreiundzwanzig Kilo aus den Tiefen seines Kinderbettes. Er schläft immer noch in einem Kinderbett. Nur so können wir sicher sein, dass er nachts im Bett bleibt. Er kann allein eine Menge Schaden anrichten.
Dies ist keine Beschwerdeliste. Es hat keinen Sinn, sich zu beklagen. Wie die Mutter eines anderen CFC-Kindes einmal zu mir sagte: »Man tut, was man zu tun hat.« Das ist, wenn überhaupt, noch der leichteste Teil. Schwierig wird es, wenn man versucht, die Fragen zu beantworten, die Walker jedes Mal in mir auslöst, wenn ich ihn hochhebe. Worin besteht der Wert eines solchen Lebens – eines Lebens im Zwielicht und oftmals in Schmerzen? Was für Lasten bürdet sein Leben denjenigen um ihn herum auf? »Wir geben eine Million Dollar aus, um ihr Leben zu retten«, sagte erst vor Kurzem eine Ärztin zu mir. »Aber wenn sie entbunden und auf der Welt sind, ignorieren wir sie.« Wir saßen in ihrem Behandlungszimmer, und sie weinte. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: »Weil ich es die ganze Zeit erlebe.«
Manchmal, wenn ich Walker beobachte, ist es so, als würde ich den Mond anschauen: Man sieht den Mann im Mond, obwohl man doch genau weiß, dass es ihn nicht gibt. Aber warum ist Walker, wenn er nicht im eigentlichen Sinn präsent ist, so wichtig für mich? Was will er mir zeigen? Ich will einfach nur wissen, was in seinem verformten Kopf vor sich geht, in seinem zerberstenden Herzen. Aber jedes Mal, wenn ich frage, überredet er mich irgendwie dazu, in mein eigenes Herz zu schauen.
Aber da gibt es noch ein weiteres Problem. Bevor ich mit Walker nach unten zu seinem Fläschchen schlüpfen kann, wallt um mich herum der Duft seiner Windel auf. Walker kann nicht auf die Toilette gehen. Ohne eine frische Windel wird er auch nicht wieder einschlafen und nicht aufhören, sich gegen seinen eigenen Kopf und seine Ohren zu hämmern. Und so wenden wir uns vom Routine-Nahrungsschlauch ab und der Routine-Windel zu.
Ich drehe mich um 180 Grad zum ramponierten Wickeltisch und frage mich, wie ich es jedes Mal tue, wie das wohl gehen soll, wenn er zwanzig sein wird und ich sechzig. Der Trick ist, seine Arme so festzunageln, dass er sich nicht selbst schlägt. Aber wie soll man einem dreiundzwanzig Kilo schweren Jungen die volle Windel wechseln und gleichzeitig seine beiden Hände festklemmen, damit er sich nicht gegen den Kopf haut oder (schlimmer noch) hinunter langt, um sich seinen winzigen, an eine Pflaume erinnernden, nun plötzlich freiliegenden Hintern zu kratzen und dabei alles mit Exkrementen vollzuschmieren? Und außerdem noch beide Füße ruhig halten, weil sonst dito? Man darf nicht mal für eine Sekunde seine Aufmerksamkeit schweifen lassen. Noch dazu geschieht all dies im Dunkeln.
Aber ich habe dafür meine Routine entwickelt. Ich halte seine linke Hand mit meiner Linken und klemme mir seine rechte Hand, damit sie nichts anrichten kann, unter meine linke Achsel. Ich habe das so oft getan, dass es für mich so selbstverständlich wie gehen geworden ist. Ich halte seine Fersen außerhalb der Gefahrenzone, indem ich meinen rechten Ellbogen dazu benutze, seine Knie am Beugen zu hindern, und mache die ganze schmutzige Arbeit mit meiner Rechten. Meine Frau Johanna kriegt das allein nicht mehr hin und ruft mich manchmal zu Hilfe. Wenn sie das tut, bin ich nie besonders nett zu ihr.
Und das Wechseln selber: eine Aufgabe, der man sich mit all dem Fingerspitzengefühl eines Munitionsexperten aus einem James Bond-Film, der gerade eine Atombombe entschärft, nähern muss. Das Auseinanderfalten und Anlegen einer neuen Windel, das vertraute Gefühl der kratzigen Klettbänder auf der weichen Windel, der Unglaube, dass das je halten wird, die gewaltige, aufwallende Erleichterung, dass man sie schließlich doch zugeklebt kriegt – wir haben es geschafft! Die Welt ist wieder sicher! Dann werden seine Beine wieder in den Schlafanzug gestopft.
Jetzt sind wir so weit, nach unten zu gehen, um sein Fläschchen zu machen.
Drei Treppen, auf Händen und Füßen, dabei aus den Fenstern an den Treppenabsätzen schauen, während wir runtermarschieren. Er windet sich, und so beschreibe ich ihm mit leiser Stimme die Nacht. Heute Nacht scheint der Mond nicht, und für November ist es ziemlich feucht.
In der Küche widme ich mich dem Fläschchen-Ritual. Die gewichtslose Plastikflasche (das dritte Fabrikat, das wir ausprobiert hatten, bis wir eins fanden, das passte und groß genug für seine nicht allzu feine Motorik war, aber leicht genug, damit er es festhalten konnte), die Sparpackungs-Box mit Milchnahrung (deren Ausmaß frustrierend ist, weil es so viel impliziert), das komplizierte Titrieren von winzigen Mengen Spezialbabybrei mit Haferflocken (er aspiriert Dünnflüssiges; wir brauchten Monate, um die für ihn passenden Mengenverhältnisse herauszufinden, die die genau für ihn passende Konsistenz besitzen. Mein Kopf schwirrt mir von all diesen Mengen und Zahlen: Dosierungen, Aufwärmzeiten, der Rhythmus seiner Darmtätigkeit/seines Kratzens/seiner Schreie/seiner Nickerchen). Der nächtliche Stich über den feinen Film von Breipulver, der sich über alles legt: Werden wir jemals wieder so etwas wie ein normales Leben führen können? Der zweite Stich, aus Scham darüber, dass man überhaupt solche Gedanken hegt. Das Wühlen im wie immer vollen, blau-weißen Geschirr-Abtropfständer (immer waschen wir gerade irgendetwas ab, eine Pipette, eine Spritze, eine Flasche oder einen Messbecher für ein Medikament) nach einem Sauger (aber der richtige Sauger, einen, dessen Öffnung ich zu einem X vergrößert habe, damit er die angedickte Flüssigkeit durchlässt) und nach einer Saugerkappe aus Plastik. Dann den Sauger in die Kappe, das befriedigende Plopp, wenn er richtig sitzt. Ab in die Mikrowelle, die die Keimdrüsen schrumpfen lässt.
Wieder drei Treppen hoch. Walker versucht immer noch, sich den Kopf einzuschlagen. Warum macht er das? Weil er sprechen will, es aber nicht kann? Weil – das ist meine neueste Theorie – er nicht all das tun kann, was er bei anderen Menschen sieht? Ich bin sicher, dass er weiß, wie sehr er sich von den anderen unterscheidet.
Ich trage ihn in das Bett im Zimmer seiner älteren Schwester Hayley im dritten Stock, wo ich schlafe, damit ich in seiner Nähe sein kann. Hayley schläft inzwischen unten mit ihrer Mutter in unserem Schlafzimmer, damit die beiden etwas Schlaf bekommen. So wechseln wir uns ab, durch Walker zu Schlafzimmer-Beduinen reduziert. Weder Johanna noch ich haben seit acht Jahren auch nur zwei Nächte hintereinander durchschlafen können. Wir arbeiten beide tagsüber. Nach den ersten sechs Monaten habe ich aufgehört, zu registrieren, wie müde ich war: Meine Tage und Nächte wurden einfach elastischer und glichen sich einander an.
Ihn aufs Bett legen. Oh, scheiße noch mal – ich habe die Pumpe vergessen! Eine Kissenwand um ihn herum errichten, damit er nicht abhaut oder aus dem Bett fällt, während ich in das andere Zimmer flitze. Erinnere dich: vier Kubikzentimeter Chloralhydrat (oder waren es sechs?), die ihm verschrieben wurden, damit er schlafen kann und um seinen Hang zur Selbstverletzung zu dämpfen. (Ich habe diese Dosis einmal ausprobiert: wie ein doppelter Martini. William S. Burroughs flog von der Schule, weil er als Jugendlicher damit experimentiert hat.) Wieder die Pumpe einstellen, das vertraute, regelmäßige, leise Jaulen neu starten, seinen nächtlichen Puls.
Schließlich sinke ich neben ihm ins Bett und ziehe den zappelnden Jungen an mich. Er fängt wieder an, sich gegen den Kopf zu schlagen, und weil wir keine annehmbare Form kennen, ihn mechanisch daran zu hindern, halte ich seine kleine, rechte Hand in meiner eigenen großen, rechten Hand und drücke sie herunter. Was dazu führt, dass er sein anderes Ohr mit seiner linken Hand erwischt. (»Er ist ein Genie, wenn es darum geht, sich selbst zu verletzen«, sagte neulich sein Lehrer zu mir.) Ich packe seine Linke mit meiner Linken, die ich hinter seinen Kopf geschoben habe. Da beginnt er sich mit seiner rechten Ferse in den Schritt zu treten, so hart, dass ich zusammenzucke. Ich lege mein großes Bein über sein kleines und meine rechte Hand (die immer noch seine rechte Hand hält) auf seinen linken Oberschenkel, um ihn ruhig zu halten. Er ist stärker, als er aussieht. Unter seinen vogelähnlich wirkenden Gliedern ist er hart wie Granit. Er haut sich die Ohren zu Brei, wenn ihn niemand daran hindert.
Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass all diese Maßnahmen nichts nützen. Ab und zu bewirkt das Chloralhydrat das Gegenteil und verwandelt ihn in einen kichernden Betrunkenen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man die ganze Zeremonie eine Stunde später noch einmal wiederholen muss. Wenn er erkältet ist – acht bis zehn Mal im Jahr –, hustet er so stark, dass er alle zwanzig Minuten wach wird. Manchmal weint er stundenlang ohne erkennbaren Grund. Es gibt Nächte, da klappt gar nichts, und Nächte, da ist er wach und quicklebendig, lacht und spielt und krabbelt auf mir herum. So müde, wie ich bin, ich habe nichts gegen solche Nächte: Er sieht sehr schlecht, aber im Dunkeln geht es uns ähnlich, und ich weiß, dass ihn das glücklich macht. In der Nacht gibt es Phasen, in denen er nicht anders ist als jeder andere normale, lebhafte Junge. Ich muss beinahe weinen, wenn ich Ihnen das so sage.
Heute Nacht habe ich Glück: Ich kann fühlen, wie er nach zehn Minuten wegdriftet. Er hört auf zu grummeln, streichelt sein Fläschchen, dreht mir den Rücken zu und presst seinen knochigen kleinen Hintern an meine Hüfte, ein sicheres Zeichen. Er schläft ein.
Ich eile ihm nach. Trotz all dieser nächtlichen Alpträume – den Jahren verzweifelter Sorgen, Krankheiten und chronischen Schlafmangels, dem Chaos, das er in unserem Leben angerichtet hat, indem er unsere Ehe, unsere finanziellen Verhältnisse und unsere Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat – sehne ich mich doch nach diesem Moment, in dem er, seinen verrückten, formlosen Körper an mich geschmiegt, einschläft. Für einen kurzen Augenblick fühle ich mich wie der Vater eines ganz normalen kleinen Jungen. Manchmal denke ich, das ist sein Geschenk an mich – in kleinen Portionen, um mir zu zeigen, wie wertvoll und kostbar es ist. Walker, mein Lehrer, mein lieber, lieber, verlorener und verwundeter Junge.
In den Anfangsjahren, nachdem bei Walker im Alter von sieben Monaten erstmals das CFC-Syndrom diagnostiziert wurde, hat sich die Zahl der Menschen, die vermutlich an diesem Syndrom leiden, jedes Mal, wenn wir den Arzt aufsuchten, erhöht. Die medizinische Wissenschaft – zumindest die Handvoll Mediziner, die sich mit dem Cardio-Facialen-Cutanen-Syndrom beschäftigten oder wussten, was es war – lernte mehr über das Syndrom, während wir es gleichzeitig auch taten. Der Name selbst war nichts als ein Amalgam der auffälligsten Symptome des Syndroms: Cardio wegen der allgegenwärtigen Herzgeräusche, der Missbildungen und Vergrößerungen des Herzens; Facial wegen der Gesichtsanomalie, die das erste Zeichen war, eine hohe Stirn und die weit auseinander stehenden Augen, Cutan wegen der vielen Hautstörungen und Hautveränderungen. Als mir ein Genetiker das erste Mal dieses Syndrom erläuterte, sagte er mir, dass es auf der ganzen Welt nur noch acht andere Kinder mit CFC gäbe. Acht: Das war nicht möglich. Ganz sicher hatte man uns in eine andere, unbekannte Galaxie geschossen.
Aber ein Jahr war noch nicht vergangen, da hatten unsere Ärzte die vorhandene medizinische Fachliteratur nach Hinweisen auf CFC durchforstet und informierten mich, dass es zwanzig Fälle gäbe, denn in Italien waren mehrere aufgetaucht. Dann waren es vierzig. (Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich diese Zahl veränderte, empfand ich einen gewissen Hohn den Ärzten gegenüber: Sie waren die medizinischen Profis, sie mussten doch einfach mehr wissen als wir selbst.) Seit 1979, als man anhand von drei Fällen zum ersten Mal öffentlich dieses Syndrom beschrieben hat, sind mehr als hundert Fälle von CFC bekannt geworden, manche Schätzungen sprechen von bis zu 300 Fällen. Alles an diesem Syndrom war ein Rätsel, eine Unbekannte. Erst 1986 bekam es überhaupt einen Namen. Die Symptome variierten stark, was den Grad und die Ausprägung anbelangte. (Manche Forscher glauben, dass es Tausende von Menschen mit CFC gibt, aber dass die Symptomatik in diesen Fällen so harmlos ist, dass man sie gar nicht bemerkt.) Manche CFC-Kinder schlagen sich selbst, die meisten allerdings nicht. Manche können sprechen oder Zeichensprache benutzen. Bis auf ganz wenige sind sie leicht bis schwer geistig behindert. Herzfehler rangieren von schwerwiegend bis unerheblich. (Walker hatte leichte Herzgeräusche.) Ihre Haut ist oft sehr empfindlich, bis zu dem Punkt, dass eine Berührung sie schmerzt. Wie viele Kinder mit CFC konnte Walker nur mühsam kauen oder schlucken, er konnte nicht sprechen, er konnte nicht gut sehen oder hören (er hatte verengte Sehnerven, bei einem Sehnerv stärker als bei dem anderen, und winzige Hörkanäle, die permanent entzündet waren), er war dünn und wabbelig, in der medizinischen Fachsprache nennt man das »hypoton«.
Wie praktisch alle CFC-Kinder hatte er keine Augenbrauen, spärliches, lockiges Haar, eine hohe Stirn, weit auseinander liegende Augen, Ohren, die tiefer am Kopf saßen als üblich, und die oft charmante Persönlichkeit eines Party-Tigers. Die CFC-Merkmale wurden offensichtlicher, »abnormaler«, je älter er wurde. Ich nahm an, mein kleiner Junge sei ein typisches Beispiel für diesen Defekt. Es stellte sich heraus, dass ich mich geirrt hatte. Es stellte sich heraus, dass nichts typisch war – nicht bei diesem Syndrom.
Und dieser Defekt veränderte sich auch nicht. Heute, mit dreizehn Jahren, ist er, was seine geistige Entwicklung anbelangt, irgendwo – und es erschreckt mich, diese Worte auch nur aufzuschreiben – zwischen einem und drei Jahren alt. Körperlich geht es ihm besser als vielen CFC-Kindern (er hatte keine häufigen Krampfanfälle, seine Gedärme sind nicht vereitert), geistig weniger. Er könnte ein mittleres Alter erreichen. Wäre das ein Glück oder nicht?
Das war und ist, bis auf ein paar neue genetische Details, alles, was man bislang in der Medizin über CFC weiß. Es wird nicht sehr breit erforscht wie etwa Autismus. Die meisten Eltern von CFC-Kindern wissen mehr über diesen Defekt als ihre Kinderärzte. Die CFC-Gemeinde ist nicht so groß und politisch einflussreich wie die Down Syndrom-Gemeinde, mit dem in Nordamerika mehr als 350 000 Menschen leben, und das statistisch bei einer von 800 Geburten auftritt. CFC kommt statistisch nicht häufiger als bei einer von 300 000 Geburten vor und möglicherweise so selten wie einmal in einer Million. Die Abteilung des National Institute of Health für Seltene Krankheiten stuft CFC als »extrem selten« ein, ganz am äußersten, schmalen Ende der statistischen Skala, zusammen mit bizarren genetischen Anomalien wie dem Chediak-Higashi-Syndrom, einer Anomalie im Blutbild, die von einer Dysfunktion der Thrombozyten und der weißen Blutkörperchen ausgelöst wird. Es gab nur zweihundert bekannte Fälle von Chediak-Higashi, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die wenigsten, die damit geboren werden, überleben.
Walker aufzuziehen ist, als würde man ein Fragezeichen aufziehen. Schon oft wollte ich jemandem die Geschichte erzählen, wie sich dieses Abenteuer anfühlte, wie es roch und klang, was mir auffiel, wenn ich nicht in der Dunkelheit herumrannte. Aber wer würde mit einer solchen menschlichen Abnormalität etwas anfangen können, mit dieser seltenen und exotischen Nische der Existenz, in der wir uns plötzlich wiederfanden? Elf Jahre sollten vergehen, bevor ich noch so jemanden wie ihn kennen lernte.
Drei
WAS DR. NORMAN Saunders, Walkers Kinderarzt irritierte, war, dass man ihn nicht umgehend angerufen hatte, nachdem Johanna ein offenkundig behindertes Kind fünf Wochen zu früh auf die Welt gebracht hatte. An jenem Tag schien wirklich etwas nicht zu sein wie sonst. Es war der dreiundzwanzigste Juni 1996, ein Sonntag. Ich war bei der Arbeit und moderierte eine dreistündige wöchentliche Radiosendung. Johanna rief mich nach der zweiten Stunde an: Sie hatte Wehen. Ihre Stimme war nur einen Grad weniger ruhig als üblich. Mein Bruder fuhr sie ins Krankenhaus, eins, das auf Frauenheilkunde spezialisiert war. Ich wurde mit meiner Arbeit fertig und stieß dann dort zu ihnen. Ihr eigener Arzt war im Urlaub, die Geburt würde von einem Kollegen ihres Arztes begleitet werden, einem hoch gewachsenen, sanften Mann namens Lake. Walker war natürlich nicht seine Schuld, aber ich habe ihm trotzdem nie verziehen.
Noch irgendetwas war an diesem Tag nicht wie sonst, abgesehen von dem Arzt meiner Frau, der nicht da war: die Art, wie der Junge, nachdem er zur Welt gekommen war, in der Hand des Arztes zusammensackte. Er hatte einen merkwürdigen, niedergeschlagenen Gesichtsausdruck, als wüsste er, dass irgendetwas nicht stimmte. Seine Lungen hatten sich nicht richtig geöffnet, und die Assistenzärzte brachten ihn schnell zu einem Tisch, wo sie ihm mehrere Minuten lang eine Sauerstoffmaske auf den winzigen Mund und die Nase pressten. Mehrere Jahre lang habe ich mich immer wieder gefragt, ob der erzwungene Sauerstoff zu seiner Zurückgebliebenheit beigetragen hat – was passieren kann. »Puh«, hörte ich den hoch gewachsenen Assistenzarzt kurze Zeit später seinen Kollegen zuflüstern, »bin ich froh, dass er angefangen hat zu atmen.« Da begann die anhaltende, unterschwellige Panik, die Sorge, die Walkers Leben seit jenem Tag bestimmt. Das Schlingern seines Lebens. Die Anzeichen, die von Anfang an da gewesen waren. Die seltsame Wolle seines wilden, lockigen Haars, die sich oben auf seinem rechteckigen Kopf zu einem Streifen ballte – ein unerwartetes Muster. Neulich fuhr ich auf meinem Fahrrad an dem Krankenhaus vorbei, in dem er geboren wurde, und spuckte es beinahe an. Ich hasse dieses Gebäude, sogar den gelben Backstein, aus dem es errichtet worden ist. Aber, so dachten wir, er ist schließlich eine Frühgeburt, klar dass er etwas lethargisch ist. (Niemand kann in diesem Stadium CFC erkennen.) Er verweigerte bei jedem zweiten Versuch die Mutterbrust, einer seiner Hoden hatte sich nicht herabgesenkt, und er konnte nur ein Auge öffnen. Dennoch hatte das Kind, als Dr. Saunders ihn zwei Tage später das erste Mal untersuchte, 300 Gramm zugenommen.
Schon bei seiner ersten Visite begann Dr. Saunders – ich weiß das jetzt, weil ich Walkers Krankenblatt kenne – bereits, ungewöhnliche Einzelheiten auf dem Blatt für meinen Sohn zu notieren. Gaumen unnatürlich hoch. Schlaffer Muskeltonus. Kleine Fissuren in den Augenlidern. Niedrig ansetzende und verdrehte Ohren, eine Falte in der Haut auf seinem Nasenrücken. Hayley war ein Musterbaby gewesen. Von ihrem Bruder war Saunders nicht so begeistert.
Zwei Tage später hatte Walker das meiste von dem Gewicht, das er zugelegt hatte, schon wieder verloren. Johanna war außer sich, tief in einer hormonellen Trance, in der es ihre einzige Sorge war, dass der Junge Nahrung zu sich nahm.
Er schien nicht in der Lage zu sein, zu saugen, und er brauchte eine Stunde, um fünfzehn Gramm Milch zu sich zu nehmen. Wenn er sie dann im Magen hatte, erbrach er sie gleich wieder. Sein Körper wollte nicht überleben. »Wir wollen doch, dass dieses Kind lebt, oder?«, blaffte Saunders eines Morgens, als wir wieder einmal in seiner Praxis aufkreuzten. Ich entschied, dass das eine rhetorische Frage war.
Saunders Frage implizierte eine weitere, unausgesprochene: »Dieses Kind kann nicht überleben, wenn man nicht außergewöhnliche Anstrengungen unternimmt. Wollen Sie diese Anstrengungen auf sich nehmen und die Konsequenzen ertragen?« Selbst wenn er diese Frage direkt gestellt hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Antwort anders als »ja« gelautet hätte. All die theoretischen Debatten über Ethik können die Forderungen des Augenblicks nicht ändern: das schreiende Baby auf dem Untersuchungstisch, sein aufgeblähter Bauch, der offenkundig besorgte Arzt, sein Vater, der dämlich daneben steht. Der Schrei des körperlichen Kindes und seiner Not.
Erst später, allein, nachts, nach stundenlangen Kämpfen, damit er einschlief, die nur dazu führten, dass ich selbst schlaflos war, dachte ich manchmal darüber nach, was sein Leben uns kostete, und an die Alternativen. Hatte der Arzt mich gefragt, ob ich wollte, dass Walkers Leben endete, so wie die Natur es wohl beendet hätte? Ich saß auf der Hintertreppe unseres kleinen Hauses mitten in der Stadt um vier Uhr morgens, rauchte und dachte das Undenkbare. Kriminelle Gedanken oder zumindest bizarre: Was war, wenn wir keine außergewöhnlichen Anstrengungen unternahmen? Was war, wenn er krank wurde und wir uns nicht so stark bemühten, damit es ihm wieder besser ging? Nicht Mord, bloß die Natur. Aber selbst, als ich über diese schwerwiegenden Pläne nachdachte, wusste ich sofort, dass ich sie nie in die Tat umsetzen würde. Ich will gar nicht herumprahlen, mein Zögern war nicht ethisch oder moralisch begründet. Es war ein eher mittelalterlicher Drang, instinktgesteuert und physisch, die Angst vor einer bestimmten Form des Versagens, die Angst vor Vergeltung, wenn ich den dumpfen Schrei seines Fleisches, seines Körpers und seiner Bedürfnisse ignorierte.
In jedem Falle fühlte ich mich wie ein Ochse, der unter sein Joch schlüpft. Ich konnte schon die schweren, tragischen Jahre, die auf mich zukamen, im Voraus fühlen, so sicher wie schlechtes Wetter, es gab Nächte, in denen ich sie sogar begrüßte. Endlich ein Schicksal, das ich nicht selbst erwählen musste, ein Geschick, das ich nicht vermeiden konnte. In diesem Gedanken lag ein winziger Schimmer von Licht, die Erleichterung, mit der man sich dem Unausweichlichen unterwarf. Im Übrigen waren es die schlimmsten Nächte meines Lebens. Ich kann nicht erklären, warum ich das nicht anders hätte haben wollen.
Bevor Walker geboren wurde, nach der Geburt unseres ersten Kindes Hayley, führten meine Frau und ich die üblichen modernen Gespräche darüber, ob wir ein zweites Kind bewältigen konnten. Ich liebte Hayley, sie war das Beste, was mir je widerfahren war, aber ich war mir nicht sicher, ob wir uns noch ein zweites Kind leisten konnten. Ich wollte, dass Hayley bei ihren künftigen Kämpfen gegen uns Verbündete hatte, mir gefiel auch der Gedanke an eine größere Familie, aber Johanna und ich waren beide Autoren und hatten nie viel Geld. Ich wollte eine gewisse Bestätigung, dass ich meine Ambitionen nicht aufgeben musste. Ein Freund meinte: »Sag deiner Frau, dass du kein ewig häuslicher Papa werden willst«, was ich auch tat, worauf Johanna entgegnete: »Ich weiß.« Es war meine Durchlässigkeit, meine Anfälligkeit, die mich mehr besorgte: Ich suchte andauernd nach einem festen Standpunkt. Und natürlich war da auch diese gigantische Entscheidung selbst, ein Kind in diese Welt zu bringen – ein großer Schritt im Leben, der in völligem Versagen oder schlimmer noch in größtem Kummer enden konnte. Als junger unverheirateter Mann hatte ich oft verheiratete Paare gesehen, die sich auf der Straße stritten oder zusammen im Restaurant beim Essen saßen und sich für eine halbe Stunde am Stück anschwiegen. Warum sollte ich so etwas tun?, dachte ich mir. Später, nachdem ich geheiratet hatte, sah ich Paare, die von ihren Kindern völlig mitgenommen waren, und fragte mich: Warum sollte ich so etwas tun? Und der Anblick eines Ehepaares mit einem behinderten Kind erfüllte mich mit Schrecken. Nicht der Anblick des Kindes selbst, sondern der Gedanke an die Last. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen.
Die Diskussion über ein zweites Kind endete so, wie solche Diskussionen oft enden: Wir überließen uns dem natürlichen Lauf der Dinge und sorgten relativ schnell für ein Brüderchen für Hayley. Sie war drei, als Walker geboren wurde. Ein Teil von mir war überhaupt nicht überrascht, dass Walker behindert war: Er war meine Quittung, meine Erziehung. Von der ersten Nacht an, in der ich ihn im Bett in den Arm nahm, um ihn zu füttern, konnte ich dieses Band zwischen uns fühlen, das Band, das besagte, dass wir miteinander verknüpft waren, dass ich ihm etwas schuldete.
Nachdem Walker geboren wurde, dachte ich, dass die Diskussion über mehr Kinder nachlassen würde, aber stattdessen intensivierte sie sich noch: Jetzt wurde Johanna von einem neuen Drang getrieben, dem nach einem dritten Kind. Sie wollte Walker durch Normalität einklammern. Sie wollte Hayley vor der Einsamkeit bewahren, mit einem schwer behinderten Bruder aufwachsen zu müssen, der ihr nie die Art von Zusammensein bieten könnte wie eine normale Schwester oder ein normaler Bruder. Aber es war undenkbar, und ich war derjenige, der nein sagte. Das Schuldgefühl, das sich danach einstellte, war so unvermeidlich wie das Wetter.
In jenem ersten Monat war Walker noch drei Mal beim Arzt. Er kotzte wie ein Profi und schlief niemals. Seine Mutter war ein Gespenst. Dr. Saunders notierte nun bei jedem Besuch anatomische Details: ovale spatenförmige Daumen, leichte Blepharophimosis (kleine, nach unten schräg gestellte Augen), orbitaler Hypertelorismus (Augen, die weit auseinander lagen). Er benutzte immer die wissenschaftlichen Begriffe auf dem Krankenblatt des Jungen – das war für den Austausch mit anderen Ärzten akkurater. Es waren ernste Ausdrücke, die einen professionellen Standard von Genauigkeit vermittelten. Aber es war sehr schwer, bei Walker Brown diese Art von Genauigkeit zu erzielen. Beide Hoden waren jetzt allerdings tastbar, ein kleiner Etappensieg.
»Es ist noch zu früh, um sich Sorgen zu machen«, sagte Saunders zu Johanna.
Er hatte eine Begabung, Mütter zu beruhigen, einer der Gründe, warum er als einer der besten Kinderärzte in der Stadt galt. Er war knapp fünfzig, schlank, gut angezogen (er trug immer eine Krawatte), und er wusste, wie man lockere Konversation pflegt. Die meisten Mütter, die ich kannte, waren in ihn verliebt. Sie brezelten sich auf, wenn sie in seine Praxis fuhren, damit ihre Kinder eine Auffrischungsimpfung bekamen.