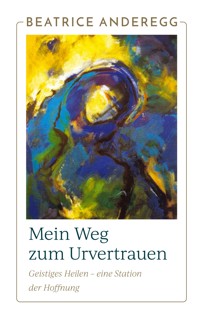
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch schildert die Autorin, wie sie durch eigenes Leiden und Suchen zum Urvertrauen fand und zur Heilerin wurde. Sie ist davon überzeugt, dass jeder Mensch über heilende Kräfte verfügt, die entfaltet werden können. Beatrice ermutigt dazu, sich dem «inneren Arzt» und der göttlichen Heilkraft anzuvertrauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Heilerin Anna Magdalinka und andere Ahnen
Albträume und erste Heilversuche
Tierärztin – Modezeichnerin – Schauspielerin
An Queen Mum’s Schauspielschule
Rassismus
Von Mondschein- und Efeufrauen
Schlaflos in Rom
Pfarrfrau und Seelsorgerin
Seelendunkel
Krankheit als Lehrmeisterin
Umwege zum Ziel
Mein Schicksal nimmt seinen Lauf
Reise in die Südsee
Eine wundersame Fügung
Von Hellsehern, Medien und Spoekenkiekern
Das richtige Buch zur richtigen Zeit
Padre Pio
Erste Begegnung mit Tom Johanson
Das Erwachen
Todesnähe
Gottes mächtige Hände
Pilgerin ohne Angst
Aufbruch
Der doppelt Glückliche
Weichenstellung
Ausgezehrt
Gott ist in den Schwachen mächtig
Karfreitag
Die Stimme in mir
Ein Engel spielt Geige
Heilungsfeier in der Elisabethenkirche
Handauflegen und Gespräch
Nein, wir sind keine Hexen!
Tom, Coral und die Dinge zwischen Himmel und Erde
«Vergesst die Tiere nicht»
Die Hilfesuchenden in unserer Kirche und ihre Problemkreise
Angst, Panik und der Besuch von Frau Zwang
Scharlatane und die Grenzen des spirituellen Heilens
Wer kann heilen?
Gesundheit – Krankheit – Tod
Geist, Sinn und Seelenheil
Die Blume meines Glaubens
Anmerkungen
Vorwort
Als langjährige spirituelle Heilerin in der Offenen Kirche Elisabethen in Basel, sind für mich Krankheit und Heilung nicht zu verstehen, ohne die Sinnfrage zu berühren. Durch eigenes Leiden, aber auch durch das Schicksal vieler anderer Betroffener habe ich erfahren, dass der Mensch oft erst durch den Schmerz der Seele oder des Körpers gezwungen wird, sich die Sinnfrage, das Wozu?, zu stellen und nach Antworten zu ringen. Die anklagende Frage Warum gerade ich? des anfänglich Hadernden kann ihn vom Suchenden zum Findenden machen und schliesslich als Verwandelten aus dem Leiden hervorgehen lassen.
Krankheit vermittelt uns die Chance, uns zu prüfen, unser bisheriges Selbst zu transzendieren und zu einer völlig neuen inneren Sicherheit zu finden. Geborgenheit in den liebenden Händen einer höheren Macht wird unser Herz erfüllen, und wir finden zurück zu einem Selbstvertrauen, das nicht auf der Gesundheit oder Schönheit unseres endlichen Körpers beruht, sondern in der unendlichen Seele gründet – einer Rückfindung zum Urvertrauen, zur Re-ligion, zur Wieder-Verbindung mit Gott.
Ich möchte mit diesem auf meiner Biographie beruhenden Buch nicht eine bestimmte Lehre vermitteln, sondern dazu anregen, sich der Gesetzmässigkeiten des eigenen Lebens bewusst zu werden. In diesem Buch lehre ich auch nicht das Heilen, genauso wenig wie ich Mitgefühl lehren könnte, das die Urkraft ist, die uns dazu bewegt, durch liebende Zuwendung anderen in ihrer Not beizustehen.
Mein Anliegen ist anderer Art: Einem Menschen behutsam und geduldig, Schritt für Schritt, Wege aufzuzeigen, die ihn zu neuem Urvertrauen führen. Zu dem Gefühl der Geborgenheit eines Kindes im Schosse seiner Mutter, zur Heimat in Gott. Menschen zu helfen, einen Sinn in ihrem Leiden zu erkennen und ihnen auf Dauer etwas zu vermitteln, das nicht von mir oder meiner kurzen Zuwendung abhängt – darin sehe ich meine Aufgabe.
Basel, im Frühjahr 2023Beatrice Anderegg
Heilerin Anna Magdalinka und andere Ahnen
Es war nicht irgendein gewöhnlicher Tag im September, als meine hochschwangere Mutter mit unserer Schwarzwälder Hausangestellten Emma, die ebenfalls ein Kind erwartete, einsam und verlassen in einem Grand Hotel in Luzern meine längst überfällige Geburt erwartete. Alle anderen Gäste waren schon fluchtartig abgereist und die kostbaren Teppiche des Hauses standen aufgerollt in den Ecken der Räume, denn in diesen Tagen, am 1. September 1939, war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen.
Vergeblich hatte mein Vater einige Verwandte in der Innerschweiz um schützende Aufnahme seiner Frau und ihres ungeborenen Kindes gebeten, doch alle hatten Angst, denn meine Mutter war in Hamburg geboren und sprach Hochdeutsch. Bereits während neun Monaten hatte sie um mich, ihr zweites Wunschkind, gekämpft, denn ihr unstillbares Erbrechen und die immer wiederkehrenden Blutungen hätten mein Leben fast beendet, bevor es begonnen hatte. Der trostlose und angsterfüllte Aufenthalt im ausgestorbenen Hotel in Luzern liess meine Mutter nach einigen Tagen wieder nach Basel zurückkehren, wo ich dann an einem Sonntag, dem 10. September, endlich als Sturzgeburt das Licht der Welt erblickte. Ich sah aus «wie ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen», wurde mir gesagt. Ich wurde, dunkelblau im Gesicht, ausgezehrt und mit um den Hals geschlungener Nabelschnur geboren. Die Geburt kostete auch meine Mutter fast das Leben. «Ich habe mir dich verdient», sagte sie stets, und ich hatte schon früh das Gefühl, mich um sie kümmern zu müssen. Als junges Mädchen war ich denn eher ihre Beschützerin, Freundin und Seelsorgerin als eine Tochter im landläufigen Sinn.
Die Eltern meiner Mutter stammten aus Dänemark, und sie trug auch den Namen einer dänischen Königin, Tyra. Ein Vorfahre ihrer Familie Mikkelsen soll in Odense, demselben Dorf, in dem auch der Märchendichter Hans Christian Andersen lebte, Schuhmacher gewesen sein. Mein Opa, Peter Marius Mikkelsen, war Tierarzt in Hamburg, und von ihm muss ich wohl meine Tierliebe geerbt haben.
Seine Frau, Oma Anna Magdalinka, so erzählte mir meine Mutter, pflegte ihre sieben Kinder, wenn ihnen etwas fehlte, bei bestimmten Mondstellungen mit hinaus in den Garten zu nehmen und übte dort die uralte traditionelle norddeutsche Kunst des «Besprechens» aus. Indem sie über Warzen und Wunden bestimmte Formeln sprach, soll sie die Beschwerden dadurch zum Verschwinden gebracht haben. Meine Mutter, die Jüngste von ursprünglich neun Kindern – die ersten zwei starben innerhalb einer Woche an Diphtherie –, wuchs heran zu einer strahlenden, freiheitsliebenden, lebenslustigen und künstlerischen Frau, welche die Herzen überall im Sturm eroberte.
Doch unter diesen Qualitäten, die oft auch Neid erweckten, verbarg sich eine verletzliche, anlehnungsbedürftige und zerbrechlich zarte Seele, die sie nach einer kurzen ersten Ehe an Bulimie erkranken liess, einer Krankheit, für die es damals noch keine Bezeichnung gab.
Anna Magdalinka pflegte ihr jüngstes Sorgenkind aber mit Hilfe von diversen Pendlern und Heilern wieder gesund, und ausgerechnet dieser Oma, die als Einzige eine Vorläuferin war von dem, was ich heute bin, sollte ich nie begegnen, denn sie starb kurz nach meiner Geburt. Doch auch mein Hamburger Opa, den wir nach dem Krieg einmal besuchten, pflegte Hilfe ausserhalb der Schulmedizin zu suchen. Wegen Magenbeschwerden reiste er in die Lüneburger Heide zu dem damals berühmten Schäfer Ast, einem Heiler, der sein Wissen um Krankheiten aus der Wolle seiner Schafe bezogen hatte und auch bei Menschen Diagnosen aus deren Haaren stellen konnte.
Trotz ihrer körperlichen und seelischen Empfindlichkeit war meine Mutter aber eine Rebellin, die niemals Schwäche zeigte. Nur zweimal sah ich sie tränenerstickt. Beide Male nach einer telefonischen Nachricht vom Tode eines geliebten Menschen: dem ihres jüngsten Lieblingsbruders Werner, der in einem Konzentrationslager umkam, da er gegen die Nazis Stellung bezogen hatte, und dem ihres Vaters.
Von meiner Mutter habe ich eindeutig ihre Stärke, aber auch ihre Heiterkeit geerbt, die mich schon immer in allem noch etwas Gutes erkennen liess, wenn ich auch von Leid und Schmerz nicht verschont wurde und mir dunkle Stunden nicht fremd bleiben sollten. Im Ertragen solchen Leidens war mir meine Mutter sicher ein wertvolles Vorbild, das mich von Kindheit an prägte. Aber sie hatte auch eine Zauberhand, die uns ein schönes Heim bescherte, das inmitten eines bunten Blumengartens stand, mit duftenden Rosen, die sich an der Hausfassade emporrankten. Für jedes Familienmitglied hatte sie einen Obstbaum gepflanzt, und dieses Märchenhaus wurde zudem belebt von unseren Schäferhunden Garbo und Ito sowie fünf Katzen, von Kanarienvögeln und einem sprechenden Wellensittich, der uns alle bei unserem Namen rufen konnte. Eine Kirchgängerin war meine Mutter nicht, und, da ihr jegliche Heuchelei zuwider war, lebte sie auf ihre Art eine ganz besondere religiöse Dimension, indem sie meinen Bruder und mich mit in den Wald nahm und sagte: «Hier Kinder – seht die Bäume, die grünen Sträucher, riecht die Erde des Waldes, hört das Gezwitscher der Vögel, fühlt das weiche Moos. Der Wald – das ist unsere Kirche!»
Es prägte mich tief. Bis heute löst es in mir eines der höchsten Glücksgefühle aus, wenn ich in die Krone eines Baumes blicke und sehe, wie sich die Wipfel, die Zweige, Äste und Blätter abheben gegen den tiefblauen Himmel, so als ob die Bäume das Göttliche berühren wollten.
Der Wald war die Welt meiner Mutter. Gemütlichkeit war eines ihrer Hauptwörter und ein Leben in Haus und Garten ihr Traum, sodass sie kaum zum Reisen zu bewegen war. Sie malte, musizierte, sang, nähte und strickte, aber sie liebte es auch zu provozieren! Dies sehr zu meinem und meines Bruders Leidwesen, denn für uns war es der reinste Albtraum, wenn sie – gekleidet in ihre extravaganten selbstgenähten Kleider mit Kettchen am Bein, hohen Absätzen und Riesenhüten, die sie aus Hollywoodfilmen kopiert hatte – uns an unserem Wohnort den Spiessrutenlauf zur Strassenbahn machen liess!
Wir waren das Quartiergespräch, nur noch übertroffen durch die Mitwirkung unserer lieben Schwarzwälder Hausangestellten Mathilde, die die abgelegten Kleider meiner Mutter für sich abänderte. Nun schritten die beiden – meine Mutter gross und schlank in Giftgrün, Mathilde klein und rund in Lila neben ihr und beide mit Straussenfedern auf den Hüten – fortan im Doppel zur Haltestelle der Strassenbahn. Dann jedoch pflegten mein Bruder und ich durch Ausreden Abstand zu nehmen, denn der Spott und die Empörung der Bürger war uns in der damaligen Zeit sicher und traf besonders uns Kinder. Dennoch war auch dies eine wichtige Lektion für mich, nämlich ungeachtet kontroverser Meinungen und Anfechtungen mit Mut, Unerschütterlichkeit und innerer Sicherheit zu mir selbst und meinen Visionen zu stehen und diese zu vertreten.
Meine Eltern waren Kinder so unterschiedlichen Geistes, dass diese Ehe nicht glücklich werden konnte. Deshalb wurde ich auch diesbezüglich schon früh zur Vertrauten und Trösterin meiner Mutter.
Leider erbte ich aber ohne Zweifel die Reiselust und die Sehnsucht nach fernen Ländern und Kulturen von Vaters Seite, ebenso mein früh erwachtes Interesse für östliche Religionen, Yoga und Philosophie.
Bei meinem Vater muss ich auf meinen Urgrossvater Johann Stehlin zurückgreifen, der ungefähr 1860 über Nacht aus Basel in die Südsee entschwand und seine Frau und zwei Kinder zurückliess. Eines der Kinder war mein Grossvater Emil Stehlin. Urgrossvaters Tat war die Familienschande der Stehlins, weshalb man beschloss, ihn als Frühverstorbenen zu deklarieren. Alle seine erklärenden Briefe wurden vernichtet. Doch Geheimnisse, die offenbart werden sollen, finden oft wundersame Wege: Urgrossvater erlitt Schiffbruch vor Samoa, ging dort an Land, heiratete wieder und hatte drei weitere Söhne. Diese vermählten sich mit Eingeborenen, wurden zu Mormonen und bald war die Insel kinderreich bevölkert mit samoanischen Stehlins, von denen heute viele die typischen Gesichtszüge der Maoris tragen. Ungefähr hundert Jahre nach Urgrossvaters Verschwinden reiste dann ein Südsee-Stehlin in die USA, nach Kalifornien, blätterte dort im Telefonbuch und stiess dabei auf denselben Namen. Nicht genug damit, er rief an und traf mitten ins Schwarze des dunklen Familiengeheimnisses: Am anderen Ende des Telefons war mein Onkel Thed, der nach Kalifornien ausgewanderte Bruder meines Vaters, und das Geheimnis wurde enthüllt! Zwei mittlerweile höchst unterschiedliche Familienstämme fanden nach einem Jahrhundert wieder zusammen.
Die damals verlassenen Kinder des «toten» Urgrossvaters blieben zurück in Basel und wurden anfänglich mühsam von ihrer Mutter mit Heimarbeit durchgebracht. Später übernahm der Patenonkel den Sohn Emil des Südseeabenteurers, schulte und förderte ihn. Mein Grossvater war während drei Amtsperioden im Vorstand der Kirchgemeinde Elisabethen, wo ich heute als Heilerin tätig bin. In seinen Notizen fand man nach seinem Tode seinen Leitspruch:
«Mein Wunsch ist es, dass eine vom Geld völlig losgelöste Gottes- und Nächstenliebe in unserer unglückseligen Welt bald und endgültig siegen möge.»
Meine Basler Grosseltern kannte ich kaum. Grossmama sass gelähmt in einem Erker und war ausserstande, mir zu antworten. Beide starben kurz nacheinander, als ich vier Jahre alt war. Grossvater Emil Stehlin war Rektor der Handelsschule, heiratete und hatte fünf Kinder. Eines davon war mein Vater Johann Wilhelm.
Es schien das Schicksal Emil Stehlins zu sein, dass alle seine Kinder die Reiselust seines verschwundenen Südsee-Vaters geerbt hatten und, kaum flügge, den Duft der grossen, weiten Welt zu atmen suchten. Blieben seine zwei Töchter doch wenigstens irgendwo in der Schweiz, so reiste sein Sohn Arnold nach Venezuela, Thed wanderte nach Kalifornien aus, und mein Vater, gerade 20 Jahre alt, nahm 1919 eine kaufmännische Stelle in Hongkong und später in Shanghai an, die Reise dorthin dauerte damals drei Monate. Als Johann Wilhelm war er ausgewandert – als John William, von da an nur noch «Bill» genannt, kam mein Vater nach einigen Jahren über Hamburg zurück in die Schweiz, nicht ohne in Hamburg einer bezaubernden jungen Frau namens Tyra Mikkelsen begegnet zu sein, meiner Mutter. Sie heirateten, lebten einige Jahre in Paris, wo mein Bruder Pierre geboren wurde, und zogen später zurück in die Heimatstadt meines Vaters, nach Basel.
Ist es Zufall, dass auch die Eltern meines späteren Mannes Erwin zur gleichen Zeit im gleichen Bezirk von Paris wohnten, dort auch seine beiden Schwestern geboren wurden und nur wir beide das Licht der Welt in der Schweiz erblickten, wo wir dann zusammengeführt wurden?
Albträume und erste Heilversuche
Kriegsbeginn. Erschöpft von der schweren Geburt, die uns beide fast das Leben gekostet hatte, lag meine Mutter im Spital und hörte in panischer Angst die Flugzeuge über Basel brausen: «Ich konnte vor Schwäche nicht aufstehen und wusste nicht, wo mein Kind lag. Ich hatte solche Angst um dich!», erzählte sie mir oft. Auch im Berner Oberland, wo ich getauft wurde und wo wir manchmal unsere Ferien in den Bergen verbrachten, sorgte sich meine Mutter sehr und notierte im Tagebuch Unser Kind: «Es war eine Flucht vor dem Krieg – vor den Bomben – und ihr Papi ist allein in Basel, musste sich von seinen Liebsten trennen. Jetzt müssen wir warten und hoffen, dass wir bald wieder in unser Häuschen nach Basel heimkönnen. Wer weiss, was uns bevorsteht.»
Ich blieb ein Sorgenkind, vertrug die Nahrung nicht und erkrankte, kaum etwas kräftiger geworden, bereits mit zwei Monaten an einer doppelseitigen Nierenbeckenentzündung. Doch trotz meiner anfälligen Gesundheit schien ich eine Urkraft in mir zu haben, die mich immer wieder überleben liess. Heute weiss ich, dass all diese Krankheitserfahrungen zu meinem Weg und zu einem göttlichen Plan gehörten.
Auch später, als Schulkind, lag ich immer wieder wochenlang krank im Bett, mit hohem Fieber, das mich mit Halluzinationen ängstigte und in Schüttelfrösten beben liess. Ein Fiebertraum wiederholte sich, stets der gleiche, bei jeder Erkrankung, als Kleinkind, als Schulkind, bis ins Erwachsenenalter:
Ich stand am Rande einer staubigen Strasse, vor mir ein hoher Berg Steine, die ich aufschichten musste. Ich fühlte mich elend und krank, war schwach, voller Schmerzen und müde, so müde, dass ich hätte schlafen oder sterben wollen. Und die Steine fielen, sobald ich einige von ihnen aufgeschichtet hatte, immer wieder herunter, doch ich musste sie weiter aufheben und auf den steinernen Berg legen, von dem, kaum hatte ich dies getan, ein paar der vorher geschichteten Steine wieder herunterpolterten. Ich war zu Tode erschöpft, meine Glieder, mein Kopf wie Blei, ich sehnte den Tod als Erlöser herbei – doch wie kann man sterben, wenn man bereits tot ist? Und so schichtete ich weiter, und die Steine fielen, fielen ohne Ende, und ich schichtete, schichtete, und sie fielen und fielen...
Sisyphusarbeit. Doch warum träumt ein Kind so etwas? Aus anlagebedingter Neigung zur Pflichterfüllung? Sind es Erinnerungen aus früheren Existenzen? Oder auch Zukunftsahnungen? Karma oder symbolhaltige Zeichen? Es konnte für mich kein Abbild meiner Realität sein, denn ich war ein von Liebe verwöhntes Kind und wurde aufgrund meiner zarten Gesundheit zusätzlich geschont. Genauso geheimnisvoll erscheint mir heute der andere Traum – ich war mir zwar sicher, wach zu sein – von dem kleinen grauen Zwerg, der in mein Kinderzimmer kam und mir zuraunte: «Das ist für deine Sünden!» Ich hatte, wie so oft, lange zuvor wach gelegen und den Geräuschen der Nacht gelauscht. Ich mochte etwa sieben Jahre alt sein, starrte in panischem Entsetzen das Wesen an und flüsterte zurück: «Aber ich habe doch keine Sünden – ich bin doch nur ein unschuldiges Kind!»
Ein «Märchenkind» nannte man mich. Meine Märchenbücher liebte ich über alles, und ich konnte sie lesen, bevor ich zur Schule kam. Die grossen Komponisten kannte ich schon mit drei Jahren und unterschied sie nicht nur mit dem Musikgehör, sondern auch nach den Namen oder Erzählungen meiner Mutter. Mozarts Musik klang eben zart, Bachs Töne perlten wie das Fliessen eines Baches und Beethoven erkannte ich, wenn meine Mutter die «Pathétique» oder die «Appassionata» auf dem Klavier spielte. Dann verkrampfte sich mein kleines Herz vor Mitleid mit dem ertaubten Beethoven, denn meine Mutter hatte mir erzählt: «Die dunklen, klopfenden Töne in dieser Musik hatte Beethoven immer im Ohr, bevor er taub wurde.» Ich pflegte, wenn sie spielte, auf dem Teppich neben dem Klavier zu liegen, hörte zu und wünschte mir so innigst, ich hätte dem armen tauben und einsamen Beethoven helfen können. Damals spürte ich vielleicht zum ersten Male, wie nahe Mitleid und Liebe beieinander liegen und wie sie zusammen zu Mitgefühl verschmelzen.
Meine ganz grosse Liebe aber gehörte den Tieren. Dies abgesehen von meiner Überzeugung, dass unser Schäferhund Ito gewiss ein verzauberter Märchenprinz sei, der eines Tages für mich sein Fell abstreifen würde, wie in «Die Schöne und das Biest» das arme Ungeheuer. Mein erstes Wort war nicht etwa Mama, sondern «Teddy» nach meinem geliebten Bär. Ich hatte eine stattliche Stofftierfamilie, die ich liebevoll hegte und pflegte, und auch unsere erste Katze zog auf meinen Geburtstagswunsch hin bei uns ein. Bald räkelten sich dann auch sämtliche Nachbarskatzen in unseren Sesseln, ausgenommen von Vaters Ohrensessel, in dem sass mit ausschliesslichem Vorrecht – unser Schäferhund. Doch auch den Pflanzen, Blumen und Bäumen gehörte meine Liebe, und ich erinnere mich an unsere Familienspaziergänge, die für meine Eltern wohl jedes Mal zur Geduldstrapaze wurden, da sie immer wieder auf mich warten mussten. Erblickte ich nämlich irgendwo einen Baum, aus dessen Wunden im Stamm das Harz heruntersickerte, hatte ich das Gefühl, der Baum wäre am Verbluten und ich müsste ihn heilen, indem ich Blätter suchte und diese mit meinen kleinen Händchen auf die Wunden hielt. Damals mochte ich etwa vier Jahre alt sein. Mein Bruder war sechs Jahre älter als ich und wäre nicht die Tochter unserer damals ebenfalls schwangeren Emma gewesen, wäre ich wohl wie ein Einzelkind aufgewachsen. Doch Jeannette, einige Monate nach mir geboren, wurde für mich zur Schwester und ich konnte mit ihr spielen wie mit keinem anderen Kind. Ihre Fantasie glich der meinen und schien keine Grenzen zu kennen, ohne dass wir dafür teures Spielzeug benötigten. Wir waren unzertrennlich. Auch wenn das Leben uns unterschiedliche Rhythmen zugedacht hatte, sodass wir uns später oft für Jahre kaum sahen, das früh geknüpfte Band zerriss bis auf den heutigen Tag nicht.
Eltern können ihren Kindern kaum ein grösseres Geschenk machen, als ihnen die Möglichkeit und die Zeit zum schöpferischen Spiel und Kindsein zu lassen. Auch die Förderung tiefer, selbstgewählter Freundschaften ist ein unwiederbringliches Gut für ihr späteres Leben bis hinein in ein erfülltes Alter.
Ich war ein fantasievolles und verträumtes Kind und lebte dies im Spiel aus, doch wurde ich, vielleicht gerade aufgrund dieser Anlagen, auch mit der dunklen Kehrseite besonders sensitiver Menschen konfrontiert: Schon als Kleinkind wurde ich Nacht für Nacht von mich terrorisierenden Albträumen heimgesucht.
Es war stets der gleiche Traum: Kaum lag ich in meinem hellblauen, von meiner Mutter liebevoll mit Herzchen und Blumen bemalten Kinderbettchen und war eingeschlummert, tat sich der Boden unter meinem Bett auf und heraus krochen schwarze Tiere. Sie kamen unter dem Bett hervor, kletterten die Seitenwand empor und stürzten sich auf mich, das kleine schlafende Kind. In panischem Entsetzen schrie ich laut nach meinen Eltern und klammerte mich an sie, wenn sie herbeigeeilt waren. Sie versuchten mir zu helfen, indem sie ein kleines, gedämpftes Glaslämpchen in meinem Zimmer brennen liessen, das allerdings den ganzen Raum und besonders die geblümten Vorhänge in unheimliche Schatten tauchte. Ich wusste, dass es meine Eltern störte, wenn ich sie mit meinem Schreien aus dem Schlaf riss, und verhielt mich deshalb zumeist still, wenn die Albträume mich überfielen. So lag ich denn oft stundenlang angstvoll wach, manchmal erlöst vom Fliegeralarm und dem Gang in den Luftschutzkeller, wo ich dann wenigstens in der Geborgenheit meiner Eltern sein konnte und mein Vater Handorgel spielte, um uns Kinder vor den schrecklichen Geräuschen des Krieges zu bewahren. Doch der End-Alarm machte meine kleinkindlichen Hoffnungen auf Geborgenheit im Schosse der Familie fast jedes Mal zunichte, oft schon bevor wir, mit dem Vogelkäfig in der Hand, den Keller erreicht hatten. Das bedeutete für mich die Rückkehr in die schummrige Einsamkeit des Kinderzimmers, und wieder lag ich wach und lauschte den Geräuschen der Nacht. Eine Lokomotive dampfte nicht weit entfernt vorbei und ich hörte meinem Puls zu, bis mich der Schlaf übermannte, aus dem ich fast jede Nacht einmal erneut in Panik aufschreckte.
Oft lag ich auch wach und zerbrach mir den Kopf darüber, worin wohl der Erdball enthalten wäre. Gut ja, im Weltall, das hatte ich den Büchern meines Bruders entnommen. Aber worin ist denn das Weltall? Wohl eine weitere Hülle – aber was ist ausserhalb dieser und worin ist alles zusammen? Wann und wo hört das alles auf? Schnell lenkte ich dann meine Gedanken weg, denn sonst würde mir der Kopf zerspringen, dachte ich. Es war wohl einer der frühen Grundsteine meines heutigen Glaubens. Ich musste demütig akzeptieren, dass dem menschlichen Gehirn Grenzen gesetzt sind und dass es Dinge gibt, die nicht erklärbar sind. Als im Zeichen der Jungfrau Geborene dachte ich überhaupt viel nach, versuchte zu ordnen, gliederte meine Gedanken in Systeme ein und war auch schon früh recht einfallsreich im Erfinden von hilfreichen Eigentherapien – sei es bei Krankheiten, Ängsten oder in schwierigen Lebenssituationen. So kam ich denn auch, nach einigen Jahren der Albträume, im Alter von etwa acht Jahren auf eine rettende Idee, die mich innerhalb einer einzigen Nacht vom Terror des schwarzen Nachtgetiers befreite. Logisch überlegte ich mir, dass ich erfahrungsgemäss jedes Mal in dem Moment von dem Albtraum erlöst wurde, wenn der Schrecken am grössten war. Das war jedes Mal dann, wenn die «bösen Tiere», so nannte ich sie, mich mit ihren Krallen packten oder sie mich verfolgten, bis ich irgendwo hinunterstürzte und im Fallen erwachte. Also, schlussfolgerte ich eines Nachts, würde ich beim nächsten Überfall den schwarzen Ungeheuern ein Schnippchen schlagen und ihnen die Freude am Terror nehmen, indem ich mich, kaum dass sie angriffslüstern unter dem Bett hervorgekrochen waren und sich auf mich stürzen wollten, mitten unter sie werfen oder mich aus dem Fenster fallen lassen würde.
Diese Flucht nach vorn brachte den vollen Erfolg, indem ich den grössten Schrecken, der mich jeweils aufwachen liess, absichtlich provozierte. Von Stund war ich, abgesehen von ein paar immer seltener werdenden Träumen dieser Art, befreit. Enttäuscht liessen die schwarzen Biester von mir ab, denn sie hatten ihre Macht über mich verloren. Fortan schlummerte ich endlich meinen seligen Kinderschlaf.
Tierärztin – Modezeichnerin – Schauspielerin
Umso mehr träumte ich des Tags. Auch später, in der Schulzeit, wenn mich die Lehrer während des Unterrichts ansprachen, kam ich meist von irgendwo weit her und hatte keine Ahnung, worum es gerade ging. Meine Tag- und Schulstundenträume handelten oft davon, dass ich Menschen oder Tiere aus einer Katastrophe rettete, Waisenkindern ein Zuhause bot oder Weinende und Verzweifelte zu neuem Glück führte. Florence Nightingale, «der Engel der Gefangenen», machte tiefen Eindruck auf mich. Als der Lehrer von ihr erzählte, hatte ich gerade einmal aufgepasst.
Sei es in Märchen, Büchern oder Filmen, mein Herz schlug stets für die Unglücklichen und Benachteiligten. So verstand ich auch nicht, warum immer die Jüngste und Schönste den Prinzen bekam, und auch nicht, warum Gott so hart mit Kain abrechnete; hatte doch der arme Kain auch sein Bestes, nämlich Früchte, geopfert – während Abel, für mein tierliebendes Herz unverständlich, ein unschuldiges kleines Lamm tötete. Warum nur bevorzugte Gott dann Abel?
Grossen Trost hingegen, besonders später in der unglücklichen Phase der Pubertät, spendete mir Hans Christian Andersen mit dem «Hässlichen kleinen Entlein». Es gab also doch eine höhere Gerechtigkeit.
Von klein an wollte ich Tierärztin werden, das stand für mich jahrelang fest, bis mich mein Vater als etwa Elfjährige in einen amerikanischen Kinofilm mitnahm, der von einem kleinen schwarzen Lamm und einem Jungen namens Jeremias handelte. Im Verlaufe dieses Films verlor der Kleine sein Schaf, worauf er sich bitterlich weinend auf sein Bett warf. Mein Herz zerbrach fast vor Mitleid mit beiden, dem Jungen und dem Schaf. Abends spielte ich dann wieder und wieder diese Szene nach, warf mich schluchzend auf mein Bett und konnte nachfühlen, wie gross das Leid eines Menschen sein musste, der jemand innigst Geliebtes verloren hat.
Von da an, das war für mich klar, wollte ich Schauspielerin werden. Dies teilte ich meinen Eltern mit, die diesen Wunsch gerührt belächelten und sich sicher waren, dass dieser Kindertraum sich auswachsen würde. Sie sollten sich irren, denn sie kannten noch nicht meinen ebenso geduldigen wie hartnäckigen Durchhaltewillen, wenn es um eines meiner Ideale oder eine Vision ging. Doch war es noch lange nicht so weit, denn zuerst wurde ich zweimal umgeschult, von unserer Landschule in das städtische Gymnasium und von da – Tagträumer stiessen dort auf kein Verständnis – in die Rudolf-Steiner-Schule. Dies war ein weiser Entschluss meines Vaters, denn jetzt wurde ich zum ersten Mal mit einer Nächstenliebe ohne Vorurteile konfrontiert, wie ich sie zuvor nicht gekannt hatte. Wir teilten die Schulbank mit behinderten Kindern und spielten mit ihnen im Pausenhof. Dass man dem andern helfend beistand, war selbstverständlich. Mein Vater, stets ein Suchender, zudem Freimaurer und auch bewandert in Rudolf Steiners Schriften, hatte für mich, meiner grossen Sensibilität und meiner musischen und sprachlichen Begabungen wegen, die anthroposophisch ausgerichtete Rudolf-Steiner-Schule ausgesucht. Aufgrund der grossen Toleranz, die dort unter den Schülern gelebt wurde, fühlte ich mich als scheues Kind sofort zu Hause und eingebettet in die Freundschaften mit den andern Kindern. Niemand lachte einen wegen ausgefallener Kleidung aus und ebensowenig wegen Zahnspange oder Brille. Die Welt schien dort weiter und der Geist grösser zu sein. Es kam mir vor, als hätte ich Einzug ins Paradies gehalten.
Im Gegensatz dazu erinnere ich mich an ein Erlebnis als etwa Achtjährige in der vorherigen Landschule: Der Klassenlehrer, der mich nicht mochte, weil meine Mutter eine Ausländerin war und dazu noch Hochdeutsch sprach, äffte mich nach, denn ich blinzelte mit den Augen, wenn ich etwas von der Wandtafel lesen musste. Ich erzählte dies zu Hause und das Ergebnis war, dass man meine Kurzsichtigkeit entdeckte und mir eine Brille verschrieben wurde, was damals, genauso wie eine Zahnspange, rote Haare, Schielen oder Übergewicht eine Schmach erster Güte war und den Spott aller andern Kinder auf sich zog. Ich entschied mich, dem vorzubeugen und den Lehrer rechtzeitig einzuweihen, dass ich am nächsten Tag eine Brille tragen würde. Dennoch legte ich an diesem Morgen die Brille nur vor mich hin auf das Pult, wagte aber nicht, sie anzuziehen, und blinzelte weiter zur Wandtafel. Mitten im Unterricht stockte der Lehrer, richtete seinen Blick auf mich und fragte spöttisch und gedehnt in Vorfreude auf das Kommende:
«Sooo – und wo ist denn nun die berühmte Brille?»
«Hier», murmelte ich schüchtern und wies auf das Pult vor mir.
«Also, dann wollen wir sie einmal sehen, zieh sie an und zeig, wie du aussiehst damit!», fuhr der Lehrer höhnisch fort.
Mit zitternden Fingern zog ich sie umständlich an, und die ganze Klasse brach in schallendes Gelächter aus. Am lautesten aber lachte der Lehrer!
Ich fühlte mich wie an den Pranger gestellt, meine Augen füllten sich hinter den Brillengläsern mit Tränen und ich wäre am liebsten in den Erdboden versunken vor Scham.
Es war eines der Schlüsselerlebnisse, die mein Mitgefühl mit den Ausgestossenen und Leidenden noch mehr vertieften, und später war es oft so, dass ich den Verachteteten und Ausgelachten in der Schule meine Freundschaft schenkte und sie in ihrem Selbstbewusstsein aufzubauen versuchte.
Mitgefühl empfanden auch meine Eltern. Meine Mutter vor allem mit Tieren, bei meinem Vater hingegen erinnere ich mich an eine Geste gegenüber einem geächteten Menschen, die zeigte, dass er ein grosses Herz hatte und die mich als kleines Kind tief rührte und prägte:
Den Pfarrer unseres Religionsunterrichtes liebten wir alle. Er war dünn, blass und hatte sensible Gesichtszüge. Sanft und liebenswürdig von Charakter, erzählte er uns die biblischen Geschichten auf unvergleichliche Art. Zuweilen machte er eine Pause und fragte: «Wer geht für mich in den Laden an der Ecke meine Zigarren holen?» Alsbald schnellten die Hände aller Schüler in die Höhe, denn um das Privileg, ihm einen Gefallen zu tun, rissen wir uns alle, so lieb war er uns geworden.
Eines Tages kam er nicht mehr in die Schule, und uns wurde gesagt, dass er die Gemeinde verlassen müsse. Der Grund war, so erzählte man sich empört, seine Liebesgeschichte mit einer verheirateten Frau. Dafür wurde er von den erbosten Gemeindemitgliedern nun auch gebührend mit Häme bedacht, geächtet und man ging grusslos an ihm vorbei. Die Steine der Gerechten trafen ihn bis zu seinem Wegzug ohne Unterlass, denn offenbar bestand unsere Gemeinde nur aus Menschen, die ohne Sünde waren. Nie vergesse ich, wie mein Vater mich eines Tages zur Schule fuhr, die auf dem Weg zu seinem Geschäft lag, und unseren verstossenen Pfarrer mit einer schweren Mappe am Strassenrand gehen sah, denn vermutlich wagte er die Strassenbahn nicht mehr zu benützen. Mein Vater hielt das Auto an und fragte liebenswürdig: «Herr Pfarrer, wollen Sie mit uns fahren?»





























