
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Derya steckt nach der Scheidung von ihrem grausamen Mann in einer Krise. Immer mehr zieht sie sich in ihre eigene Welt zurück und lässt kaum jemanden an sich heran - bis eines Tages ihre Jugendliebe Jakob wieder vor ihr steht. Auch nach all den Jahren hat er nichts von seinem damaligen Charme eingebüßt, und zum ersten Mal seit langer Zeit ist Derya endlich wieder glücklich. Aber zeitgleich mit Jakobs Auftauchen beschleicht sie immer öfter eine unbestimmte Angst. Sie hat das Gefühl, beobachtet zu werden, und bald ist sie sich sicher, dass jemand sie verfolgt. Ist ihr Ex-Mann hinter ihr her? Doch dann offenbart Jakob Derya ein furchtbares Geheimnis, das sie daran zweifeln lässt, ob sie ihn wirklich kennt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Derya steckt nach der Scheidung von ihrem grausamen Mann in einer Krise. Immer mehr zieht sie sich in ihre eigene Welt zurück und lässt kaum jemanden an sich heran – bis eines Tages ihre Jugendliebe Jakob wieder vor ihr steht. Auch nach all den Jahren hat er nichts von seinem damaligen Charme eingebüßt, und zum ersten Mal seit langer Zeit ist Derya endlich wieder glücklich. Aber zeitgleich mit Jakobs Auftauchen beschleicht sie immer öfter eine unbestimmte Angst. Sie hat das Gefühl, beobachtet zu werden, und bald ist sie sich sicher, dass jemand sie verfolgt. Ist ihr Ex-Mann hinter ihr her? Doch dann offenbart Jakob Derya ein furchtbares Geheimnis, das sie daran zweifeln lässt, ob sie ihn wirklich kennt …
Über die Autorin
Jennifer Benkau, Jahrgang 1980, ist erfolgreiche Autorin von Fantasy- und Jugendromanen. 2013 erhielt sie den DeLiA-Literaturpreis. Inzwischen widmet sie sich vor allem dem psychologischen Spannungsroman. Jennifer Benkau lebt mit ihrem Mann, ihren Kindern und vielen Tieren im Rheinland.
Jennifer Benkau
Mein Wille geschehe
Psychothriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefanie Kruschandl, Hamburg
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
Unter Verwendung eines Motivs von © istockphoto / Skodadad
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3959-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
VII
Ich dachte nicht oft an sie, aber wenn, dann bekam ich sie eine Weile kaum aus dem Kopf.
Sie wurde zum Geist, der mich verfolgte und über meine Versuche zu entkommen bloß höhnisch grinste. Sie kam immer zu mir zurück, wenn ich hoffte, über sie hinweg zu sein. Dann tauchte sie auf. Ein winziger unaufmerksamer Moment genügte. Ein Blinzeln vielleicht, und schon erschien sie auf der Innenseite meiner Augenlider. Sie lächelte, zeigte mir Blut und Tod und schrie meinen Namen.
In diesen Zeiten schien die Welt ihren Kummer zu bündeln und konzentriert auf mich loszulassen. Ich stand im Elend wie ein Schauspieler im Spotlight. Nächtelang lag ich wach, zwang meinen Körper, im Bett zu bleiben, auch wenn es sich anfühlte, als würde ich still liegen, während Wasser in mein Gefängnis gelassen wurde oder Ratten meine Fuß- und Fingernägel abfraßen. Ich blieb unter meiner Decke, auch wenn der Schweiß in Strömen über meinen Körper rann, und kämpfte den Kampf, bis die Sonne wieder aufging.
Ich wusste genau, dass es nur einen schwachen Moment brauchte, um mich an ein Telefon oder einen Computer zu setzen und nach ihr zu suchen. Es wäre leicht, sie zu finden, und mit ihr das, was sie mir in den Albträumen versprach. Blut, Tod und kaltes Grauen.
Ich musste nicht darauf hoffen, dass es ein Traum blieb. Es war ein Versprechen. Verheißung und Drohung.
Einmal konnte ich den Kontakt zu ihr nicht verhindern. Er war einseitig, sie wusste von nichts und hat vermutlich nie davon erfahren. Und trotzdem fürchtete ich lange, dass ich mich verraten hatte und sie mich finden würde.
An das Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern, nur noch an die Stimmung damals. Washington schien depressiv und verstimmt, schuld war zweifelsfrei die politische Lage, aber wir schoben es aufs Wetter, weil sich darüber leichter reden lässt. Es war Spätsommer, aber gefühlt schon längst Herbst, und die Menschen waren den Winter leid, bevor er einsetzte. Zwischen zwei Interviews traf ich in einem Hotel eine Frau, die sie kannte, und war eine Sekunde lang unvorsichtig. Wir setzten uns an einen Fenstertisch in der Hotelbar. Tranken ein Glas Wein zusammen. Machten angespannten Smalltalk. Dann fragte ich nach ihr. Wie es ihr ging. Harmlos, sollte man meinen. Aber ich dachte an Blut und Tod und kaltes Grauen.
Die Frau seufzte grabestief. Sie wollte ebenso wenig über sie sprechen wie ich, aber sie war zu höflich, um mich aufzuhalten, und ich einen Moment lang zu fatalistisch.
Einsam ist sie, sagte die Frau. Und noch etwas anderes, was ich später wieder vergessen habe, weil es unbedeutend war. Die Frau schien es zu treffen, sie wirkte tief betrübt, dabei kannte sie sie nur flüchtig.
So bedauerlich, wiederholte sie immer.
Einsam. Das erklärte alles. Das war der Grund, warum sie von Zeit zu Zeit kam und ihre Bilder mit mir teilte; sie mir aufzwang. Blut und Tod und … Sie wissen schon. Sie musste damit zu mir kommen, denn es gab für sie nur mich.
Ich sagte, das würde zu ihr passen. Ich sagte, sie sei immer einsam gewesen. Ich versuchte nett zu sein, die betrübte Frau aufzuheitern, und sagte, wenn die Einsamkeit je einen neuen Namen haben wollte, sollte sie Deryas nehmen und ihr stattdessen den ihren geben.
Der Versuch war ehrlich gemeint, aber offenbar ungeschickt, denn die betrübte Frau wurde noch trauriger, und vor dem Fenster mischte sich Schnee in den Regen.
Später dachte ich, dass es nicht nötig sei, den Namen zu tauschen. Die Einsamkeit sollte Deryas Namen einfach nehmen. Derya brauchte überhaupt keinen Namen. Es gab ohnehin niemanden mehr, der ihn hätte nennen können.
Niemanden außer mir.
Irgendwann würde ich zu ihr zurückkommen müssen.
Kapitel 01
Es hätte ein normaler Tag werden können. Ein guter Tag. Ruhig.
Stattdessen kommt er zurück, und ihr wird warm ums Herz.
Er kommt zurück, zieht die Brauen zusammen – auf die Art, wie man es tut, wenn man sich an jemanden erinnert, sein Gegenüber aber nicht ganz einordnen kann –, lächelt und hebt zum Gruß die Hand. Er zerstört, was sie hasst und gleichzeitig verzweifelt zu retten versucht. Ihr stinknormales Leben.
Die Zeit, mein Kind, heilt dir alle Wunden, hat ihre Oma immer gesagt. Diese alte Frau mit ihren naiven Phrasen, mit denen sie alles kleingeredet hat, was Derya Schmerz bereitete.
Die Zeit heilt dir alle Wunden, Kind, also müssen wir uns auch nicht weiter drum scheren.
Derya vermisst ihre Oma so sehr, dass der Schmerz ihr manchmal den Atem raubt.
Ihr Atem geht schwer. Sie muss das Tablett in einem Regal zwischen Milchtüten und Zuckerpäckchen abstellen, sich an die Wand lehnen und die Augen schließen, um sich zu sammeln. Ihre Hände zittern, sie kennt das schon: Sie werden nun minutenlang zittern, als wäre sie unterzuckert. Sie wird es nicht schaffen, auch nur ein Glas unfallfrei zu einem Gast zu bringen. Nicht, solange er da draußen sitzt, als wäre er nie fort gewesen.
Mistkerl, verdammter! Wie kann er es wagen, jetzt zurückzukommen? Jetzt, in diesem Moment, als sie nichts weiter als eine Kellnerin ist? Wo ist er gewesen, als man ihr Bild in Zeitungen und Illustrierten abgebildet hatte, als sie auswählen konnte, ob sie zu Markus Lanz oder Günther Jauch in die Show kommen will – oder lieber auf Mettschnittchen und ein paar harmlose Sticheleien bei Stefan Raab? Doch das Leben mit Champagner und Canapés ist vorbei, heute ist sie diejenige, die Getränke und Häppchen serviert. Und die Zeit, diese verdammte Hexe, hatte fünfzehn Jahre Zeit, um die Wunden eitern zu lassen.
Er hat sie bestimmt erkannt, auch wenn sie gleich herumgewirbelt ist, um in die Küche zu flüchten. Beinahe pirouettenartig. Wie damals, im Ballettsaal, als er …
Daran darf sie nun nicht denken – sie darf überhaupt nicht an ihn denken.
Mit dem Rücken an der Kachelwand wartet sie ab, hofft auf eine Kollegin, bei der sie sich unter einem Vorwand entschuldigen kann. Sie ist eine miserable Lügnerin, sie braucht eine gute Ausrede. Denk nach, Derya, mahnt sie sich. Denk an irgendetwas, nur nicht an ihn, nur nicht an ihn!
Ja…
Ein Migräneanfall würde sich anbieten, oder ein Kreislaufzusammenbruch, das würde man ihr glauben. Blass genug ist sie nach dem Schreck bestimmt.
Jak…
Später dann einkaufen – unbedingt einkaufen. Milch, Joghurt und Katzenfutter. Katzenfutter, keinesfalls Odins Lieblingsfutter vergessen, sonst ist er beleidigt und kotzt in ihre Schuhe.
Jako…
Abends hat sie eine Schicht an der Kasse. Von sechs bis zehn, eine gute Schicht, da kommen viele hektische Kunden, allesamt in Eile. Menschen, die die Zeit schneller vergehen lassen. Menschen, die sie als Kassiererin kaum eines Blickes würdigen. Genau so, wie es ihr am liebsten ist. Solche Schichten machen müde, sie lähmen die Gedanken, die stören wollen. Das Einschlafen fällt an diesen Abenden leichter und …
Jakob.
Jakob. Jakob. Jakob.
Hellbraunes Haar. Hellbraune Augen. Leicht sonnengebräunte Haut.
So viele Jahre ist das her. Er hat sich nicht verändert.
Aber sie. Und wie sie sich verändert hat.
Sie denkt an Blut und Tod und kaltes Grauen, einen kurzen Moment lang, den sie sich nicht erklären kann. Ein Déjà-vu?
Sie verdrängt es. Vergisst es. Es ist nie geschehen.
»Derya?« Die Schiebetür wird aufgezogen. Dahinter steht Toni, ihr Chef. Toni heißt eigentlich David Schmitzke, sieht aber mit seinen schwarz getönten Haaren irgendwie italienisch aus und hat sein Café Toni’s genannt – mit Deppenapostroph, was Derya tagtäglich zur Verzweiflung bringt, wenn sie das Logo über der Tür, auf den Schürzen und den Papierservietten sieht. Daraufhin begannen alle, ihn Toni zu nennen. Toni blickt verständnislos von ihr zu ihrem Tablett, auf dem der Milchschaum von zwei Latte macchiato langsam in sich zusammenfällt. »Was machst du denn hier, die Gäste warten doch, was ist denn los, und wie siehst du überhaupt aus?«
Derya reibt sich die Stirn. »Ich … mir ist schwindelig geworden. Ich musste kurz …« Ihre Wangen brennen, sie fühlt, wie sie vom Lügen rot wird.
»Du musst doch Bescheid sagen!« Kopfschüttelnd schiebt Toni sie zur Seite und greift nach ihrem Tablett. »Ich übernehme für dich, leg dich eine halbe Stunde hin, nur fall uns hier nicht um, und bitte, bitte übergib dich nicht, was sollen die Leute denken?«
»Tut mir leid, Toni«, murmelt sie, aber wie es seine Art ist, hat sich ihr rastloser Chef mitten in einem unverständlichen Wortschwall bereits wieder auf den Weg gemacht. Schon sieht sie seine magere, hochgewachsene Gestalt um die Kurve biegen. Toni steht nie auch nur eine Sekunde still, vermutlich, denkt sie oft, ist er deshalb so dünn wie ein Faden. Er müsste essen wie ein Hochleistungssportler, aber als Gastronom hat er dazu beim besten Willen keine Zeit. Toni trinkt tagsüber nicht einmal seinen eigenen Kaffee, um keine Minute mehr als dringend nötig auf der Toilette zu verbringen.
Deryas Füße fühlen sich an, als ginge sie über Schwämme, als sie zum Pausenraum tappt, wo sie sich in einen Sessel sinken lässt. Mit einer der kleinen Wasserflaschen, die immer bereitstehen, versucht sie, ihre brennenden Wangen zu kühlen, aber das Getränk ist lauwarm und hilft nicht. Hoffentlich sehen die Kollegen sie nicht in diesem Zustand. Von irgendeinem Mann aus ihrer Jugend derart aus der Bahn geworfen zu werden, ist ihr peinlich. Sie ist doch kein pubertierendes Mädchen mehr, sondern eine Frau von zweiunddreißig, mit einer Lebenserfahrung, die für das doppelte an Jahren genug sein sollte! Nichtsdestotrotz fühlt sie sich klein und hilflos – genau wie damals, als sie Jakob kennengelernt hat.
Er taucht auf und dreht die Zeit zurück.
Jakob war bereits Chefredakteur der Schülerzeitung, als sie in der sechsten Klasse war und er in der achten. Seine Finger huschten flink über die vergilbte Tastatur des veralteten Commodore-Computers in dem kleinen Zimmer, das sie als Redaktion nutzten. Die Heizung knackte hier lauter als in jedem anderen Raum der Schule. Bei ihr dauerte das Tippen ungleich länger als bei Jakob, und das Geräusch der Tasten war nicht wie Musik, sondern stockend und ohne Rhythmus. Ihr erster Artikel für die Schülerzeitung war ein Bericht über einen Auftritt der Tanz-AG auf einem Stadtfest. Da sie Ballett tanzte, hatte man ihr die Aufgabe anvertraut. Das Foto war unscharf, ihr Text demütigend schlecht. Aber sie durfte weitermachen.
»Derya, du musst ein Leerzeichen nach den Punkten setzen«, erklärte Jakob und lehnte sich dabei über ihre Schulter, sodass seine Wange dicht neben ihrer war.
»Ist das so?« Sie wollte nicht widersprechen. Sie wollte nur weiter mit ihm sprechen.
»Ja, das ist so.«
»Warum danach? Warum nicht vor den Punkt? Das wäre doch logischer.«
»Weil«, Jakob sah sie an und dehnte das Wort, sodass es ihre Haut streifte, »das so ist.«
»Wer sagt das?« Nur noch ein Hauchen, aber sie fühlte sich mutig und verwegen, als sei ihr Dialog etwas Großes. Ihre Knie zitterten unter dem Tisch, wo er sie nicht sehen konnte.
Ein einzelnes Lachen, knapp durch die Nase gestoßen, war die Antwort. Das Lächeln auf seinen Lippen war sanft. »Mach einfach das Leerzeichen.« Und schon war er wieder fort.
Jakob. Ein einziger Tanz auf der Karnevalsfeier, als sie in der siebten Klasse war und er in der neunten. Zu »Wind of Change« von den Scorpions verlagerten sie ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen und guckten aneinander vorbei. Ihre Hände lagen auf seinen Schultern und seine an ihren Hüften. Sein Gesicht war knallrot. Vielleicht sogar unter dem Teufels-Make-up. Nach dem Tanz fuhr er mit den Hörnern auf der Stirn auf seinem BMX-Rad heim, und Derya blieb glücklich zurück, weil er zwar vor ihr mit allen anderen Mädchen getanzt hatte, aber nach ihr mit keiner mehr.
Jakob. Ein schüchterner Kuss auf dem Mädchenklo, als sie in der achten Klasse war und er in der zehnten. Sie hatte sich den Finger in der Tür gequetscht, so doll, dass es blutete, und er führte sie zum Waschbecken und ihre Hand unter den Wasserstrahl. Er hielt sie sanft fest, während das eisige Wasser in der Wunde brannte. Dann bewunderte er eine endlose Zeit lang die Tränen in ihren Augen, die sie durch pure Willenskraft nicht hinaus ließ. Schließlich beugte er sich zu ihr hinab und berührte ihre Nase mit seiner. Sie hob den Kopf, und er küsste sie, und es war schön und sonst nichts.
Das ist sechzehn Jahre her, doch der Geschmack seiner Lippen bei diesem ersten Kuss ist immer noch präsent, ebenso wie der Duft des Deos, das er damals benutzt hatte. Nivea. For men – aber was machte das schon? Sie hatte es sich ebenfalls gekauft, um jeden Tag daran riechen zu können und um etwas davon in ihr Bett zu sprühen, sodass es roch, als läge er neben ihr, wenn sie die Augen schloss.
Jakob. Ihr Freund, ihr bester und ihr fester Freund, ihre erste Liebe – und rückblickend auch ihre einzige. Der auf ihrer Abschlussfeier nach der zehnten Klasse verkündete, dass er in die Staaten ziehen würde, wo sich seine Träume erfüllen sollten. Die Bombe hatte Deryas Leben in Schutt und Asche gelegt.
Pläne. Zukunft. Die Aussicht auf einen tollen Sommer, bevor ihre Ausbildung begann. All das hatte er aufgebaut und nun mit seinen Worten zerfetzt. In tausend Teile. Scherben hätte sie wieder zusammenfügen und kleben können. Doch diese winzigen Splitter, die nicht.
»Sprich mit mir!«, flehte sie ihn an. »Warum? Warum hast du es nicht früher gesagt?«
»Hätte es etwas geändert? Du begreifst überhaupt nichts, wirst das nie verstehen. Lass mich in Ruhe!«
Er betrank sich und stieß Derya auf dem Schulhof zur Seite, sodass sie in ihrem kurzen Kleid auf den Asphalt fiel. Jemand musste ihn stützen, so besoffen war er, und Derya konnte nur fassungslos zusehen, wie der einzige Mensch, der ihr Leben sicher und kontrollierbar machte, selbst völlig die Kontrolle verlor. Etwas später kotzte er in einen Mülleimer, und danach heulte er im Arm von Christina Stahlmann – ausgerechnet der – wie ein Baby und ließ zu, dass Christina Derya fortschickte. Derya wollte gern sterben, aber es ging nicht.
Es war das letzte Mal, dass sie ihn sah, bevor er verschwand. Der Moment, als aus der kindlichen Traumvorstellung vom Glücklichwerden die Realität wurde. Und sie für immer zu träumen aufhörte.
Es vergeht eine schier endlose Zeit, bis Derya es wagt, den Pausenraum zu verlassen und hinaus ins Café zu linsen. Jakob ist weg. Natürlich ist er das. Er hat sie überhaupt nicht erkannt, würde sich gewiss kaum noch an sie erinnern.
»Ich bin wieder okay«, lässt sie Toni wissen, empfängt einen Schwall von Anweisungen und nimmt ihre Arbeit auf, als sei nichts gewesen. Das leichte Zittern ihrer Hände ignoriert sie, bis es sich legt, und mit ihm die Angst, Jakob könnte plötzlich wieder im Café erscheinen. Warum sollte er? Selbst wenn er sie erkannt hätte, würde er vorgeben, es nicht zu tun. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, an das sich alle Menschen aus ihrer Kindheit und Jugend halten: Derya erkennt niemanden, und Derya wird von niemandem erkannt. Sie weiß um die Konsequenz, mit der diese Regel eingehalten wird, denn sie selbst überwacht sie.
Sie hat neu angefangen, ganz von vorn, bei null. Ein neues Leben, ein stinknormales, ruhiges, stabiles Leben. Das ist alles, was sie haben will.
Bis er hier aufgetaucht ist. Und Derya erkennen muss, dass sie gar nichts hat.
Am Ende sah es immer wie ein Unfall aus.
Das war das Ziel, aber ebenso wichtig war der Weg. Wenn er sich schon die Mühe machte, jemanden umzubringen, dann sollte derjenige nicht ahnungslos in seinen Tod stolpern und sang- und klanglos aus dem Leben scheiden. Das Opfer sollte sich seiner Rolle langsam bewusst werden. Es sollte bemerken, dass Blicke auf ihm ruhten, aus Augen, die schärfer waren als die eigenen. Es sollte spüren, dass es Teil eines Plans geworden war, erdacht von einem Geist, der gewitzter war als der eigene. Es sollte behutsam registrieren, dass Sicherheit ein Hirngespinst war, von dem es sich nun lösen musste.
Es sollte Angst bekommen. Sie hatten diese Angst verdient, und er sorgte dafür, dass sie bekamen, was sie verdient hatten.
Als er sein neues Opfer zum ersten Mal in Augenschein nahm, war es noch vollkommen ahnungslos. Er dagegen wusste schon, wie es sterben würde.
Und am Ende würde alles wie ein Unfall aussehen.
Kapitel 02
Deryas Nachbarin und beste Freundin Susanne steht im Flur, als Derya die Haustür aufschließt, und sammelt Orangen auf, die ihr aus ihrem vollgestopften Weidekorb gefallen sein müssen. Ein paar kullern die Treppen hinab. Eine rollt Derya vor die Füße, sie stoppt sie mit der Stiefelspitze.
»Derya, Süße. Hallo! Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Obst will türmen.«
»Hallo Sonne.« Derya stellt ihre eigene Einkaufstüte ab, um beim Einsammeln zu helfen. Den Spitzname ihrer Freundin auszusprechen, reicht wie immer aus, damit sich in Derya alles leichter anfühlt. Irgendwie heller. Zu niemandem hätte er besser passen können. Susanne ist eine Frau, in deren Gesicht ständig ein Strahlen leuchtet, und ihre blonden, ungebändigten Locken erinnern an die Sonne. Sie hat außerdem rote Apfelbäckchen, die aussehen wie aufgemalt, dabei verwendet sie all ihr Make-up nur, um diese leuchtenden Wangen zu kaschieren. Derya kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, warum. Heimlich nennt sie Sonnes Wangen Sommersonnenwangen und beneidet sie darum. Sie selbst ist immer blass, so blass, dass sämtliche Friseure ihr sagen, sie solle aufhören, ihr Haar zu färben. Dass es ihre Naturhaarfarbe ist, will niemand glauben; zu wenig passt ihre helle Haut zu dem schwarzen Haar.
Sonne arbeitet halbtags in einer Versicherung, ihre wahre Berufung allerdings ist ihr kleiner Internetshop, über den sie liebevoll selbst genähte Buchhüllen, Handytaschen, Kissenbezüge und entzückende Kuscheltierchen verkauft, von denen sie sich einzeln verabschiedet, ehe sie sie verschickt. Derya kann sich nicht erklären, warum eine einnehmende Person wie Susanne nicht ein ganzes Rudel Freundinnen hat wie Carrie aus Sex in the City. Stattdessen hält Sonne sich an Derya, die sich neben ihr fühlt wie der Mond: bleich und kühl. Es stört Derya nicht; nein, sie muss zugeben, dass sie sich wohlfühlt in der behaglichen Wärme von Sonne.
»Was hast du denn mit den ganzen Früchten vor? Hast du nie von dem gefährlichen Vitamin-C-Schock gehört? Oder Hypervitaminose?«
»Sei jetzt stark! Ich wollte damit zu dir.« Sonne wirft Derya eine der Orangen zu und geht mit ihr die Treppe hoch zu Deryas Wohnung im Erdgeschoss. »Der Wetterbericht droht eine Woche Dauerregen an, und ich dachte, ich mixe uns beiden ein paar Grippe-nein-danke-Smoothies.«
»Lieb, dass du an mich denkst.«
»Reiner Eigennutz.« Sonne lächelt. »Ich brauche nämlich deinen Rat. Außerdem ist mein Mixer kaputt. Du hast doch einen?«
»Ich habe einen Pürierstab. Glaube ich.«
»Damit lässt sich arbeiten.«
Derya schließt die Tür auf, schlüpft aus ihren Schuhen und bringt ihre eigenen sowie Sonnes Einkäufe in die Küche, bevor sie sich den Mantel auszieht und ihn sorgfältig und faltenlos über einen Bügel hängt. Ihr Kater Odin begrüßt sie mit einem Miauen und streicht so penetrant um ihre Beine, als wolle er sie zum Fallen bringen. »Du verfressenes weißes Ungetüm!«, schimpft sie liebevoll. »Du glaubst nicht ernsthaft, dass du dein Abendessen jetzt schon bekommst. Magst du einen Kaffee, ehe wir uns ans Obst machen, Sonne?«
Sonne hat sich ebenfalls ihrer Jacke entledigt, setzt sich an den Küchentisch und hebt den Kater auf ihren Schoß. »Danke, nein. Du weißt doch, dass ich nicht schlafen kann, wenn ich am späten Nachmittag noch Kaffee trinke.«
Derya geht es ähnlich, genau deshalb trinkt sie den Kaffee.
»Mich wundert es ohnehin, dass du aus einem italienischen Café kommst und sofort dieses schreckliche Ding einschaltest, kaum dass du zu Hause bist.«
»Gewohnheit«, antwortet Derya und nimmt sich eine Tasse aus der sorgfältig abgestaubten Vitrine.
»Eine Macke trifft es eher, fast so übel wie dein Putzfimmel. Diese Wohnung hier macht mir ein schlechtes Gewissen: Wann immer man sie betritt, sieht es aus, als hättest du gerade erst geputzt.«
»Ich mag es halt sauber.«
»Nein, du hast keine Hobbys.« Ehrlichkeit ist Sonnes zweiter Vorname, da macht sie wenige Kompromisse. Aber sie verfügt über die Art von Gemüt, das dazu führt, dass sogar das Zanken mit ihr etwas Nettes bekommt.
»Ein paar kleine Macken musst du mir lassen, oder wir diskutieren über deine hässliche Porzellanelefanten-Sammlung. Ich trinke jetzt Kaffee. Auf der Arbeit kommt man nicht dazu. Und ich mag meinen ohnehin lieber.« Von meinen eigenen Tassen weiß ich, dass sie sauber sind, setzt sie in Gedanken nach.
»Das soll dein Frauchen bloß nicht ihren heißblütigen, italienischen Chef hören lassen«, sagt Sonne an Odin gewandt. Der Kater dreht sich auf den Rücken und reckt ihr den Bauch zu, den Sonne hingebungsvoll zu kraulen beginnt.
»Der würde mich zum Teufel jagen«, scherzt Derya. »Aber jetzt raus mit der Sprache: Wobei brauchst du meinen Rat?«
Sonne seufzt und Derya kennt ihre Freundin gut genug, um keine weitere Antwort zu benötigen. »Es geht um deinen Bruder, oder? Er braucht …« Wieder Geld von dir, will sie sagen, aber sie kann sich ihre Worte gerade noch verkneifen. Sie möchte Susanne nicht verletzen, genau das würde sie mit zu viel Ehrlichkeit aber erreichen.
»Er hat mich gebeten, ihm noch mal auszuhelfen«, murmelt Sonne. »Aber ich weiß nicht, ob ich ihm damit einen Gefallen tue.«
Derya lässt ihren Kaffee stehen, setzt sich neben die Freundin an den Tisch und nimmt ihre Hand. »Er ist wieder nicht zu dieser Therapie gegangen, oder?«
Susanne schüttelt den Kopf. Sie wirkt plötzlich sehr müde. »Er will mir weismachen, dass er keine Zeit dazu hatte.«
»Du glaubst ihm aber nicht.«
»Nein.«
»Wozu braucht er das Geld diesmal?«
Sonne lacht freudlos. »Um sein Auto reparieren zu lassen. Angeblich fährt es nicht mehr, was eine Katastrophe ist, denn er braucht es ja, um zum Arzt und zur Therapie zu kommen und wohin er sonst noch so dringend muss. Komisch nur, dass es abends vor seiner Wohnung parkt und tagsüber nicht. So kaputt kann es also nicht sein. Warum lügt er nur ständig, Derya, warum?«
Derya hat keine Antwort, die Sonne nicht selbst kennt. Ohne weitere Worte nimmt sie sie in den Arm. Es muss hart sein, mitansehen zu müssen, wie der jüngere Bruder von einer Sucht aufgefressen wird, wenn man selbst bloß hilflos zusehen kann. Sie kennt diesen Bruder nicht und vermag sich nur annähernd vorzustellen, was ihre Freundin durchmacht.
»Er hat doch nur noch mich«, flüstert Sonne. In diesem Moment wirkt sie sehr klein, und Derya möchte sie am liebsten unter ihre Jacke stecken und vor den Grausamkeiten dieser Welt beschützen, die so oft zu hart, zu kalt und zu trist für jemanden wie Sonne ist.
Ihre eigenen Sorgen schrumpfen wie Rosinen zusammen angesichts dieser Probleme. Wie unbedeutend ist plötzlich die Frage, ob ein Mann, den sie aus ihrer Jugend kennt, sie gesehen hat. Wie vollkommen egal ist es, ob er vielleicht hin und wieder an sie denkt?
Aber wem will sie etwas vormachen? Der Mann ist womöglich Jakob.
Und das ändert alles.
Als sie am Abend bei der Arbeit sitzt und die Einkäufe später Kunden abkassiert, muss sie wieder an Jakob denken. Niemand hier sieht ihm auch nur annähernd ähnlich, aber überall, wo sie hinsieht, meint sie, seine Augen zu erkennen. Für gewöhnlich weiß Derya sich hinter ihrer Arbeit gut zu verstecken.
»17 Euro 97, bitte. Haben Sie eine Payback-Karte?«
»Nein.«
»Sammeln Sie unsere Treuepunkte?«
»Ja, danke.«
»Und zwei Euro drei zurück, bitte schön. Haben Sie einen schönen Abend.«
Der Job als Kassiererin ist perfekt für sie und ihre Neurosen, über die sie sich ärgert und die sie gleichzeitig pflegt wie niedliche, kleine Haustiere, weil sie ohne sie nicht sie selbst wäre. An der Kasse oder beim Kellnern im Café gelingt es ihr mühelos, mit fremden Menschen zu kommunizieren, zu lächeln, hin und wieder das kleine bisschen Smalltalk zu halten, das sie braucht, um sicher sein zu können, dass sie nur ein wenig sonderbar ist, aber nicht ernsthaft psychisch krank. Schüchtern, ja – aber nicht soziophob. Früher ist sie regelmäßig in Panik geraten, weil sie glaubte, aus den Bahnen geschlittert zu sein, in denen sich normale Menschen bewegen. Künstler gelten als anfällig für Geisteskrankheiten, sie sollte froh sein, dass es mit der Kunst nicht mehr weit her ist. Ist sie aber nicht.
Inzwischen weiß sie, dass sie zwar ins Trudeln geraten ist, die Kurve aber noch gekriegt hat. Ihre Psychotherapeutin sagt es. Sonne bezeugt es. Und ihre Jobs, in denen sie ohne mit der Wimper zu zucken mit fremden Menschen kommuniziert, beweisen es.
»45 Euro 12, bitte. Haben Sie eine Payback-Karte?«
»Nein. Ich zahle mit EC.«
»Gern. Die Karte bitte hier reinschieben. Den PIN-Code eingeben und mit Grün bestätigen. Sammeln Sie unsere Treuepunkte?«
Ihre Jobs – Schal und Mütze, mit denen sie ihre Einsamkeit wärmt und behütet. Die Phrasen – eine Maske, die ein Lächeln zeigt, egal, wie es dahinter aussieht. Das geht niemanden etwas an.
Kunde um Kunde spult sie ihr Programm ab, in Gedanken ist sie Jahre fort. Früher hatte es an jeder Ecke noch Kioske gegeben, bei denen man abends und am Wochenende Getränke, Süßigkeiten und Zigaretten kaufen konnte. Sie erinnert sich noch genau, was Jakob immer bestellt hat: eine Packung Lucky Strikes und eine gemischte Tüte für zwei Mark. Jakob, der damals noch nicht sicher war, ob er ein erwachsener Mann oder ein halbwüchsiger Junge war. Heute gibt es die kleinen Buden in Düsseldorf kaum noch – wer braucht sie auch, da sämtliche Supermärkte von Montag bis Samstag noch spät in den Abend hinein geöffnet haben? Derya fragt sich, ob Jakob wohl noch immer raucht – er wollte damals schon aufhören – und ob er immer noch so gern Weingummi mag.
Der nächste Kunde legt Lucky Strikes und zwei Tüten Haribo aufs Band. Derya sieht sehr langsam auf. Hofft. Fürchtet. Betet.
Es könnte Jakob sein.
Er ist es nicht, es ist ein Junge von vielleicht fünfzehn Jahren, der die Haare ähnlich trägt wie Jakob früher. Aber seine sind blond, nicht hellbraun. Seine Augen sind blau, nicht haselnussbraun. Er zetert und nennt sie eine Schlampe, als sie wegen der Zigaretten nach seinem Ausweis fragt. Jakob hätte das nie getan.
Er war Mörder aus Überzeugung und zufrieden damit.
Weder unterlag er dem Wahn, etwas Gutes zu tun, noch glaubte er an Unsinn wie eine göttliche Bestimmung, die ihn dazu trieb. Er war nicht gezwungen zu töten. Keines von den erbärmlichen Würstchen, die aus finanzieller oder emotionaler Notlage irgendwo reingerieten, aus Habgier oder anderen niederen Beweggründen.
Er war Pragmatiker, und wenn sich hin und wieder nach sorgsamer Recherche herausstellte, dass ein Mord die effektive Lösung eines Problems darstellte, setzte er sich in sein Stammcafé, bestellte eine Kanne Tee und plante die nächsten beiden Stunden sein Vorgehen; von der Annäherung an sein Opfer über den Angriff, die Phase des Strafens bis hin zu der Frage, wie er die Überreste beseitigen sollte, damit alles wie ein harmloser Unfall aussah.
Er war akribischer als jeder Mensch, den er kannte, intelligent, vorsichtig, aber furchtlos und nicht nur ein Planungs-, sondern auch ein Improvisationstalent. Vor allem aber war er aus tiefster Seele konsequent. Nie hätte er es zugelassen, dass seine Routine ihm zum Verhängnis wurde. Jeder Mord musste so vollendet wie der vorherige ablaufen. Sein Anspruch war hoch. Er war mit allem auf der Welt nachsichtig, nur nicht mit sich selbst. Schließlich kannte er sich gut genug, um Perfektion erwarten zu können. Wenn man ihn fragte, warum er Psychologe geworden war, warum er Tennis spielte oder am Klavier Lieder komponierte, antwortete er: »Weil ich es kann«, und genau das wäre auch die Antwort gewesen, wenn man ihn gefragt hätte, warum er Menschen ermordete. Dass ihn niemand je fragte, bewies es.
Kapitel 03
Es ist fast halb elf, als Derya sich endlich auf dem Heimweg befindet. Der Wind fährt ihr immer wieder unter den Mantel und greift wie eine grobe, kalte Hand an ihren Rücken. Sie ist müde und friert. An einem griechischen Imbiss, der noch offen hat, bestellt sie sich einen großen Kaffee und kippt drei Päckchen Zucker hinein.
»So spät noch unterwegs?«, fragt der Mann hinter der Theke. Er sieht aus wie der Hirte aus der Patros-Werbung, nur dass er einen dunklen Trainingsanzug trägt, der um den Bauchansatz spannt. »Ganz allein?«
Derya tut so, als hätte sie ihn nicht gehört, legt das Geld abgezählt hin und geht.
Der Pappbecher ist warm in ihren Händen, erlaubt ihr aber nun nicht mehr, die Fäuste in die Manteltaschen zu stecken. Der Kaffee hilft nicht gegen das Frösteln und nicht gegen die Erschöpfung, die sich fremd und falsch anfühlt wie eine Falte in der Einlegesohle eines Lieblingsschuhs. Was ist los mit ihr? Sie geht nach der Arbeit immer zu Fuß heim, normalerweise genießt sie die Ruhe der späten Stunden. Irgendetwas ist heute anders. Nein, wenn sie ehrlich ist, war es gestern schon anders. Denn da hat sie zufällig Robert gesehen, ihren Exmann. Er saß in einem vorbeifahrenden Bus – was vermutlich bedeutet, dass er wieder zu viel getrunken hat. Vielleicht haben sie ihm endlich den Führerschein weggenommen. Robert lässt das Auto nie freiwillig stehen. Er hatte sie gar nicht bemerkt – zum Glück! Trotzdem konnte sie danach nicht mehr in aller Ruhe nach Hause spazieren, sondern musste eilen.
Im Stillen flucht sie nun auf ihn und die Tatsache, dass sie sich so leicht wieder von ihm verunsichern lässt. Sie geht langsamer, atmet bewusster. Wenn man Ängste überwinden will, muss man sich ihnen stellen, wiederholt sie die Worte ihrer Therapeutin. Sie ist keinesfalls gewillt, sich ihre Abendspaziergänge kaputt machen zu lassen – von keinem Mann der Welt und von diesem schon dreimal nicht.
Als sie hinter sich ein Geräusch hört, zuckt Derya zusammen. Sie sieht über die Schulter. Auf der anderen Straßenseite lässt eine alte Frau einen zottigen Mischling in den Grünstreifen kacken. Als der Hund fertig ist, zieht die Alte ihn in den nächsten Hauseingang. Harmlos. Derya richten sich dennoch die Nackenhaare auf. Sie ist vollkommen allein zwischen geschlossenen Türen und herabgelassenen Jalousien. Die Häuser scheinen ihre Augen geschlossen zu haben.
Und dennoch hat sie das Gefühl, jemand würde sie beobachten.
Sie geht schneller. Die Kälte kriecht ihr durch den Kragen und in die Ärmelsäume. Der Kaffee ist in seinem Becher erkaltet, bevor Derya ihn halb ausgetrunken hat, ihre Finger zittern. Sie wirft den Becher im Vorbeigehen in einen Mülleimer und zieht die Hände in die schützenden Ärmel, kaum dass sie sie frei hat. Bibbernd schlingt sie die Arme um sich selbst. Wann ist es plötzlich so kalt geworden? Ihre Füße sind so eisig, dass sie ihre Zehen nicht mehr spürt. Der Weg ist noch weit und Derya flucht innerlich auf alle Taxen der Stadt, die nie vorbeikommen, wenn man eins nötig hat.
Erneut sieht sie sich um. Niemand zu sehen. Sie muss lachen, leise und trotzdem hysterisch. Denn so wenig sie es sich eingestehen will – sie hat Angst. Sie ist gern allein, sie ist am liebsten allein, sie fühlt sich nur allein wirklich wohl in ihrer Haut.
Warum jetzt nicht?, denkt sie, und dann flüstert sie es in die Stille, zum Takt ihrer Absätze. »Wa-rum jetzt nicht – wa-rum jetzt nicht?« Ihr schneller Atem kratzt in ihrer Kehle. Wieder ein Blick über die Schulter. Da ist niemand, verdammt! Wovor hat sie Angst – vor nichts und niemandem? In ihrem Inneren kämpft sie um ihre letzte Bastion. Wenn sie diese Furcht nicht überwinden kann, hat sie nichts mehr: keine Erholungspausen in Einsamkeit mehr, kein bisschen Ruhe zwischen dem stetigen Geschnatter der Leute. Sie ist fast so wütend, wie sie ängstlich ist.
Und dann taucht die Gestalt auf.
Derya muss sich nicht mehr umsehen. Sie weiß, dass jemand hinter ihr ist. Ein Mann; sie spürt das. Er scheint sich lautlos zu bewegen, sie hört ihn nicht, weiß aber, dass er so nah ist, dass sie ihn eigentlich hören müsste. Schlägt ihr Herz zu laut? Das Blut rauscht ihr in den Ohren. Sie weiß nicht, wo der Mann hergekommen ist. Vielleicht aus einer Hofeinfahrt oder einer Haustür. Wahrscheinlicher ist, dass er ihr schon länger folgt und sich bisher nicht zeigen wollte. Hat er sie gezielt ausgesucht? Ein wehrloses Opfer, zierlich und untrainiert, das allein lebt und so schnell von niemandem vermisst werden wird? Sie hat nichts bei sich, was einen Raubüberfall rechtfertigen würde, aber sie ahnt, dass es dem Mann auch nicht um Geld oder ein teures Handy geht. Sie möchte es trotzdem gern rufen: Ich hab kein Geld! Ich trage vielleicht einen teuren Mantel, aber der ist alt. Ich bin bloß eine Kellnerin und Kassiererin. Ich habe nicht mal ein Handy.
Derya geht schneller, hastet nun fast. Der Mann bleibt im gleichen Abstand hinter ihr. Sie will losrennen und tut es nur deshalb nicht, weil sie weiß, dass ihr Verfolger dann ebenfalls laufen wird. Leider ist sie eine erbärmliche Sprinterin, und beim Joggen geht ihr schon nach einem halben Kilometer die Puste aus. Ihre Blicke jagen von Tür zu Tür. Ob sie irgendwo klingeln und um Hilfe bitten kann? Ein Auto kommt ihr entgegen. Sie will auf die Straße rennen und es anhalten, aber sie kann sich nicht schnell genug überwinden, und schon fährt es vorbei. Als Derya ihm nachblickt, sieht sie im Schein der Rücklichter den Mann als massiven dunklen Schemen ohne Gesicht.
An der nächsten Kreuzung zögert sie. Wenn sie rechts abbiegt, muss sie am Friedhof vorbei, hat aber nach einem knappen Kilometer die Hauptstraße erreicht, wo sich Bars und Spielkasinos zwischen die Wohnhäuser pressen. Wo Türen die ganze Nacht lang offen stehen. Wo ein Überfall nicht unbemerkt bleibt.
Sie überlegt nicht länger, eilt um die Ecke und rennt ein paar Schritte, um den Abstand zu vergrößern, ehe sie wieder geht und sich umsieht. Vielleicht irrt sie sich ja. Vielleicht ist das ein harmloser Kerl, der nach Hause zu Frau und Kindern will und sich nur beeilt, weil es so kalt geworden ist. Vielleicht macht sie sich vollkommen lächerlich.
Ja, denkt sie. Bestimmt geht er einfach geradeaus weiter.
Der Mann biegt hinter ihr in die Straße ein. Er ist näher als zuvor, viel, viel näher.
Das Rauschen in Deryas Ohren wird zu einem Pfeifen. Sie ist jetzt schon außer Atem. Eng an der Friedhofsmauer hastet sie weiter, als könne sie sich in ihrem Schatten verstecken. Sie eilt von Straßenlaterne zu Straßenlaterne, im Zentrum des Lichts atmet sie jedes Mal kurz durch, als wäre das Licht ihr ein Schutz, um dann mit angehaltener Luft weiter zur nächsten zu laufen. Auf der anderen Straßenseite gibt es keine Laternen. Nur Bäume und Büsche, die den Gehweg begrenzen. Dahinter liegt der Stadtpark. Robert hat sie immer vor den Pennern gewarnt, die sich nachts in kleinen Gruppen im Park herumtreiben. Jetzt bettelt Derya in Gedanken darum, ein paar Obdachlose zu sehen. Doch da ist niemand. Sie scheint allein auf der Welt mit dem dunkel gekleideten Mann in ihrem Rücken. Er kommt noch näher.
Die nächsten beiden Straßenlaternen funktionieren nicht. Vom Friedhof hallt der Schrei eines kleinen Tieres wider. Vor ihr, noch unerträglich weit weg, erkennt Derya die blinkenden Lichter der Autos, die über die Hauptstraße fahren. Sie will sich Mut machen – Sieh doch, Derya, du hast es fast geschafft –, aber auch ihr Verfolger scheint die Lichter wahrgenommen zu haben. Er weiß, dass sie in Sicherheit ist, wenn es ihr gelingt, die Straße zu erreichen. Das will er verhindern. Er holt auf.
Der Mann beginnt im gleichen Moment zu rennen wie Derya. Und er ist schneller als sie. Der Wind fängt sich in ihrem Mantel, die glatten Sohlen ihrer Schuhe finden auf dem feuchten Boden kaum Halt, und der Atem brennt in ihren Lungen. Dennoch rennt sie, so schnell sie ihre Füße tragen, durchs Dunkel. Sie kann ihren Verfolger hinter sich keuchen hören. Die Friedhofsmauer neben ihr wird niedriger und niedriger, längst kann sie die Grabsteine als helle Schatten ausmachen. Wie Geister stehen sie da. Gaffend und grinsend, weil sie ahnen, dass sie bald Platz für einen weiteren in ihrer Mitte machen dürfen. Derya sieht die fernen Lichter der Straße nur noch durch einen Tränenschleier; es sind brennende Tränen, voller Angst und Wut.
»Ich hab nichts!«, brüllt sie. »Lassen Sie mich in Ruhe! Ich hab kein Geld.« Als ginge es dem Dreckskerl um Geld.
In meiner Tasche ist Pfefferspray!, will sie rufen, aber ihr geht die Luft aus, und dass er sich von einer billigen Lüge dazu bringen lässt, sie in Ruhe zu lassen, glaubt sie ohnehin nicht.
Plötzlich sieht sie vor sich in einer Mauernische am Boden eine zuckende Bewegung, etwas kommt aus der Mauer, doch ehe sie ausweichen kann, hat sich ihr Fuß verhakt. Sie stürzt, knallt mit der Stirn voran gegen die Mauer und sieht Sterne. Eilig versucht sie, sich aufzurappeln, aber immer noch scheint sie mit etwas verkeilt. Etwas Warmem, Beweglichem, das zappelt und strampelt. Zuerst denkt sie an Arme, die aus der Mauer oder aus dem Boden gekommen sind. Ihr eigener Schrei klingelt ihr in den Ohren. Während sie schreit, bemerkt sie allerdings, dass sie über einen am Boden kauernden Menschen gefallen ist. Einen kleinen Menschen, vielleicht ein Kind? Es knurrt eine wüste Beschimpfung und rutscht ein wenig von ihr weg, sodass Derya aufstehen kann. Nervös blickt sie die Straße entlang. Ihr Verfolger – er muss sie fast eingeholt haben, er muss …
Er ist fort. Auf der anderen Straßenseite raschelt es im Gebüsch, dann wird alles still. Er ist wirklich fort.
»Scheiße. Spinnst wohl.« Das, was Derya im ersten Moment für ein Kind gehalten hat, stellt sich als winzige junge Frau mit heiserer Stimme heraus, deren Blick so wild und wütend ist, als wolle sie Derya die Augen auskratzen. Derya will sie am liebsten umarmen.
»Danke«, flüstert sie.
Die kleine Frau schubst sie grob zurück, sie ist verdammt stark für ihre Körpergröße, und Derya kann sich nur mit Mühe auf den Füßen halten. »Verpiss dich!«, faucht sie, rafft etwas um sich zusammen, was vor geraumer Zeit ein Schlafsack gewesen sein muss, und kriecht rückwärts wieder in die kleine Mauernische, wo sie sitzen bleibt. »Was glotzt ’n so, he? Gaffen macht fünf Euro.«
In Deryas Kopf wirbelt alles durcheinander. Der Schock lässt nach, und in einem Strudel kommen Gedankenfetzen nach oben, wo sie sich kurz zeigen, ehe sie wieder im Chaos verschwinden: Sie wäre beinah überfallen worden. Die kleine Frau kam aus der Mauer. Ihr Kopf tut weh. Was wollte der Mann? Schläft die etwa hier? Ins Krankenhaus? Vergewaltigen? Helfen?
»Sie … Sie können nicht einfach hierbleiben«, stammelt Derya. Ihr Knie pocht, sie muss es sich beim Sturz angeschlagen haben. Ob die kleine Frau auch verletzt ist?
»Kann ich nicht?«, gibt die zurück. Ihr scharfer Ton macht klar, dass sie sehr wohl kann. »Wo ich bleibe, geht dich einen Scheißdreck an.«
»Aber der Mann!«
»Welcher Mann?«
»Mir ist ein Mann gefolgt. Nur deshalb bin ich gerannt. Kommen Sie, lassen Sie uns von hier verschwinden. Bitte.«
Die kleine Frau zieht ihre Beine an den Körper wie einen Schutzwall. »Du hast den Schuss nicht gehört, Lady.«
»Wenn er zurückkommt …«
»Dann grüß ich ihn vor dir und frag ihn nach einem Bier. Jetzt mach dich hier weg.«
Diese dumme kleine Frau. Derya schielt die Straße zurück und dann wieder in die Büsche gegenüber, wo finsterschwarze Schatten mit nachtdunklen spielen. Was, wenn der Mann gar nicht verschwunden ist? Er könnte auch durch den Park gelaufen sein, um ihr den Weg abzuschneiden. Vielleicht hockt er dort, irgendwo im Unterholz, und beobachtet sie noch immer.
Sie richtet sich auf, drückt die Schultern durch. »Ich werde jetzt gehen. Bitte kommen Sie mit, hier ist es nicht sicher.«
»Hier ist es immer sicher«, kommt es verschlafen aus der Mauernische. »Für mich. Immer. Jede verdammte Nacht. Hau ab, Lady.«
Weiterzugehen kostet Derya enorme Kraft, aber sie tut es. Schritt für Schritt, trotz Kopfschmerzen, trotz geprelltem Knie, trotz Schwindel. Schlimmer noch ist die Angst. Jedes Blatt, das sich im Wind regt, jagt ihr erneut den Schweiß aus den Poren. Was, wenn der Mann zurückkommt? Was, wenn er sich die kleine Frau holt, die in ihrer Mauernische hockt und zum Schutz nicht mehr als einen zerrissenen Schlafsack besitzt?
Ich habe es versucht, will sie ihre Schuldgefühle beschwichtigen. Mit Gewalt wegschleifen kann ich sie ja kaum. Und vielleicht ist sie auch gar nicht so hilflos, wie sie aussieht. Sie könnte eine Waffe in ihrem Fetzenschlafsack versteckt haben.
Im Licht der Hauptstraße, zwischen vorbeifahrenden Autos und Bussen, blinkender Neonleuchtreklame und den ersten vorweihnachtlich dekorierten Schaufenstern fällt eine tonnenschwere Last von Derya ab. Niemand scheint ihr zu folgen. Trotzdem – und weil sie wegen ihres anschwellenden Knies inzwischen nur noch humpeln kann – winkt sie sich ein Taxi heran.
»Guten Abend – harten Arbeitstag gehabt – kenn ich auch – über etwas gestolpert und hingefallen – ach herrje, manchmal kommt es knüppeldick – manche Tage kann man wirklich aus dem Kalender streichen – kalt geworden, nicht? – ja, sehr, so richtig ungemütlich – schönen Abend noch.«
Und obwohl wirklich niemand ihr gefolgt ist und sie ihre Wohnungstür und alle Fenster abgeschlossen und die Jalousien hinuntergelassen hat, liegt Derya bis zum Morgengrauen wach. Und friert und grübelt.
»Sie haben das heute sehr gut gemacht«, sagte er und lächelte warm. Seine Patientin verzog die Lippen. Auch sie versuchte zu lächeln, aber er wusste, wie schwer das in ihrer Situation war. »Ist schon gut. Sie müssen jetzt nicht so tun, als wäre alles in Ordnung.« Wie freigelassen rannen ihr ein paar zurückgehaltene Tränen über das verquollene Gesicht. Wie perfekt sie ausgesehen hatte, als sie hergekommen war. Das Haar seidig glänzend und von einer Spange gehalten, die kleinen Unebenheiten der Gesichtshaut unter Make-up verborgen, die Lippen geschminkt in einem unaufdringlichen Pfirsichton. Sie war ein Genie darin, sich selbst in ein Kunstwerk zu verwandeln – makellos und unantastbar.
Jetzt war die Patientin zerzaust, die Schminke verschmiert, und der Lippenstift sammelte sich in den kleinen Fältchen ihrer Lippen. Sie war atemberaubend schön und voller Macht – wie der Moment, in dem der frühe Morgen die Nacht verdrängt. So hatte er sie sehen wollen, um seine Entscheidung zu untermauern. Es gab jetzt keinen Zweifel mehr. Die Haarspange lag noch auf dem Tisch; er hoffte, dass sie sie dort vergessen würde. Er liebte diese kleinen, unverfänglichen Andenken.
»Heute haben Sie einen sehr großen Schritt nach vorn gemacht. Sie können stolz auf sich sein.«
Sie nahm sich ein Papiertaschentuch aus der geblümten Pappschachtel auf dem Tisch und tupfte ihre Augen ab. »Es fühlt sich nicht so an, als gäbe es einen Grund dafür, stolz zu sein.«
»Weil Sie weinen? Das ist in Ordnung. Dieser Raum ist ein geschützter Ort, in dem man Schwäche zulassen muss, um ans Ziel zu gelangen. Zu weinen war eine große Überwindung, nicht wahr?«
Sie schluchzte auf und nickte.
»Na sehen Sie. Und Sie haben es geschafft.« Er stand aus seinem Korbsessel auf. »Ich lasse Sie jetzt allein. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Sie können sich gern noch im Bad frischmachen; Sie wissen ja, wo es ist. Bleibt es bei unserem nächsten Termin am Freitag?«
»Ja, vielen Dank«, sagte sie. Er blieb stehen, weil er spürte, dass eine Frage im Raum schwebte, die sie noch nicht gestellt hatte. »Wissen Sie … ich komme nun schon seit einigen Wochen zu Ihnen.«
»Und Sie haben hervorragende Fortschritte gemacht.«
»Ja, das bezweifle ich gar nicht. Es wundert mich bloß, dass wir … dass wir …«
Er setzte sich noch einmal hin und nickte ihr aufmunternd zu.
»Ich bin ursprünglich wegen meines Manns zu Ihnen gekommen«, sagte sie leise, »aber wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen.«
»Das ist schon in Ordnung.« Er lächelte wieder. »Alles zu seiner Zeit. Sie sind keineswegs nur wegen Ihres Manns hergekommen. Sie sind in erster Linie für sich hier.«
Außerdem, mein Herz, weiß ich ohnehin schon alles über deinen Mann, was ich wissen muss.
Kapitel 04
»Derya, wie siehst du denn aus? Was ist passiert?« Simone, Deryas Kollegin im Café, sieht sie betroffen an. Derya kann es ihr nicht verdenken. Sie hat versucht, die Schrammen, den Bluterguss in ihrem Gesicht, die Augenringe und die vom Schlafmangel geröteten Lider mit Schminke zu überdecken, aber das hatte es nur schlimmer gemacht. Also hat sie letzten Endes alles wieder abgewaschen. Sie sieht aus, als hätte sie die Nacht durchgeheult. Wie ein Opfer häuslicher Gewalt.
»Ich bin auf dem Heimweg gestürzt«, sagt sie. Es klingt lahm, und sie ärgert sich über sich selbst. Simone ist zwar verheiratet, aber außer ihrem Ehemann und Toni scheint sie jeden Mann auf der Welt für einen potenziellen Gewaltverbrecher zu halten, daraus macht sie selten einen Hehl. Wie zu erwarten, hebt sie kritisch die gepiercte Augenbraue und mustert Derya, als hätte sie übersinnliche Fähigkeiten.
Vermutlich hält sie sich für Lügendetektor-Woman und trägt heimlich ein Cape mit einem rot durchgestrichenen L.
»Was immer du denkst«, murmelt Derya, »es stimmt nicht. Ich hab nicht mal einen Freund.«
Simone zuckt ertappt mit den Schultern, meint: »Deine Sache, Derya, das interessiert mich doch nicht«, und wendet sich ab.
Verdammt. Das war überflüssig. Immerhin hat Simone nichts gesagt, auch wenn ihr Gesicht wie ein offenes Buch zu lesen war. Derya hasst ihre Dünnhäutigkeit, die sie oft reflexartig patzig werden lässt. Es muss am Schlafmangel liegen. Sie will sich bei Simone entschuldigen, doch da betritt eine Gruppe schwatzender Schülerinnen das Café, und Derya greift nach ihrer Schürze, bindet sie um und geht die Bestellungen aufnehmen.
Erst als am späten Nachmittag etwas Ruhe einkehrt, ergibt sich beim Polieren der Gläser die Gelegenheit, noch einmal mit Simone zu sprechen.
»Das vorhin«, sagt Derya, »war nicht so gemeint.«
Simone sieht sie nicht einmal an.
»Es tut mir leid, wirklich. Ich habe überreagiert.«
»Weißt du, Derya, seitdem du hier bist, versuchen wir, dich ins Team zu integrieren.« Simone legt das Geschirrtuch beiseite. »Wann immer wir als Kollegen etwas gemeinsam unternehmen, laden wir dich dazu ein. Doch du kommst nie mit.«
»Ich habe einen zweiten Job.«
»Ja, und wir anderen haben Kinder, Partnerinnen, einen Hund, pflegebedürftige Omas und noch einen Haufen mehr Verpflichtungen. Trotzdem schaffen wir es. Wir haben dir mehrmals angeboten, uns mit einem Termin nach dir zu richten. Aber du bleibst nicht mal eine Viertelstunde länger, um etwas mit uns zu trinken. Und sobald man etwas zu dir sagt, was über das Wetter hinausgeht, blockst du ab.« Simone sieht Derya an, sie wirkt ernsthaft bekümmert. Ihre großen mitfühlenden Augen lassen sie traurig aussehen, als würde es ihr wirklich etwas ausmachen. Derya möchte sich abwenden. Sie spürt, wie in ihrem Inneren eine Mauer hochfährt und in den Schießscharten bereits Worte zur Abwehr bereit gemacht werden. Gleichzeitig tut es ihr leid, dass Simone ihretwegen unglücklich ist. Ein bisschen zumindest, denn Simone ist ja nicht wirklich unglücklich. Doch nicht wegen ihr. Alles nur Fassade.
»Du bist jetzt ein knappes Jahr bei uns, Derya, aber ich weiß bis heute nicht mehr von dir als das, was ich sehen kann. Dass du einen guten Stil hast, Wert auf schöne Schuhe legst – aber das ist alles nur oberflächlich. Ich habe das Gefühl, dass du dich wie das fünfte Rad am Wagen fühlst, und ich würde das gerne ändern, aber ich weiß einfach nicht wie.«
Derya poliert das Glas weiter, obwohl es längst makellos glänzt. »Ich bin eben etwas zurückhaltend.« Ist das schlimm?!
»Aber du bist doch nicht glücklich damit«, erwidert Simone. Eine Feststellung, keine Frage. In Deryas Kopf entsichert der Trotz die Waffen und will etwas Scharfes zurückschießen. Sie beherrscht sich mühevoll und weiß selbst nicht, warum. Weil Simone es nur gut meint? Weil sie möglicherweise recht haben könnte?
Schließlich überwindet sie sich zu einem Lächeln, das ihr wehtut. »Man kann halt nicht aus seiner Haut.«
»Du könntest es aber mal versuchen und dich ein bisschen öffnen.«
»Nun gut«, sagt Derya und beschließt im gleichen Moment zu kündigen. »Was möchtest du denn von mir wissen?«
»Fangen wir doch damit an, dass du mir erzählst, wo du deine wundervolle Handtasche gekauft hast.«
Die Handtasche war ein Geschenk. Robert hat sie ihr damals aus Paris mitgebracht, und jetzt, da Simone die Tasche erwähnt, fällt Derya auf, wie unpassend es ist, sie weiterhin zu benutzen. Sie hat nie darüber nachgedacht. »Gefällt sie dir wirklich? Möchtest du sie haben? Ich schenke sie dir.«
Eine kleine Falte bildet sich zwischen Simones Augenbrauen. »Eigentlich … ich wollte nur etwas Smalltalk mit dir machen.«
Derya nickt. Natürlich. Sie poliert immer noch das Glas und traut sich nicht, es wegzustellen, weil ihre Hände plötzlich zittern. Simone gefällt nichts an der Tasche, sie findet sie vermutlich hässlich. Es geht ihr bloß darum, belangloses Zeug zu reden. Einmal mehr hat Derya sich vollkommen lächerlich gemacht und bewiesen, wie unfähig sie beim Kommunizieren ist, wie überfordert von Alltäglichkeiten. Sie muss wirklich kündigen.
Mit diesem Entschluss geht es ihr besser. Simone kann von ihr denken, was sie will, bald muss sie ihr nicht mehr gegenüberstehen, nie mehr.
»Entschuldige.« Wieder ein falsches Lächeln. »Mein Exmann hat mir die Tasche gekauft. Er hat sie aus Frankreich, glaube ich. Ich würde ihn fragen, aber wir sind seit Kurzem geschieden, und der Kontakt ist … schwierig.«
»Oh. Wie ungeschickt von mir, das tut mir leid.«
Bewundernswert, findet Derya, wie leicht Simone aus dem Fettnäpfchen tritt. »Muss es nicht.«
Simone wirkt einen Augenblick irritiert. »Ach, da fällt mir gerade wieder ein, dass heute Vormittag ein Mann hier war und nach dir gefragt hat. Er kam etwa eine halbe Stunde vor dir. Das wollte ich dir vorhin schon sagen, aber dann habe ich es vergessen. Sorry.«
»Ein Mann?« Derya wird kalt. »Was für ein Mann? Wie sah er aus?« Der Verfolger, schießt es ihr durch den Kopf. Sie blickt die großen Fensterfronten entlang und ist fast sicher, irgendwo eine Silhouette entdecken zu müssen. Nichts.
Simone legt den Kopf schief. »Er sah nett aus. Richtig gut.«
Okay, denkt Derya. Also schlank und groß. Das könnte ihr Verfolger gewesen sein. »Was genau hat er gesagt?«
Deryas Erregung scheint Simone zu verunsichern. »Er hat bloß gefragt, ob du da bist.«
»Mit meinem Namen? Er wusste, wie ich heiße?«
»Ja. Er wusste deinen Vor- und Nachnamen. Er kam rein, sagte ganz höflich: Guten Tag, können Sie mir bitte verraten, ob eine Derya Witt hier arbeitet? Und ich sagte: Das tut sie, aber sie kommt erst in einer halben Stunde.«
Derya beißt sich auf die Lippe. Wer mag das gewesen sein? »Aber er hat nicht gefragt, wann ich Schluss habe, oder? Und du hast ihn heute auch nicht mehr gesehen?«
»Beides nicht, nein. Aber warum regt dich das so auf? Du bist ganz blass. Denkst du, das war dein Ex?«
Diese Vorstellung ist auch nicht angenehmer, als dass der Verfolger ihren Namen herausgefunden haben könnte. »Ich weiß nicht. Möglich.« Erneut huscht ihr Blick die Fenster entlang. Noch ist es nicht dunkel, nur dämmrig. Doch bis ihre Schicht heute zu Ende ist, wird es finster draußen sein, und sie muss den Weg nach Hause gehen, ohne zu wissen, ob er in einer der Ecken verborgen steht und sie beobachtet. »Simone, hör mal. Es ist ja nicht mehr so viel los. Meinst du, ich kann dich alleine lassen und schon mal gehen? Es ist nur eine Stunde, ich habe einige Überstunden aufgeschrieben.«
Simone lehnt sich gegen einen der Hocker hinter dem Tresen und verschränkt die Arme. »Da hat nur einer nach dir gefragt. Kein Grund, gleich wegzurennen.«
Doch, vermutlich schon. »Nein, natürlich nicht. Aber wenn es mein Ex war, muss ich das klären.« Sie senkt verschwörerisch die Stimme. »Er hat Auflagen vom Gericht, weißt du?« Das ist gelogen, aber es funktioniert, denn es ist exakt das, was Simone hören möchte.
Simone nickt heftig. »Oh, ich verstehe. So ein Arsch! Ja, natürlich, dann mach Schluss für heute. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst.«
Derya muss nicht überlegen, ob sie das Geld übrig hat oder nicht, sie bestellt sich ein Taxi. Kaum zu Hause angekommen, ruft sie bei REWE an und meldet sich krank. Im Café kann sie morgen Bescheid sagen, aber sie sucht sich schon einmal die Telefonnummer heraus. Dabei stößt sie in ihrem Taschenkalender auf die Daten von Hanna Seidel, ihrer Therapeutin. Während der Trennung ist sie regelmäßig bei ihr gewesen, aber nun, da sie allein wohnt, schon eine ganze Weile nicht mehr. Vielleicht sollte sie mit ihr über den Verfolger reden? Über die Situation mit den Kollegen im Toni’s? Und … über Jakob.
Bevor sie noch lange überlegen kann, wählt sie die Nummer. Sie überlegt, wieder aufzulegen, aber Hanna geht schon beim ersten Freizeichen ran. In knappen Sätzen schildert Derya, was vorgefallen ist. Ihre eigenen Worte beunruhigen sie, bringen ihre Hände zum Zittern, bis sie sie damit beschäftigt, die Kommode abzustauben, obgleich da kein Korn Staub liegt.
»Natürlich können wir uns treffen«, sagt Hanna Seidel mit ihrer Stimme, die immer so ruhig und besonnen klingt, dass Derya an eine weißhaarige Oma mit Strickzeug im Schoß denken muss, obwohl Hanna nicht einmal vierzig ist, feuerrotes Haar hat und mit ihren bunten Kleidern an eine erwachsene Pipi Langstrumpf erinnert. »Sie rufen genau im richtigen Moment an. Eben hat eine Klientin abgesagt, daher habe ich morgen Nachmittag Zeit für Sie. Treffen wir uns im Park, wie immer?«
Derya muss schmunzeln. Selbst im Winter bleibt Hanna also ihrer unkonventionellen Gewohnheit treu und hält ihre Gespräche im Freien ab. »Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie es so schnell einrichten können.«
»Für Sie immer gerne, Derya.« Eine Pause klingt nach, Derya ist sicher, dass Hanna nun überlegt, ob sie nach einem neuen Roman fragen soll. Sie hat immer gefragt, immer. Von Spiegeltropfen war Hanna völlig begeistert, weshalb sie ungeduldig auf Deryas zweites Buch wartete. Als es dann kam, fand sie es nett. Nett. Seitdem fragt Hanna nach einem weiteren Buch, immer. Aber Derya hat sie bisher enttäuschen müssen.
»Bis morgen«, sagt Hanna, und Derya wartet, bis sie auflegt. Dann sagt sie leise: »Es tut mir sehr leid«.
Denn Derya ist langsam so weit, sich einzugestehen, dass es kein neues Buch geben wird. Niemals.
Der Nachmittag ist frisch und windig, aber sonnig. Derya hat sich einen neuen warmen Mantel, einen großen Schal, zwei Paar Handschuhe und mehrere Mützen gekauft und trifft gerade noch rechtzeitig im Park ein. Sie fühlt sich beobachtet. Weniger von dem Mann, von dem sie inzwischen annimmt, dass er nicht gezielt ihr gefolgt, sondern nur zufällig der erstbesten Frau nachgelaufen ist. Sie hat bloß Pech gehabt. Doch offiziell liegt sie krank im Bett – da sollte sie sich besser nicht von Kollegen beim Shoppen oder im Park erwischen lassen.
Sie trifft Hanna wie damals an einer Bank am Teich, wo diese Kinder dabei beobachtet, wie sie die Enten und Schwäne füttern.
»Eigenartig«, sagt Hanna wie in Gedanken. »Setzen Sie sich doch.« Sie wartet, bis Derya ihre Tüten abgestellt und sich neben ihr auf der Bank niedergelassen hat. »Finden Sie nicht auch? Wir sind erwachsene Frauen und bezeichnen uns als Tierschützerinnen, nicht wahr? Waren Sie nicht auch Vegetarierin?«
»Richtig«, sagt Derya. Erstaunlich, dass Hanna sich noch daran erinnert.
»Ich lebe inzwischen vegan«, sagt Hanna. Sie trägt immer noch einen in Gold eingefassten Stern aus Glas an einem Band um den Hals, genau wie früher. »Und ich weiß, dass es für die Tiere und das Ökosystem im Teich eine ziemliche Katastrophe ist, wenn die Enten mit Brotresten gefüttert werden. Trotzdem mag ich nicht zu den Kindern hingehen und es ihnen sagen. Ich will ihnen die Freude nicht ruinieren, verstehen Sie das? Dabei sind ein paar Augenblicke der Freude doch kein großer Preis für gesunde Enten, oder was denken Sie, Derya?«
Derya ist nicht sicher, ob sie wirklich über Enten, Kinder und Brot sprechen. Bei Hanna ist sie nie sicher, worüber sie eigentlich sprechen. Ein Zustand, den sie mag, weil er ihr immerzu Auswege lässt, endlose Möglichkeiten, durch ein »Es war anders gemeint«-Tor zu schlüpfen.
»Vielleicht nicht«, sagt sie. »Aber vielleicht wächst aus den paar Momenten der Freude ja etwas anderes heran. Es könnte sein, dass diese Kinder später zu Naturschützern werden, weil sie so schöne Erinnerungen an die Enten haben, denen sie das Brot hinwerfen.«
Hanna sieht an den Kindern und den Enten vorbei. Ein Schwan schwimmt mit großem Abstand zu den anderen Wasservögeln. Derya findet ihn fett, vermutlich ist er übersättigt und kann das verdammte Brot schon nicht mehr sehen.
»Kindheitserinnerungen«, murmelt Hanna. »Ein mächtiges Werkzeug, das viel bewirken kann. Sie haben recht, Derya.« Sie lächelt sie an. »Sie haben absolut recht. Sie sind Schriftstellerin. Ich will Ihnen keinen Druck machen, ich weiß, dass das Gift für Ihre Arbeit ist. Aber würden Sie mir eine Geschichte erzählen?«
Derya ist bei ihren Großeltern aufgewachsen.
»Deine Mutter wollte dich nicht, sie hat dich bei uns ausgesetzt wie ein Findelkind, und damit ist sie für dich gestorben«, waren die einzigen Worte, die Derya von ihrem Großvater über ihre Eltern erfuhr. Ihr Großvater war ein strenger Mann, der akribisch nach den Regeln und Gesetzen lebte, die er selbst schuf. In der Familie war er Legislative, Exekutive und Judikative zugleich, und sein größtes Problem bestand darin, dass sich die restliche Welt nicht seinen Gewalten unterwerfen wollte.
Sie hatte Respekt vor ihm, regelrechte Angst, konnte sich jedoch nicht daran erinnern, jemals mit etwas Schlimmerem bestraft worden zu sein als mit Fernsehverbot. Allerdings gab es ansonsten auch nichts, was man ihr hätte wegnehmen können. Die Schule – das hatte Derya früh herausgefunden – zählte zu den Dingen, die ihr Großvater nicht verbieten wollte oder konnte, und ansonsten hatte sie keine Freiheiten. Blieben nur noch die Schwarzwaldklinik, Gute Zeiten, schlechte Zeiten und das Glücksrad, das er ihr nehmen konnte, wenn sie Widerworte gab oder in den Augen der Großeltern zu tranig, verträumt oder schlampig war.
Derya lernte von frühster Kindheit an zu flüchten.
Sie flüchtete in ihre Geschichten, wo sie eine Prinzessin war, die von einem habgierigen Drachen festgehalten wurde. Ihre Klassenkameraden wurden nach und nach, stets ohne es zu ahnen, zu Helden, Faunen, Zwergen, Satyren, Nymphen, Hexen, Elfen und Gnomen, die sich allesamt auf die Reise machten, um die Prinzessin zu retten. Doch keinem gelang es, alle wurden sie bei dem Versuch erwischt, gefangen genommen und schließlich auf die unterschiedlichsten Arten zu Tode gefoltert, sodass der Drache ihre Überreste in mundgerechten Häppchen verschlingen konnte.
Eigentlich hatten sie das auch verdient, zupften sie Derya doch permanent an den Zöpfen und nannten sie Schneewittchen. Nicht auf die Art, wie es die Oma manchmal tat – weil Derya bleiche Haut und schwarzes Haar hatte und eben nun mal Witt mit Nachnamen hieß –, sondern abfällig; weil sie ständig zu träumen schien und ihre Umgebung dabei vergaß, als würde sie in einem gläsernen Sarg schlafen.
Nur einer tat nichts davon: der Junge mit den hellbraunen Haaren und den hellbraunen Augen. Sie fand schnell heraus, dass er Jakob hieß und in die Siebte ging, und diese beiden kleinen Informationen reichten ihr, um ihn zum Helden all ihrer Geschichten zu machen, die nun nichts mehr mit Prinzessinnen und Drachen zu tun hatten, sondern mit Gangstern und Entführungen. Coole Gefahren passten viel besser zu Jakob aus der Siebten als Glitzerkrönchen.
Als Derya elf war, starb der Großvater. Das veränderte vieles.


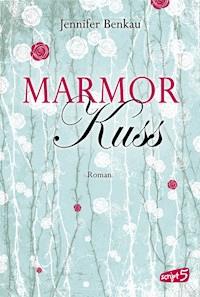














![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)










