
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sieben Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schattendämonen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
"Lieben werde ich dich immer. Aber kann ich dir das Leben lassen?" Dass der rachsüchtige Luzifer ihre Spur aufnehmen und sie finden würde, hatten Joana und Nicholas nie bezweifelt. Als es soweit ist, tritt Nicholas' minutiös durchdachter Plan in Kraft. Ein Plan, der Joanas Leben retten soll und den Nybbas auf direktem Weg in die dunkelste Hölle führt. Der Luzifer ist gerissen und dem Nybbas droht, sich in dessen Fängen zu verlieren. Joana ist nicht bereit, Nicholas aufzugeben. Doch Hilfe zu holen, würde bedeuten, einen Krieg zwischen den Dämonenfürsten heraufzubeschwören, die ihre Kämpfe mit Waffen wie Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen austragen. 2012 muss sich Joana entscheiden, ob die Rettung eines Dämons das mögliche Ende der Welt wert ist. Ohne zu wissen, ob ihr Dämon überhaupt noch gerettet werden will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
NybbasBlut
Schattendämonen 3
Jennifer Benkau
Schattendämonen 1: Nybbas Träume
Schattendämonen 2: Nybbas Nächte
© 2012 Sieben Verlag, Ober-Ramstadt
Umschlaggestaltung: Mark Freier, München
Korrektorat: Susanne Strecker, www.schreibstilratgeber.com
Druck und Bindung: AALEXX Buchproduktion, Großburgwedel
ISBN Buch: 978-3-864430-66-4
ISBN PDF: 978-3-864430-67-1
ISBN EPub: 978-3-864430-68-8
www.sieben-verlag.de
1
onnenstrahlen griffen wie lange Finger durch vom Smog getrübte Fenster, tasteten sich zwischen den vollgestopften Regalen quer durch den staubigen Raum. Sie strichen über das Gesicht des Mannes, spielten in seinen Bartstoppeln und ließen sie in der Farbe von frischem Blut und altem Gold leuchten.
Köstlich.
„Auf welchen Namen darf ich die Rechnung ausstellen, Madam?“
Sie musste einen Moment überlegen, ehe sie die Frage des Antiquitätenhändlers beantworten konnte. Namen waren eine Angelegenheit von Monaten, Jahren oder allenfalls Dekaden. Sie vergaß sie hin und wieder.
„Shima“, sagte sie dann und strahlte den Mann an. „Natasha Shima.“ Dieser Name war leicht zu merken, obwohl sie ihn erst seit Kurzem trug. Ihre Herrin – die sich aller edlen Traditionen zum Trotz ungern so ansprechen ließ – hatte ihn ihr gegeben. Sie sollte ihn besser verinnerlichen, schon um die Herrin zu ehren. Wie glücklich sie war, sie endlich gefunden zu haben. Sie hatten einander so lange gesucht.
Der Antiquitätenhändler interpretierte ihr Lächeln falsch. „Eine wirklich hervorragende Ware, die Sie da erworben haben. Sie haben Glück, so antike Stücke sind auf dem freien Markt nur schwer erhältlich. Die Museen erheben oft Anspruch auf solche Qualität.“
Sollte er nur reden. Sie wusste sehr genau, wie alt das bemalte Tongefäß war und wie man seinen Wert realistisch einzuschätzen hatte. Der Händler hätte ein äußerst lukratives Geschäft gemacht, wenn seine Kundin wirklich nichts weiter als eine menschliche Kunstliebhaberin gewesen wäre. Gefäße wie dieses gab es wie Sterne am Himmel, es war weder antik noch wirklich modern, sondern irgendetwas dazwischen. Bloß alt. Wertlos für jeden Menschen. Wie gut, dass sie kein Mensch war. Denn das, was diesen Topf für sie so wertvoll machte, war weder sein Alter noch sein Kunstwert, sondern allein der Verwendungszweck, dem er gedient hatte. In diesem Gefäß war vor nicht allzu langer Zeit ein Dämon eingesperrt gewesen. Sie hatte erst kürzlich gelernt, die minimalen Veränderungen zu erspüren, die im Material zurückblieben, aber bei diesem Stück gab es keinen Zweifel. Sie würde es kein zweites Mal berühren, die Energie prickelte so stark, dass sie bis tief in ihr Inneres schmerzhaft gezogen hatte. Vielleicht sprach dies von der Macht des Dämons, der darin gemartert worden war. Die Herrin würde es herausfinden. Sie sammelte solche Artefakte; Beweise der Grausamkeiten, denen ihr Volk seit Jahrhunderten ausgeliefert war.
„Packen Sie es gut ein“, wies sie den Händler an.
„Natürlich. Wir wollen ja nicht, dass dem guten Stück etwas passiert.“ Er gab sich ausgesucht charmant, das musste sie ihm lassen.
Sie wollte das Gefäß vor allem nicht mehr berühren müssen. Aufmerksam beobachte sie, wie die geschick-ten Männerhände es zunächst in Seidenpapier, dann in Polsterfolie und schließlich in braunes Packpapier wickelten. Die Adern auf seinen kaum behaarten Handrücken, Flüsse aus Leben auf einer von Jahren und reichlich Sonnenlicht bräunlich geprägten Karte, faszinierten sie. In ihrem Schoß kribbelten zarte Erwartung und ein Hauch von Bedauern. In früheren Zeiten hätte sie einen schönen Mann wie diesen sicher nicht sofort getötet, sondern eine Weile behalten. Die Herrin hatte allerdings nichts übrig für menschliche Mitbewohner. Ein zu vernachlässigender Nachteil – immerhin hatte sie Natashas Katzen gern und erfreute sich an deren Gesellschaft fast so sehr wie sie selbst. Der Antiquitätenhändler hob das verpackte Stück in eine Tragetasche aus stabiler Pappe, die mit dem Emblem seines Geschäfts von Hand bemalt war. Derartiges blieb für gewöhnlich bestimmt den besseren Kunden vorbehalten. Erahnte sie da ein schlechtes Gewissen, weil er glaubte, sie über den Tisch gezogen zu haben? Sie gab sich Mühe, nicht zu lachen, aber in ihren Augen funkelte sicher ein wenig ihrer Erheiterung. Sie nahm die Tasche an, stellte sie auf den Boden, wo ihr nichts passieren würde, und ging zur Tür, wo sie das „Geöffnet/Geschlossen“ Schild umdrehte, um mit ihm ungestört zu sein. Zur Sicherheit drehte sie auch den Schlüssel im Schloss herum. Als sie sich umwandte, sah sie Erstaunen im Gesicht des Mannes, doch schien er gewisse Erwartungen mit ihrem Verhalten zu verknüpfen, die ihn offenbar nicht beunruhigten. Er würde sich noch wundern.
„Was spielst du hier?“, fragte er, eine Braue über den blitzenden braunen Augen hochgezogen.
Sie antwortete nicht, sprang stattdessen geschmeidig auf die Theke und kickte den Block mit den Rechnungsvordrucken vom Tisch. Der oberste, mit ihrem Namen beschriftete Beleg, wehte wie ein Laubblatt durch den halben Laden. Der Blick des Mannes haftete kurz an ihrem rechten Stiletto und glitt dann an ihrer von schwarzen Nylons bestrumpften Wade nach oben zum Rocksaum. Sie hob das Bein an, setzte dem Mann den Fuß auf die Schulter. Sein Lächeln war von jener Mischung aus Unglauben und Freude, die ihr zeigte, dass sie bereits gewonnen hatte. Seine Hände umfassten ihren Oberschenkel. Sie waren rau und warm, ein angenehmes Gefühl durch den dünnen Strumpf.
„Es wird wie ein Überfall aussehen“, sagte sie.
„Was?“
Ihre Worte hätten ihn warnen sollen, ebenso die unmenschliche Leichtigkeit ihrer Bewegungen. Aber die Lust verschleierte seinen Blick; er war blind, der arme Mann, vollkommen blind. Sie nahm seine Hand in ihre, fuhr die Adern auf dem Handrücken nach und stellte sich vor, sie aufzureißen und das Blut sprudeln zu sehen. Wie gern sie den Moment hinauszögerte, das letzte bisschen Misstrauen arbeiten ließ. Sie liebte es, wenn Menschen sich nicht entscheiden konnten zwischen der instinktiven Furcht und dem Gefühl, den Glücksgriff ihres Lebens gemacht zu haben.
Sie hätte ihn länger am Leben gelassen, wenn er ein bisschen weniger plump vorgegangen wäre. Zu schnell tasteten sich seine Finger über den nackten Streifen Haut bis zu ihrem Höschen, und dass er es gleich beiseiteschob und tiefer glitt, besiegelte sein Schicksal. Sie zog ihren Fuß zurück, spannte die Wade an und trat den Absatz des Stilettos quer durch seine Kehle. Eine Sekunde lang geschah nichts, er runzelte bloß die Stirn. Dann quoll Blut hervor, vermischte sich mit den röchelnden Versuchen, zu atmen. Der Mann ging in die Knie, sie verlor den Schuh – er blieb in dem durchbohrten Hals stecken. Winzige Blutspritzer leuchteten auf ihrem Strumpf wie glänzend rote Sterne. Der Antiquitätenhändler starb langsam, aber er fand sich erstaunlich schnell mit dem Tod ab. Das war sehr freundlich von ihm. Kaum etwas war so lästig wie das erbärmliche und sinnlose Auflehnen gegen das Unvermeidliche. Das hatte dieser Mann nicht nötig. Ohne Gegenwehr blieb er hinter seiner Theke liegen und blutete den speckigen Teppich voll.
Sie sprang auf seine Brust, ließ sich dort nieder und widmete sich endlich diesen hübschen Adern auf seinem Handrücken, bevor sie verdorren würden, was doch wirklich eine Schande gewesen wäre.
2
er Streifen auf dem Teststäbchen war von einem äußerst blassen Rosa. Kaum zu erkennen. In Joanas Magen kribbelte es, die ersten Anzeichen einer beginnenden Übelkeit, die sie sich sicher nur einbildete. Eine Klischeeschwangerschaft mit Morgenübelkeit kam überhaupt nicht infrage. Ach verdammt, eigentlich kam überhaupt keine Schwangerschaft infrage! Ihr stieg ein kleiner Schwall bittere Galle in die Kehle. Das war nur der Schreck.
Schwanger.
Es konnte nicht wahr sein. Nein, nicht möglich.
Nicht, weil ihr Liebster kein Mensch war. Sie war inzwischen hinreichend mit der Welt der Dämonen vertraut, um auf Bauernweisheiten wie ‚paranormale Wesen zeugen keine Kinder‘ nichts zu geben. Gerade sie war prädestiniert für eine solche Verbindung, schließlich waren Menschen mit Fähigkeiten, wie sie sie besaß – Clerica – den Legenden nach aus einem schlechten Scherz der Dämonengöttin Lilith entstanden. Über unzählbare Ecken waren Dämonen und Dämonenjäger miteinander verwandt, es gab also keinen Grund, warum sie nicht in jeglicher Hinsicht miteinander harmonieren sollten. Sie musste kichern, doch das Lachen versoff in einem Schluchzen und sie begann zu weinen.
Langsam ließ sie sich auf den Rand der Badewanne sinken. Sie berührte ihren Bauch mit der Spitze ihres Zeigefingers. Behutsam, als tickte in ihrem Leib eine Bombe. Nichts geschah. Nichts deutete auf eine fremde Anwesenheit hin, nichts weckte den Anschein, als bestünde ein Problem außer der bekannten kleinen Schwäche fürWeingummi und portugiesisches Gebäck. Ein paar Tränen tropften auf den Stoff ihres Trägertops. Der Schwangerschaftstest in ihrer anderen Hand zitterte vor sich hin. Vielleicht irrte sie. Sah sie wirklich einen rosa Streifen oder erkannte sie nur die Kontaktfläche, die auf Schwangerschaftshormone im Urin rosa werden sollte? Sie hielt den Streifen ins Licht, drehte ihn leicht hin und her. Mit der freien Hand suchte sie Halt am Marmor, über dem eine Kalkschicht darauf aufmerksam machte, dass sie eine grausige Hausfrau war. Niemand, dem man ein Kind anvertrauen konnte. Das schlecht geputzte Bad war das geringste Problem. Sie war eine Frau, die die Flucht aufgegeben hatte, eine Frau, die einen Kampf erwartete; eine Frau, die ein Monster liebte und bis aufs Blut verteidigen würde. Dass sie ihre Periode schon beim letzten Mal nur ganz schwach bekommen hatte, dies aber mit ‚Kommt schon mal vor‘ abgetan hatte, sagte alles. In ihrem Leben war kein Platz für Verantwortung einem hilflosen und unschuldigen Wesen gegenüber. Sie nahm nicht einmal eine Katze zu sich, weil sie ihr kein sicheres Leben bieten konnte. Sie war doch keine Mutter!
Sie hatte getötet. Sie sprach diesen Gedanken aus, mit lauter Stimme in dieses cremefarbene, luxuriöse, aber ungeputzte Marmorbad mit Nischen in den Wänden, in denen Kerzen standen, die fast jeden Abend brannten, sodass Wachsnasen an den Kacheln bis auf den Boden reichten. „Ich habe getötet.“ Sie betrachtete die Weinflasche, die Nicholas und sie am Abend zuvor in der Badewanne geöffnet hatten, ohne sich um Gläser zu scheren oder um das anschließende Aufräumen. Sie dachte an die erste Flasche Wein, nachdem sie nach Portugal zurückgekommen waren.
Wir sollten uns nicht betrinken, Nicholas.
Sagt wer?
Ich. Sie können jederzeit kommen.
Ich kenne den Luzifer nicht, Jo, aber ich vermute, es kann nicht schaden, wenn wir ihn uns schön trinken. Entspann dich. Solche Angelegenheiten eilen selten. Wir haben Zeit.
Die Dämonen hatten Zeit, das war richtig, aber wenn Joana den Namen Luzifer richtig interpretierte, würde der Dämonenfürst es Nicholas nicht gönnen, ein Menschenleben lang – ihr Menschenleben –, sein Dasein in Frieden zu genießen, ehe er die Rache einforderte, die ihm angeblich zustand. Ganz davon abgesehen störte sie auch diese Vorstellung. Der Luzifer sollte Nicholas gefälligst auch nach ihrem Ableben in Ruhe lassen, war das denn zu viel verlangt, Herrgott nochmal?
„Shit, das ist doch alles absurd. Ich kann kein Kind bekommen.“
Nichts zu machen. Der Streifen machte sich nichts daraus, wer sie war, was sie getan hatte oder was sie glaubte, zu können. Er war und blieb rosa.
Joana hatte das Gefühl, den ganzen Tag im Bad vertrödelt zu haben; als ließe sich aufhalten, was in ihrem Körper geschah, wenn sie und der rosa Streifen bewegungslos verharrten. Doch als sie nach unten ging und ihr Blick die Uhr streifte, erkannte sie, dass nicht einmal zwanzig Minuten vergangen waren, seit sie sich mit voller Blase und dem Test aus der Drogerie eingesperrt hatte. Das Radio murmelte leise vor sich hin. Nicholas schaltete es nie aus, er drehte einfach den Ton leiser, wie er auch Lampen, die sich dimmen ließen, nie abschaltete, sondern auf ein schwaches Glimmen runterdrehte. Gerade erklang der Refrain zu Bob Marleys „Stir it up“, einem Gute-Laune-Song, der Joanas Überzeugung bekräftigte, dasses einen Gott geben musste: einen Gott mit Hang zu sarkastischen Gemeinheiten oder sehr großem Gerechtigkeitssinn. Sie hatte es vermutlich verdient.
Sie bewegte sich lautlos auf bloßen Füßen, schlich durch das Wohnzimmer in die Küche und fühlte sich trotz der beschwingenden Musik fehl am Platz und wie aus hundert Augenpaaren beobachtet. Wie jemand, der etwas Verbotenes tat. Verrat beging. Dabei war das lächerlich. Sie hatte Nicholas zwar nichts von ihrem Verdacht erzählt, aber nur, weil sie überzeugt gewesen war, sich zu irren. Sie wollte klarstellen, dass da nichts war, darüber schmunzeln und nie wieder daran denken. Den Test hatte sie nur deshalb vor ihm versteckt, weil sie sich seines zärtlichen Spotts gewiss war, zu dem sie ihm keine Gelegenheit bieten wollte. Und darum war sie auch heute nicht mit ihm zur Werkstatt gefahren, sondern hatte behauptet, länger schlafen zu wollen, sich am Vormittag um die Steuer zu kümmern und ihn zum Mittagessen in Loulé zu treffen. Am Tag zuvor hatte sie nicht glauben können, in dieser Nacht überhaupt einen Moment Ruhe zu finden, doch entgegen ihrennervösen Erwartungen hatte sie tief und fest geschlafen. Als sie erwacht war, hatte sie genau das erleichtert aufatmen lassen, was ihr an manchen anderen Morgen die Laune vermieste: Die Betthälfte neben ihr war leer. Nicholas war aufgebrochen, ohne sie zu wecken.
Auf der Tafel neben dem Tresen, der die Küche vom Wohnzimmer trennte, befand sich neben der Zeichnung einer Blaumerle, die sie am Tag zuvor im Garten beobachtet und grob stilisiert hatte, eine schwer zu entziffernde Nachricht in Nicholas’ Handschrift.
Hunger! 10:30 Uhr, zweites Frühstück im Vertigo?
Sie musste lächeln. Er wusste genau, dass sie dem Frühstück in diesem herrlichen kleinen Café, in dem es immerzu nach Sommer roch, nicht widerstehen konnte.
Aber was ist mit den Steuerunterlagen, du anarchistischer Dämon? Die ungeliebte Büroarbeit war leider nicht ausschließlich ein Vorwand gewesen. Während sie sich einen Kaffee aufbrühte und wegen derkalten Fliesen mit den Zehen wackelte, fiel ihr Blick auf ihr Mobiltelefon, das auf der Arbeitsplatte lag. Eine SMS war unbemerkt eingegangen. Sie wusste, was drin stand, ehe sie sie geöffnet hatte:
‚Ach, und Joana: Scheiß auf die Steuer.‘
Normalerweise hätte sie sich darüber amüsiert. So war er eben, ihr Liebster; er tat, was ihm gefiel.Irgendjemand würde schon alles andere erledigen. Damit irrte er selten. Doch mit einem Mal kam ihr brutal und ungewollt etwas in den Sinn, was sie in ihrem Schreck zunächst ganz vergessen hatte. Wenn sie schwanger war – was ihr langsam als Tatsache erschien und nicht mehr als absurde Idee – dann würde nicht nur sie Mutter werden. Nicholas würde Vater werden.
Der Kaffee roch bitter. Joana kippte ihn in den Ausguss, die Tasse entglitt ihren Händen und zerbrach im Spülbecken.
~*~
Der Mann kam zu spät. Nicholas hasste Unpünktlichkeit, wenn er es war, der warten musste. Er hatte schon mit dem Gedanken gespielt, Joana anzurufen und das Frühstück zu verschieben, da sah er durchs Fenster den Lieferwagen doch noch in den Hof einbiegen. Wurde auch langsam Zeit. Doch dann stutzte er. Ein Gemüsehändler? Der Kerl am Steuer wirkte nicht wie jemand, der mit Äpfeln und Orangen handelte. Nicholas füllte die letzten beiden Punkte im Kostenvoranschlag für einen seiner besten Kunden aus und versandte rasch die E-Mail, bevor er das Büro verließ, die Halle durchmaß und auf den Hof trat. Hochkonzentriert witterte er die Emotionen des Fahrers. Es war riskant gewesen, in die alte Oldtimerwerkstatt zurückzukehren, wo der Luzifer und seine Schergen sie vermutlich zuerst suchen würden, denn hier hatten sie vor dem Abenteuer in Island gelebt. Andererseits war genau das vielleicht der Grund, warum alles friedlich blieb. Wer ging schon davon aus, dass Joana und er sich dreist wieder dort niederlassen würden, wo man sie schon einmal aufgespürt hatte? Der Luzifer suchte vermutlich am anderen Ende der Welt und drehte dort jedes Steinchen um. Umso besser, dann war er eine Weile beschäftigt.
Der Fahrer war harmlos. Zwar waren ihm Emotionen wie Misstrauen und ein wenig Furcht anzuspüren, aber das lag in dem Inhalt der Apfelsinenkisten begründet, die er in seinem Wagen durch halb Portugal kutschierte. Nicholas begrüßte ihn mit Handschlag und der Mann im ölfleckigen Overall begann in hilflosem Englisch eine schlechte Schmierenkomödie und erzählte von einer Lieferung besonders schmackhafter, frischer Früchte, die nicht einmal Saison hatten. Nicholas hatte selten eine derart grottenschlechte Tarnung erlebt. Was zur Hölle sollte ein Gebrauchtwagenhändler, dersich auf deutsche Oldtimer spezialisiert hat, mit Obst?
„Lass gut sein, ich koste mal.“ Nicholas öffnete die hintere Klappe und sprang in den Sprinter. Er musste den Kopf einziehen. Im Inneren des Wagens roch es nach fauligen Äpfeln, offenbar hatte man den Plan gehabt, die Tarnung glaubwürdig aufzuziehen. An der Umsetzung haperte es gewaltig. Der Lieferant wies nach links und Nicholas klopfte ein paar Kisten ab. In der zweiten von unten klang es, als bestünde der Inhalt aus mehr als Bio-Abfall. Er zog die Kiste heraus und öffnete sie. Bingo, alles entsprach der Bestellung: Ein AKS-74 Sturmgewehr nebst 40-mm Granatwerfer, klein zerlegt in unscheinbare Einzelteile. Etliche kleine Kartons, randvoll mit Munition für die neuen sowie die alten Waffen. Nicht zu vergessen, zwei Taser – Stromschockgeräte von Stinger, denen ganz ähnlich, die die Polizei verwendete, aber weit wirkungsstärker als alles, was man auf legalem Weg beschaffen konnte. Waffen wie diese waren eines der wenigen Mittel, das im Kampf gegen Dämonen Sinn machte. Nach einem Schuss oder einer Stichverletzung war ein Dämon immer noch in der Lage, seinen menschlichen Körper fallenzulassen und im dämonischen Leib zu kämpfen. Ein starker Taser machte selbst einen mächtigen Dämon bewegungsunfähig, zwar nur kurzfristig, aber Sekunden reichten zum Überleben und auch zum Sterben.
„Zufrieden?“ Der Lieferant verschränkte die Arme. Ihm war nicht wohl in seiner Haut, Nicholas roch sein Unbehagen; wie Körpergeruch strömte es bei jeder Bewegung durch seine Kleidung.
„Frisch ist das nicht gerade. Du kommst fast eine Stunde zu spät.“ Er nahm die Kiste und sprang aus dem Wagen. Sofort kam Leben in den Lieferanten, er hob eine Obstbox hoch und wollte sie über die Waffenkiste stapeln, damit der Inhalt nicht zu sehen war. „Stell das darüber“, murmelte er. „Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Wurde aufgehalten.“
Nicholas wandte sich ab. „Lass den Blödsinn, hier ist niemand, dem du dein Theater vorspielen musst.“ Nur André Bergot, sein Mechaniker, war in der Werkstatt und machte einen Ölwechsel an einem sechzig Jahre alten Porsche. Der Mann wusste nicht, wer sein Boss wirklich war, aber er war sich der Tatsache bewusst, dass Nicholas und Joana in irgendeiner Hinsicht mächtigen Dreck am Stecken hatten; er war ja nicht blöd. Die Einzelheiten interessierten ihn allerdings nicht, er war insbesondere Jo gegenüber loyaler als ein Großvater es sein konnte.
„Man muss vorsichtig sein … heiße Ware“, stammelte der Lieferant. Soso, Hehlerware also. Vermutlich gestohlen. Nicholas musste sich ein Grinsen verkneifen. Beinah hätte er den Mann gemahnt, beim nächsten Mal lieber auf Pünktlichkeit zu achten. Ein nächstes Mal würde es sicher geben, der Mann würde wiederkommen. Allerdings ohne Erinnerung. Er stellte die Waffenkiste auf dem Boden ab und zog einen Geldschein aus der hinteren Hosentasche. 50 Euro für den Fahrer, die Lieferung hatte er zuvor bereits über ein anonymes Konto bezahlt. Kleine Nullnummern wie diesen Kerl hier ließ man vielleicht mit Waren durchs Land fahren, an denen sie sich höchstens selbst verletzen würden, aber man brachte sie nicht in Versuchung, indem man ihnen mehr Bares gab, als ihnen unbedingt zustand. Der Mann nahm das Geld und murmelte einen halbherzigen Dank. Nicholas hielt ihm die Hand zum Einschlagen hin. Er erkannte das minimale Zögern. Der kleine Gauner war ein mickriger Fisch – diese galten gemeinhin als die besten Kuriere – aber seine Instinkte waren gut. Irgendein Gefühl warnte den Mann vor Nicholas. Nicht ganz zu unrecht. Der Nybbas quälte seine zerbrechliche menschliche Hülle schon seit Stunden mit bestialischem Hunger. Kaum dass ihre Finger sich berührten, zerrte der Dämon die Emotionen aus dem Lieferanten heraus und sog sie in sich auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Der Mann schwankte und kippte gegen Nicholas. Er legte ihm die freie Hand in den Nacken. Nährende Gefühle sprudelten durch ihn hindurch, löschten brennende Feuer aus Gier. Zwischen der Erleichterung nahm er noch etwas anderes wahr, Ansätze von Erinnerungen. Seit seinem Kampf gegen die Speculara drängten sie sich ihm manchmal auf, wenn er Gefühle stahl: Bilder, wie unter Milchglas liegend, aber zu erkennen. Jetzt sah er eine keifende Frau, die mit der Faust drohte, eine sich schließende Tür und dann eine spartanisch eingerichtete Kammer, eine Matratze auf dem Boden, verpacktes Brot und Käse auf einem Stuhl, weil weder Schrank noch Tisch vorhanden waren. Ein alter Hund erhob sich mühsam und wedelte vor Freude mit dem Schwanz.
Was für ein armer Schlucker. Nicholas fühlte sich unweigerlich an Elias erinnert, auch wenn diese erbärmliche Kreatur und den gefallenen Racheengel nichts verband, außer der Perspektivlosigkeit, die beider Leben dominierte. Er ließ den Kurier los, verwirrt stolperte dieser ein paar Schritte zurück und rieb sich die Stirn. Der Geldschein segelte zu Boden und blieb auf dem Kies liegen. „Ver… verdammt“, stotterte der Fahrer. „Was is’ passiert?“
Nicholas bückte sich nach dem Geld, steckte es dem Mann in die Hemdtasche und schob ihn in Richtung seines Wagens. „Steig ein, fahr nach Hause, zahl deine Miete und fütter deinen Hund. Und dann such dir einen anderen Job. Ich will dich hier nicht mehr sehen, hast du mich verstanden?“
Der Mann nickte und stieg ein. In fünf Minuten würde er sich nicht mehr erinnern können, Nicholas je gesehen zu haben. Seine Arbeitgeber würden ihn für high halten, wenn sie ihn nach seiner Tour fragten, und den Kopf über seine Ahnungslosigkeit schütteln. Wenn der Junge Glück hatte, warfen sie ihn raus.
Er sah dem Sprinter nach. Zuerst glaubte er, der Typ würde gegen sein Tor fahren, doch wie durch ein Wunder wich der Obstwagen im letzten Moment aus, bog auf die Straße ab und verschwand in Schlangenlinien. Er war nicht länger Nicholas’ Problem.
Er ging zurück zu seiner Waffenkiste, wo ihn sein Mobiltelefon ablenkte. Eine SMS von Joana, in der sie ihm mitteilte, dass die Steuer bedauerlicherweise wichtig sei.
Er tippte zurück, dass Essen wichtiger sei. Einen Moment darauf vermeldete das Handy ihren Anruf.
„Nicholas, ich muss diese Arbeit wirklich jetzt erledigen“, sagte sie. „Aufschieben verursacht schlechte Laune.“
„Und daran kann man nichts ändern?“
„Leider nein.“
„Wie du willst.“ Er seufzte theatralisch, klemmte sich das Telefon zwischen Ohr und Schulter, hob die Kiste auf und trug sie zu seinem BMW. „Kommst du am Nachmittag zur Werkstatt? Du fehlst mir. Außerdem habe ich eine Überraschung für dich.“
Sie flüsterte etwas, das wie ‚Und ich für dich‘ klang, doch dann stimmte sie zu. „Was ist es denn? Eine schöne Überraschung?“
„Zweckdienlich“, wich er aus. Sie war nie begeistert, wenn er neue Waffen kaufte, hatte sich mittlerweile aber damit abgefunden, dass er sie beide ausrüstete wie Geheimagenten und Joana regelmäßig zum Training in eine verfallende Lederwarenfabrik am Stadtrand entführte, wo sie Löcher in die porösen Wände schossen. „Nennen wir es eine Fabrikhallenüberraschung.“
Sie stöhnte. „Na toll. Nicholas, ich weiß nicht recht, ob das gerade so …“
„Was meinst du?“
Sie schwieg eine Weile. Dann sagte sie: „Ach, was soll’s. Ich komme, sobald ich hier fertig bin. Was hast du diesmal? Als Tampons getarnte Handgranaten? Neuralisatoren zum Blitzdingsen? Photonentorpedos und Phaser?“
„Du schaust zu viel fern, Jo, aber du bist nah dran. Die Taser wurden gerade geliefert.“
„Das ist zumindest mal was Neues.“
~*~
Eine Trainingseinheit mit Elektroschockpistolen erschien Joana nicht als der rechte Zeitpunkt, Nicholas von seiner bevorstehenden Vaterschaft zu berichten. Überhaupt kamen ihr im Laufe des Tages immer größere Zweifel. Der Streifen war doch wirklich kaum erkennbar rosa gewesen. Und wenn ihre letzte fast ausgebliebene Periode als Indiz hinzukam, müsste sie bereits in der zehnten Woche sein. Sollte ihr nicht übel sein? Sollten nicht die Hosen spannen?
Sie beschloss, den Test wegzuwerfen und in ein paar Tagen einen neuen zu kaufen, ehe sie sich durch ihre Hysterie lächerlich machte. Schließlich konnte sie überhaupt nicht schwanger sein. Sie hatte immer regelmäßig die Pille genommen.
Als sie am Abend nach Hause kamen, fühlte sie sich erschöpft, dabei war das Training mit den Tasern verhältnismäßig sanft ausgefallen. Kein Vergleich zu ’Nicholas’ Versuchen, ihr Karatetricks oder den Umgang mit altmodischen Schwertern beizubringen oder ihre Ausdauer durch sadistisches Zirkeltraining zu optimieren. Nach einer Dusche ging sie im Bademantel und mit einem Handtuchturban noch einmal in die Küche. Hunger hatte sie keinen,eher das Gefühl, nie wieder etwas essen zu können, aber ein entspannender Tee würde ihr sicher gut tun. Von draußen drang ein Klappern herein, es klang wie der Deckel einer Mülltonne. Das Haus lag näher an der Straße als ihr letztes Domizil in Portugal, weniger abgelegen. Das Leben um sie herum führte dazu, dass sie sich sicherer fühlte, auch wenn das bestimmt nichts als eine Illusion war. Dämonen ließen sich wohl kaum davon abhalten, dass Nachbarn durch die Gardinen herauslugten. Joana stellte sich vor, die gemütliche alte Dame von schräg gegenüber würde den Luzifer mit ihrer selbst geräucherten Salami erschlagen oder mit Knoblauchkränzen in die Flucht schlagen.
Müde lehnte sie sich gegen den Kühlschrank und schnupperte an den Teebeuteln, während der Wasserkocher seine Arbeit tat. Die Nacht drückte sich gegen die Fensterscheibe; sie war dunkel, der Mond sowie jeder Stern von Wolken verschleiert.
Etwas bewegte sich im Garten. Sie kniff die Lider zusammen, um besser sehen zu können. Vielleicht hatte sie nur eine Spiegelung im Glas gesehen? Nein, sie stand bewegungslos, doch dort draußen regte sich etwas. Ein Tier? Nicht zu erkennen. Mungos oder Waschbären kamen manchmal in die Gärten und verwüsteten im Sommer die Beete, doch was sich dort bewegt hatte, schien größer als ein Waschbär. Auch ein Fuchs wäre kein ungewöhnlicher Besucher, und immer, wenn sie einen erblickte, musste sie an den flüchtigen Fuchsdämon Tomte denken. Ihre Müdigkeit war wie weggeblasen, mit zwei raschen Schritten war sie am Fenster und riss es auf. Äste krachten, Blätter raschelten. Und dann erkannte sie, was durch die Wachholdersträucher schlich, die das Grundstück zur linken Seite eingrenzten. Es war kein Fuchs. Es war ein Mensch.
Joana fand die Nerven, zu bemerken, dass Nicholas’ Training sich ausgezahlt hatte. Ohne zu zögern, riss sie eine der überall deponierten Pistolen aus einer Schublade, ging in eine sichere Position neben dem Fensterrahmen und legte auf den Eindringling an. Erst als der Laserzielpunkt auf der Stirn der wie im Schock erstarrten Person zu erkennen war, begann Joanas Herz schneller zu schlagen.
„Beweg dich nicht.“ Sie rief nicht, sie flüsterte. Einer von Nicholas’ Tipps, um Menschen einzuschüchtern. Es funktionierte, die finstere Gestalt erzitterte. Joanas Hand blieb ganz ruhig.
Langsam gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit im Garten. Sie erkannte, dass der Eindringling einen Mantel und einen Hut trug, außerdem hatte er einen ausgebeulten Rucksack umgeschnallt und eine Art Sack in der Hand.
„Alles fallenlassen!“
Es klang, als wäre das, was er in die Büsche sinken ließ, eine Plastiktüte. Joana lauschte ins Haus. Stille, bis auf das leise Wasserrauschen aus dem Bad. Nicholas duschte noch, er würde sie nicht hören, selbst wenn sie schrie. Solange er sich nicht auf die ihn umgebenden Gefühle konzentrierte, konnte er auch nicht spüren, dass jemand in der Nähe war. Sie war auf sich gestellt. Entgegen ihrer Prognose und der Überzeugung, dass sie eigentlich ein friedfertiger Mensch war und nichts als ihre Ruhe haben wollte, fühlte es sich gut an, alles im Griff zu haben. Das hatte sie doch? Vielleicht war es ein verräterisches Gefühl, dieser Eindruck von Macht, der in ihren Adern prickelte. Aber es fühlte sich gut an, sich nicht länger zu verstecken, sondern vorzutreten und notfalls zu kämpfen. Die Zeit des Verkriechens war endgültig vorbei. Die Waffe lag kalt und schwer in ihrer Hand, aber das Training hatte ihre Arme stark gemacht.
„Hände hoch!“, verlangte sie. Sie hatte sogar daran gedacht, Portugiesisch zu sprechen. „Und nun komm raus aus dem Gebüsch!“
Die Gestalt gehorchte, trat auf die Wiese und presste unverständliche Laute hervor, die sie an ein Gebet oder eine Bitte um Gnade denken ließen. Joana tastete über sich und drehte eine der tief hängenden Lampen so, dass ihr Schein den Eindringling einrahmte. Es war ein Mann, er blinzelte gegen das Licht. Sein Gebrabbel wurde zu einem Flüstern, die Augen hatte er geschlossen, als wartete er auf den tödlichen Schuss.
Sie spürte das Mitleid, ehe ihr gewahr wurde, was es verursachte: Der Mann war alt, bestimmt über sechzig. Schmutz hatte sich tief in seine Gesichtsfalten gegraben. Die welken Lippen ließen erkennen, dass sich hinter ihnen keine Zähne mehr befanden. Was er an Kleidung trug – und das war deutlich zu wenig, denn es war anzunehmen, dass er damit auch die Nächte unter freiem Himmel verbrachte, die im März noch empfindlich kalt waren –,sah aus, wie einer Vogelscheuche vom Leib gestohlen. Ein langer Lumpenmantel, vielfach geflickte Hosen, zwei unterschiedliche Schuhe.
„Was … was tun Sie hier?“ Es war die Beklemmung, keine Furcht, was ihr das Atmen schwerer machte. Die Pistole in ihrer Hand begann zu beben. Sie zwang sich, den Lauf weiterhin auf den Mann zu richten. Er mochte nur ein alter Landstreicher sein, der Kohlen oder eine Decke aus ihrer Gartenhütte hatte stehlen wollen, aber gerade darum durfte sie nicht unvorsichtig werden. Sie hatte in Portugal gesehen, wie ein Bettler versuchte, für einen Schokoriegel ein Mädchen niederzuschlagen, das auf dem Weg zur Schule gewesen war. Menschen, die nichts zu verlieren hatten und deren Überleben an einem Stück Brot hing, waren unberechenbar.
„Nochmal. Was – tun – Sie – hier?“
„Senhora …“ Die Stimme des Mannes war dünn und brüchig wie altes Papier. „Oh Senhora, verzeihen Sie mir, wenn ich Sie erschreckt habe. Ich habe nichts genommen, was Sie noch brauchen. Nur Altes. Nur Reste.“
„Meinen Müll? Du … Sie haben …?“
„Oh Senhora, ich bitte um Verzeihung. Ich lege alles zurück, nur bitte, lassen Sie mich ziehen.“ Der Mann wandte ihr den Rücken zu und griff nach der Tüte. Joana erkannte, dass es tatsächlich der Müllbeutel war, den sie am Morgen in die Tonne geworfen hatte. Oh Himmel. Der Mann stahl Abfall, um zu überleben, und offensichtlich fürchtete er die Policia mehr als alles andere – oder zitterte er aus Kälte? Ihr zog es den Magen zusammen. Was konnte sie tun?
„Warten Sie“, sagte sie und ließ die Pistole resigniert auf den Tisch sinken. „Lassen Sie meinen Müll liegen, ich habe etwas anderes für Sie.“ Im Kühlschrank befanden sich noch die Reste ihres Mittagsessens, gebratenes Ingwerhuhn mit Gemüse, ausreichend für sicher zwei Mahlzeiten. Sie packte die Frischhaltedose, eine Salami, Käse und einen Laib Brot in einen Beutel und legte eine Flasche Milch und eine Tafel Schokolade dazu. Der Bettler war näher ans Fenster herangetreten und äugte halb misstrauisch, halb neugierig in die Küche.
„Schön haben Sie es.“
„Danke.“ Sie zwang ein Lächeln auf ihre Lippen. Er hatte recht; die Frage war bloß, wie lange noch. Aber angesichts seiner Probleme kamen ihr ihre Ängste plötzlich erstaunlich normal, beinah banal vor. Sie war nicht der einzige Mensch, der nicht wusste, was der nächste Tag bringen würde. Ihr und Nicholas drohte ein Dämonenfürst. Diesem Bettler der Hunger und die Kälte. Gab es einen Unterschied?
„Warten Sie noch einen Moment“, sagte sie und holte ihre Handtasche aus der Diele. Unauffällig ließ sie einen Geldschein zwischen die Lebensmittel gleiten. Es war nicht viel, aber es würde reichen, um ein paar Tage in einer Pension unterzukommen. Ein paar Tage ohne Angst waren manchmal das, was man brauchte, um wieder Kraft zu sammeln.
„Gehen Sie die Straße Richtung Stadtzentrum hoch“, flüsterte sie und reichte ihm die Tasche nach draußen. Dabei fiel ihr Blick auf ein dickes Bund verschiedener Schlüssel, dass er am Gürtel trug. Sie erinnerte sich an eine Geschichte, die ihr eine Portugiesin erzählt hatte: Es brachte angeblich Glück, einem Wanderer den Schlüssel des eigenen Hauses mitzugeben. Das Wasserrauschen aus dem Obergeschoss hatte aufgehört. Wenn der Landstreicher nicht einem leibhaftigen Dämon erklären wollte, was er in seinem Garten tat – und das wollte er nicht, so viel stand fest –, sollte er langsam verschwinden. „Dort liegt eine Pension. Ich kenne die Inhaberin gut, sagen Sie an der Rezeption, dass Joana Ânjâm Sie schickt und Ihre Rechnung begleichen wird.“ Sie nahm ihren Schlüssel aus der Tasche und drehte einen ab. Es war nicht der Schlüssel zu ihrer Haustür, er passte bloß in die Tür des Hauses, das Nicholas in die Luft gesprengt hatte – aber was soll’s.
„Senhora!“ Trotz des Abstands führte das ausgerufene Wort einen Schwall übelster Gerüche nach saurem Atem und Alkohol mit sich. Joana wandte sich nicht ab und unterdrückte anschuldigende Gedanken. Vermutlich war billiger Schnaps der einzige Trost, den der alte Mann noch bekommen konnte.
„Das kann ich nicht annehmen.“
„Doch, das können Sie. Und das hier“, sie reichte ihm den alten Schlüssel, „nehmen Sie im Gegenzug für mich mit.“ Er steckte den Schlüssel anseinen Bund, aber seine traurigen Augen verrieten bereits, dass er dennoch niemals in der Pension ankommen würde. Sie versuchte es trotzdem ein letztes Mal. „Bitte tun Sie es. Schlafen Sie ein paar Tage aus und… nehmen Sie ein Bad.“ Bitte, bitte, versauf das Geld nicht. „Nur gehen Sie jetzt. Schnell! Und kommen Sie nicht wieder. Dieser Ort ist …“
„Gefährlich, ich weiß.“ Der Bettler drückte die Leinentasche an seine Brust wie einen wertvollen Schatz. „Ich spüre so etwas. Hier ist der Tod.“ Er blickte über die Schulter in den Garten und hatte keinerlei Ahnung, dass die Gefahr, von der er sprach, aus der anderen Richtung drohte.
Joana schüttelte den Kopf. „Nur etwas, das nicht lebt wie Sie und ich, sondern auf andere Weise. Gehen Sie! Tragen sie meinen Schlüssel weit, ich kann das Glück gebrauchen.“
„Danke, Senhora.“ Der Bettler machte eine Reihe von kurzen, buckligen Verbeugungen und verschwand hinkend in der Dunkelheit. Er wurde noch einmal sichtbar, als er die beleuchtete Haustür passierte. Seine Schritte knirschten im Kies der Einfahrt. Joana wartete, bis sie nichts mehr sah und hörte, dann schloss sie das Fenster und senkte die Stirn in die Handflächen. Armer, alter Mann. Die Welt war voll von ihnen.
Im Obergeschoss klapperte eine Tür. Sie versuchte, die trübseligen Gedanken abzuschütteln und spürte erst jetzt, wie kalt ihr vor dem offenen Fenster geworden war.
Auf dem Weg nach oben kam ihr Nicholas entgegen, zu ihrem Erstaunen zwar mit nassem Haar, aber komplett angekleidet. Selbst die Schuhe hatte er wieder angezogen und die Jacke trug er über dem Arm
„Hast du heute noch was vor?“
„Ja“, antwortete er gedehnt und versperrte ihr mit seinem Körper den Weg. „Ich dachte, ich verschleppe meine Frau für heute Nacht in die nächstbeste Höhle und …“ Doch dann stutzte er. „Ist alles in Ordnung, Jo? Du bist ganz blass.“
„Es ist nichts.“ Nein, nur eine Schwangerschaft, die nicht sein dürfte, und ein Landstreicher im Garten. Nicht der Rede wert. „Das Training war anstrengend und ich habe heute Abend noch nichts gegessen.“
Nicholas musterte sie skeptisch, gab sich mit der Erklärung aber zufrieden. Er kannte sie, wusste gut, dass sie so manche Frage erst mit sich selbst klären musste, eh sie bereit war, mit jemand anderem zu sprechen, einschließlich mit ihm. Ebenso gut wusste er, dass sie früher oder später mit ihm über alles sprach – normalerweise früher, wenn er sie nicht drängte. Darum zuckte er mit den Schultern und sagte bloß: „Das trifft sich gut, der Zimmerservice soll in diesen Höhlen recht annehmbar sein. Oder bist du müde?“
Der Schreck, den der Landstreicher ihr eingejagt hatte, hatte jede Müdigkeit vertrieben und zu ihrer Irritation musste sie sich eingestehen, dass sie inzwischen tatsächlich ziemlich hungrig war. Ein Schwindel weniger, der ihre Lügenbilanz aber nicht wirklich bereinigte. Sie schüttelte den Kopf. „Gib mir zehn Minuten zum Haare föhnen, dann können wir los.“
~*~
Joana versank während der Fahrt Richtung Westen in Gedanken. Was mochte sie beschäftigen? Nicholas gab vor, nichts zu bemerken, aber in seinem Inneren brodelte es. Sie hatte sich ohne Kommentar auf den Beifahrersitz gesetzt, anstatt wie üblich darauf zu bestehen, den BMW selbst zu fahren.
Sein neu verstärktes Talent, nicht nur Emotionen zu schmecken, sondern auch Erinnerungen zu sehen, stellte ihn vor neue Versuchungen. Wozu war diese Fähigkeit gut, wenn es kaum Erinnerungen gab, die zu sehen für ihn von Interesse war? Die einzigen Erinnerungen, die er gern gesehen hätte, waren Joanas – und Joana war in dieser speziellen Hinsicht sein Tabu. Er durfte jede Stelle ihres Körpers berühren, aber es gab eine Grenze: Ihre Emotionen rührte er nicht an. Sie brauchte das Gefühl von Eigenständigkeit, nichts war ihr so sehr zuwider wie die Gefahr, ihre Privatsphäre zu verlieren. Rückblickend auf seine Geschichte sowie die der meisten Dämonen musste er feststellen, dass Joana froh sein konnte, kein Dämon zu sein. Seinesgleichen verfügte nicht oft über den Luxus der Selbstbestimmung, und wenn sie sie bekamen, dann war dies ein kostbares Gut und selten von ewiger Dauer. Ihm war bewusst, dass die Tage seiner Freiheit gezählt waren. Der Luzifer würde seinen Anspruch auf ihn geltend machen, daran bestand nicht der geringste Zweifel. Die Frage war nur: Wann?In Stunden? Jahren? Jahrhunderten?
Joana zeigte auf eine verfallene Brücke, die in der Dunkelheit von einer flackernden Straßenlaterne besser beleuchtet wurde als die Straße, auf der sie fuhren. „Die sieht extrem alt aus. Römisches Reich würde ich schätzen.“
„Ja. Wenn man hier barfuß geht, tritt man sich mit etwas Glück römische Nägel in die Füße, die sie aus ihren Sandalen verloren haben.“
„Nicholas? Hast du das mit der Höhle ernst gemeint?“ Sie sah besorgt aus. Er wusste, dass sie Höhlen hasste. Oft hatte sie diesen Traum einer einstürzenden Höhle. Den Traum von ihrem Vater, der kein Traum war, sondern eine Erinnerung. Es wurde kalt in Nicholas’ Brustkorb, wann immer er an das Geheimnis dachte, das er ihr vorenthielt.
„Halbernst“, sagte er. „Du wirst sehen. Du wirst es mögen.“
Wenig später parkte er den Wagen an einer Stelle, an der sich im Sommer portable Souvenirläden und Getränkestände dicht an dicht drängten. Noch war alles ruhig, nur ein anderes Auto mit Bootsanhänger war zu sehen; ein mutiger Fischer, wenn er während des Wellengangs bei Nacht zwischen den Klippen rausfuhr.
Nicholas führte Joana nicht den direkten Weg zum Meer, den sie vom Strandausflug schon kannte. Er schlug einen Umweg ein, der sich im fahlen Mondschein kaum erkennbar durch die Macchie schlängelte und immer wieder von Baumheide, Kreuzdorn und Farnen überwuchert wurde. Olivenbaumblätter knisterten im Wind. Joana trug zwar feste Schuhe, doch eine Hose, die bloß bis zur Wade ging, aber sie beschwerte sich nicht, obgleich das Gestrüpp ihr die Beine zerkratzte. Hin und wieder fuhr sie mit den Händen an Lavendelschöpfen entlang, deren markanter Geruch alles dominierte und nicht einmal eine Ahnung der salzigen See erlaubte.
„Hier geht es entlang“, rief er ihr gegen den Wind zu und fasste sie an der Hand, um ihr beim steilen Abstieg zwischen ein paar rostroten Felsen zu helfen, die zackig geformt waren wie der Unterkiefer eines gigantischen, roten Haiskeletts.
„Ich sehe keinen Weg.“
„Da ist aber einer.“ Bitte frag mich nicht, woher ich das weiß.
Er hatte ihn auf der Jagd entdeckt, ein frisch verliebtes Pärchen hatte ihn geführt, ehe er beiden die Emotionen raubte. Gelegentlich brauchte er etwas Süßes. Er war lange genug Dämon, um zu wissen, dass es den zänkischen Menschen auch nicht leichter fiel, ihre Gefühle herzugeben als den glücklichen – nur, dass diese besser mundeten und hin und wieder musste man sich eben etwas gönnen. Man sah an Vampiren, dass ein eingeschränkter Speiseplan nur eines verursachte: Depressionen. Joanas Verständnis war in solcher Hinsicht leider löchrig wie ein Fischernetz, daher sprachen sie nicht über seine Nahrungsaufnahme.
Sie umrundeten einen Fels und hatten mit dem nächsten Schritt Blick aufs Meer. Gleichzeitig hörten sie es auch. Es peitschte an diesem späten Abend mit entfesselter Kraft gegen die Küste.
„Siehst du“, lenkte er ihre Aufmerksamkeit auf den Weg. „Man sieht die Stufen kaum, weil sie so dicht im Schatten der Steilklippe sind. Pass auf, der Fels hat scharfe Kanten, streif nicht mit der Schulter dran entlang.“
Joana staunte, folgte ihm aber sofort, und das, obwohl es unmittelbar vor ihnen mindestens fünfzig Meter steil nach unten ging. Geradewegs in das von Felskanten zerschnittene Meer. Bei jeder Welle, die an die Küste drosch, zitterte der Stein unter ihren Füßen. Das Tosen war ohrenbetäubend. Es war kaum zu glauben, dass ganz in der Nähe ein Badestrand lag, der für seine milden Temperaturen und die von Felswänden verursachte Windstille bekannt war. Hier riss Sturm an Nicholas’ Haar; Joana hatte sich die langen Locken zu einem Zopf geflochten, aus dem der Wind einzelne Strähnen befreite.
„Ist das eine natürliche Treppe?“, fragte Joana. Sie musste rufen, damit er sie im Tosen von Wind und Wellen verstand, obwohl sie gleich hinter ihm ging.
„Die Leute hier nennen das eine Arme-Fischer-Treppe“, erklärte er und erinnerte sich an Zeiten, die manchmal so fern waren, dass er sich nicht mehr sicher war, ob er wirklich dort gewesen war oder nur davon gehört hatte. Manchmal schien ihm sein wahres Alter so unwirklich wie ein Traum. „Wer kein Geld für Boote hatte, schuf sich im Geheimen einen versteckten Weg zu einem Küstenabschnitt, an dem tote Fische angeschwemmt werden und sich Muscheln zwischen den Felsen verfangen. Aber so tief wollen wir heute nicht.“
Zu seiner Linken tat sich eine Öffnung auf, kaum größer als der Umfang einer Regentonne. „Glaubst du, du kommst da durch, Jo?“
„Na hör mal!“ Sie versetzte ihm einen spielerischen Knuff, der ihm, bedachte man, dass ein falscher Schritt sie stürzen und am Grund zerschmettern lassen würde, etwas tollkühn erschien. In Windeseile krabbelte sie vor ihm durch die Öffnung. Er folgte ihr und sie befanden sich in einer gewaltigen Höhle, diemit ihrem kuppelförmigen Dach und ein paar fensterartigen Öffnungen an einen Festsaal erinnerte.
„Unglaublich!“ Der Schall von Joanas Stimme fuhr an den gerundeten Wänden entlang, sodass das Echo aus allen Richtungen zu kommen schien. Ihr stand der Mund offen. Nicholas fand vor allem die Tatsache unglaublich, dass diese Höhle noch nicht von findigen Touristen entdeckt und als Nachtclub oder Hotel zweckentfremdet worden war.
„Das ist noch nicht alles. Komm mit!“ Er führte sie eine verborgen liegende Stiege empor in eine kleinere Höhle. Hier gab es keine Öffnungen mehr im Stein, durch die der Mond scheinen konnte, sodass er die Taschenlampe auspacken musste.
Joana legte sich den Finger auf die Lippen. „Hörst du das?“
Er zeigte ihr den Bach, der durch eine Senke lief und zu einem kleinen Teich führte. Joana probierte das Nass. „Süßwasser.“
„Ja“, erwiderte er und wurde sich schlagartig wieder des Grundes bewusst, warum er ihr die Höhle hatte zeigen wollen. „Notfalls kann man hier ein paar Tage überleben. Für den Fall, dass man sich verstecken muss.“
Ihre Augen glänzten schwarz in der Dunkelheit. Sie schluckte. „Woran denkst du? An Break?“
„Woran sonst?“ Break war einer der Codes, die sie gemeinsam entwickelt hatten, um bestmögliche Chancen zu haben, sollte der Luzifer spontan auftauchen und schnelle Reaktionen erfordern. Hinter jedem Code versteckte sich ein genauer Verhaltensplan. Alle Codes waren einfach zu übermitteln. Es brauchte nicht mehr als eine SMS oder eine unauffällige Markierung an geeigneter Stelle und schon wussten beide bis ins kleinste Detail, was zu tun war. Break bedeutete eine kurzfristige Trennung, ein Untertauchen in unmittelbarer Nähe ohne lange Flucht, getrennt voneinander. Exakt eine Woche später würden sie sich an einem Bahngleis in Lissabon wiedertreffen; Joana verkleidet, Nicholas soweit körperlich verändert, wie es nur ein Dämon konnte.
Joana blies die Wangen auf. „Ich glaube nicht, dass ich das kann. Diese Enge. Zu wissen, dass tonnenschwerer Stein über mir ist.“
Er legte ihr eineHand auf die Brust, fühlte ihren Herzschlag. „Du hast jetzt keine Angst.“
„Nicht, wenn du bei mir bist.“
„Kein Argument, Kleines. Ziel der Aktion soll es sein, dass ich zeitnah wieder bei dir sein werde.“
Trotz der Dunkelheit sah er, wie sie die Augen verdrehte. „Wir haben das alles hundertmal durchgekaut. Bitte lass es uns vergessen, bis es akut wird. Ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß, wohin ich gehen kann, wenn es nötig sein sollte.“
„Ach ja? Wohin denn?“
Ihre Zähne leuchteten auf, vermutlich ein Lächeln. „Ich muss dich töten, wenn ich dir das sage, schon vergessen?“
Der Kuss, den er sich holte, schmeckte nach Amüsement. Wie sehr es ihn erleichterte, dass sie langsam wieder lockerer wurde. Ihre Abenteuer in Island und der Kurztrip nach London hatten bei Joana tiefe Wunden hinterlassen, die allerdings zu heilen begannen. Die Geschehnisse hatten sie stärker gemacht. Nicht, dass sie je schwach gewesen wäre. Ihre wahre Stärke war allerdings in ihr verborgen gewesen und erst nach und nach aus ihr hervorgebrochen, wie ein Trieb aus der Erde. Zeit, zu erblühen, dachte er und wusste gleichzeitig, dass dazu Umstände vonnöten waren, die er lieber nicht so rasch erlebt hätte.
„Kommst du?“, rief sie. Ohne dass er es bemerkt hatte, war sie dem schmalen Pfad durch die Höhle gefolgt und stand nun als dunkle Silhouette vor dem Ausgang.
Der Blick nach draußen entlockte ihr ein paar Laute der Verzückung. Es war unglaublich, was sich vor ihnen auftat. Nach dem Höhlenausgang, der so versteckt lag wie der Eingang, den sie genommen hatten, mussten sie drei Meter steil in die Tiefe klettern. Dann standen sie auf einem gewaltigen Felsen, der wie ein doppelter Torbogen geformt war; eine knapp zwei Meter breite Brücke, die aufs offene Meer zu führen schien. Joana lief ein paar Schritte vor, warf das Haarband fort und ließ den Wind ihre Locken auftreiben. Sie drehte sich. Es schien sie überhaupt nicht zu stören, dass unter ihren Füßen Steinchen wegsprangen und zwanzig, fünfundzwanzig – Dreck nochmal – dreißig Meter in die Tiefe stürzten und in der tobenden See versanken. Gemächlich schlenderte er ihr nach. Die Wellen brachen sich mit solcher Gewalt an der Klippenbrücke, dass diese zu schwanken schien. Winzige Meerwassertropfen stoben auf, sodass seine herausgezogene Zigarette feucht wurde, ehe er sie anzünden konnte.
Joana lief weiter, geradewegs auf das Ende des Pfades zu und stieß ein Triumphschrei aus. Er musste dagegen ankämpfen, ihr eine Warnung zuzurufen. Zu drei Seiten ihrer Füße ging es wirklich abartig tief runter! Sich beim Sorgenmachen zu ertappen, amüsierte ihn, aber nicht ausschließlich. Vielleicht hatte Elias mit seinen Pfeilen aus Spott genau ins Schwarze getroffen, als er behauptete, der Nybbas würde langsam zum biederen Ehemann? Um ehrlich zu sein, hatte Nicholas einfach nicht die geringste Lust, noch einmal das zu verlieren, was ihm derart wichtig geworden war. Er verfluchte Elias sowie alles, was mit ihm zu tun hatte und wie immer wurde ihm im gleichen Moment frostkalt im Bauch, als hätte sich Elias’ Geist wie ein Parasit in seiner Mitte eingenistet. Oder war es seine eigene Furcht? Der Gedanke, Joana zu verlieren, war so abscheulich, dass ihm Kälte in den Körper rieselte. Erstaunlich, wie sehr er jemanden lieben konnte. Erschreckend, wie sehr er jemanden brauchte.
„Wo bleibst du?“, rief sie. Ihre Stimme schwang im Wind wie ein Vogel, den der Sturm nach Belieben herumschleuderte. Nicholas eilte zu ihr und erst, als er seine Hände fest um ihre Schultern schloss, machte ihm die Höhe nichts mehr aus. „Sag nicht, du kennst diese Felsen schon länger. Warum hast du mir das denn nie gezeigt?Es ist der Wahnsinn!“
„Ja. Aber man kann verflucht tief fallen.“
Einen Augenblick lang sah sie ihn voller Ernst in den Augen an. „Ist doch immer so, wenn man glücklich ist.“ Bevor ihm eine Antwort einfiel, verhinderte sie diese, indem sie ihre Hände um seinen Nacken schlang, ihn zu sich herabzog und küsste. Und herrje, wie sehr sie ihn küsste. Hatte er in den letzten Tagen noch das Gefühl gehabt, dass irgendetwas – vermutlich nur eine kleine Sorge – sie zurückhielt und hemmte, schien dies für heute Nacht nicht existent. Vielleicht hatte der Wind die Sorge weggetragen, raus aufs Meer, wo sie nun jämmerlich ersoff. Gute Vorstellung.
Joanas Kuss war ungestüm wie die Nacht. Er schmeckte etwas unvertraut Düsteres, als ihre Zunge sich zwischen seine Lippen schob und ihr Körper sich an seinem rieb. Schon waren ihre Hände unter seiner Jacke, die Knöpfe seines Hemdes geöffnet und ihre Finger erst an seinen Brustwarzen, dann an seinen Bauchmuskeln, am Saum der Hose. Keine Bitte, kein Locken, kein Werben. Bloß Verlangen; ohne Option auf ein Nein. Nicht, dass er hätte Nein sagen wollen. Oh, sie machte ihn verrückt, wenn sie nicht fragte, sondern klarstellte, was sie wollte, und erwartete, dass er es ihr gab. Unverzüglich.
„Ich sehe schon, der Ort gefällt dir“, murmelte er in ihr Haar.
„Du gefällst mir.“ Ihre Stimme nahm einen Ton an, den erkaum wiedererkannte. Sie klang rau, als würdenicht nur Erregung in ihr brennen, sondern Wut, unter der sie die Zähne aufeinanderbeißen musste. Sie leckte an seinem Ohr und er bezweifelte, sich noch eine einzige Minute zusammenreißen zu können. „Aber du hast recht. Hier oben … ist alles … Ich fühle mich anders.“
Eine Sekunde lang gefiel ihm nicht, was sie sagte. Ein winziger Splitter aus Sorge störte ihn. Anders? Was sollte das bedeuten? Doch im nächsten Moment wurde aus ihrem Lecken ein Biss in sein Ohrläppchen, der schmerzhaft schön in seinen Schoß schoss. Gleich darauf folgte ihre Hand unter den Stoff seiner Jeans und umfasste ihn mit einer Gier, die alles Vergessen machte bis auf einen heißen, alles beherrschenden Gedanken: Er würde sie hier auf den Steinen nehmen; über ihnen der Himmel, unter ihnen die Flut und um sie herum nichts als stürmischer Wind.
„Hilf mir“, flüsterte sie, seinen Gürtel öffnend, die Worte fast verdeckt von ihrem schweren Atmen. Er kam dem gern nach, und während sie ihm aus der Hose half, zerrte er schon an ihrer Jacke. Sie kicherte, als er den steinigen Boden mit ihren Jacken polsterte, wieder fand sich eine Düsternis in ihrer Stimme, die er kaum kannte. Wer bist du und was hast du mit Joana gemacht?, ging es ihm durch den Kopf, aber warum den Moment mit unnötigen Worten beschweren? Er hatte lang genug dafür gekämpft, dass sie endlich von ihren Bedenken abließ und einfach lebte. Wild und frei, wie sie tief in ihrem Inneren war; fernab aller Regeln, die ihr die Welt aufgedrückt hatte. Sie zog sich ein wenig zurück, rekelte sich vor ihm auf den Jacken, die Arme zu beiden Seiten ausgestreckt, wo sie sich mit den Fingern an Steinbrocken festklammerte. Nichts als ihre Schuhe und den Mondschein auf der Haut trug sie noch. Er fragte sich, ob sie sich früher schon jemandem so hingegeben hatte, doch im gleichen Moment wusste er, wie unwahrscheinlich das war. Sie war scheu und zurückhaltend gewesen. Permanent unter ihrer eigenen Kontrolle. Es befriedigte ihn zutiefst und erfüllte sein Innerstes mit Stolz, dass sie allen widrigen Umständen zum Trotz so sehr zu sich gefunden hatte. Dass sie glücklich war. Mit ihm. Egal was sich ihr entgegenstellte.
Vermutlich las sie die Gedanken in seinen Augen, denn sie lächelte träge. Langsam öffnete sie die Beine für ihn, ihr Schoß bereits feucht und seidig glänzend. Während er noch in genüsslicher Ruhe abwägte, ob er sie erst streicheln oder dort küssen sollte, schüttelte sie den Kopf.
„Keine Spielchen.“ Sie schloss die Augen. „Heute will ich nur eins. Dich. In mir, so tief wie ein Messer im Herz.“
Seine Erektion schmerzte, so erregend waren ihre Worte. Trotzdem oder gerade deshalb quälte er sie gern noch ein wenig. Brachte ihre Beine in die richtige Position. Strich ihren Bauch herab und die Innenseiten ihrer Oberschenkel hoch, ohne ihreMitte auch nur mit einem Lufthauch zu streifen. Lauschte auf das Knirschen von Steinen unter Leder, wenn sie sich ihm entgegenstreckte. Beobachte, wie ihre geschlossenen Lider flatterten wie im Fiebertraum und ihre Zunge immer wieder ihre Lippen befeuchtete. Er trieb sein Verlangen auf die Spitze und fand einen Augenblick Zeit, sich zu wundern, wie zufrieden sein Inneres schnurrte, obwohl der Nybbas, der normalerweise so gierig auf Joanas würzig-süße Emotionen war, nichts von ihr erhielt. Inzwischen liebte er sie aus ganzer Seele. Selbst der Teil von ihm, der jahrhundertelang an kaum etwas anderes als sich selbst und seinen Hunger denken konnte, war zufrieden, wenn er spürte, dass sie glücklich war.
Erst als sie vor Verlangen seinen Namen wimmerte, stieß er in sie; so fest, dass sie schrie, so hart, dass der Fels zu vibrieren schien, so heftig, dass es in seinen Ohren rauschte und er das Heulen des Windes und das Rauschen der See nicht mehr wahrnahm. Weniger hätte nicht gereicht.
Alles, Sturm, Stein, Meer und ihre Körper, wurden eins. Inniger als je zuvor.
Und es war mit einem Mal erschreckend schön, jemanden zu brauchen.
3
us der hinteren Ecke der Werkstatt ertönte ein Knattern, das die Halle ausfüllte. Joana sah abrupt von ihrer Arbeit auf. Krachend stieß sie sich an einem Regalbrett so fest den Kopf, dass einer der Dutzenden Schraubenschlüssel herunterfiel und auf ihrem Fuß landete. Verdammt!
„Der Mitsubishi springt an?“, brüllte sie gegen den Schmerz an. Dieser Wagen war wichtiger als ein geprellter Zeh und jede Beule.
Der Motorenlärm verstummte wieder. „Seit gestern schon, Senhora!“, rief André Bergot mit seiner tiefen Stimme zurück.
„Dann ist er fertig? Wirklich?“
André trat zu ihr und wiegte den Kopf. „Na ja, eigentlich schon.“
Joana bemühte sich wirklich um Nachsicht, aber manchmal trieb der Portugiese sie mit seiner stoischen Ruhe in den Wahnsinn. „Eigentlich schon? Das bedeutet uneigentlich was?“
„Das bedeutet, dass er fertig ist, solange die Probefahrt nicht zeigt, dass er es nicht ist.“
„Versteh schon.“ Sie sprang auf, rang denImpuls nieder, dem Mechaniker um den Hals zu fallen und ihn gleichzeitig durchzuschütteln, und saß Sekunden später hinter dem Lenkrad des Wagens. Sie hatte Nicholas damals die Hölle heißgemacht, als er den Oldtimer-Prototypen für eine schier perverse Summe gekauft hatte. Nicht, dass es kein interessantes Auto gewesen wäre. Der Mitsubishi PC33 war selten, beinah einzigartig, und entsprechend wertvoll. Wunderschön war der dunkelrote, offene Tourenwagen aus den 30er Jahren ohnehin. Aber als man ihn angeliefert hatte, war der Wagen in einem derart desolaten Zustand gewesen, dass sich Joana bei aller Fantasie nicht hatte vorstellen können,ihn irgendwann zu fahren. Ihn fahrtüchtig zu bekommen, war nichts als ein Traum gewesen, ein alberner Kleinmädchenwunschtraum. André hatte das Wunder vollbracht, einen Haufen Schrott in einen wertvollen klassischen Wagen zu verwandeln, der nicht nur beinah wie neu aussah, sondern auch fahrbar war. Der Mann konnte nicht von dieser Welt sein. Nicholas würde Augen machen, wenn sie zu ihrer Verabredung zum Mittagessen mit dem Japaner vorfuhr. Sie konnte es kaum erwarten, ihn mit dieser Nachricht zu überraschen. Wie auf ein stilles Stichwort klingelte ihr Handy und vermeldete eine SMS. Sie tippte das Symbol an und ein einziges Wort erschien auf dem Display. Ein Wort nur, ein einziges.
Ein Wort, das ihr den Boden unter den Füßen wegzog.
Cut.
Cut. Sie starrte das Wort an. Musste sich irren. Blinzelte und starrte wieder, aber es war immer noch da. „Nein!“
Ihr wurde erst bewusst, dass sie laut gesprochen hatte, als André neben ihr auftauchte. „Senhora, ist etwas passiert?“
„Was? Nein, ich ...“
Nein, bloß die Welt lag in Trümmern. Joana schüttelte den Kopf. Es war nicht real. Nicht echt, er scherzte sicher nur. Er musste scherzen. Sie kannte seinen eigenartigen Sinn für Humor, hatte sich oft genug darüber ärgern müssen. Dieser elende Schweinehund, jetzt ging er zu weit. Für diesen miesen Witz würde sie ihn einen Kopf kürzer machen. Sie würde ihn in eine Lampe sperren und auf einem Trödelmarkt verkaufen.
„Senhora, was ist denn los mit Ihnen? Sie sind ganz bleich.“
„Ich … muss nur eilig weg. Ich mache die Probefahrt sofort, André.“
„Sind Sie sicher? Vielleicht sollten Sie lieber erst einmal aussteigen und durchatmen.“
„Nein!“
Nein, sie musste zu ihm. Was immer auch passiert war – er war in Gefahr.
„Senhora, Vorsicht, bitte. Ich weiß nicht, wie zuverlässig der Wagen ist. Bleiben Sie lieber in der Nähe.“
Joana riss die Autotür ohne eine Antwort zu, startete den Motor erneut und setzte ruckartig zurück. In ihrer Panik streifte sie einen Reifenstapel, die oberen Reifen fielen zu Boden, hüpften wie Flummis durch die Halle und prallten gegen Autos und Regale. Werkzeuge und Ersatzteile prasselten zu Boden. Joana war es egal, es hätte ihr nichts ausgemacht, wenn die Werkstatt in einem Inferno in die Luft gegangen wäre.
Sie war in ihrem Leben selten vernünftig gewesen, aber nun spürte sie, dass sie die Dummheit ihres Lebens beging. Sie musste zu ihm! Genau das war falsch und das wusste sie. Die Pläne zum Code Cut waren eindeutig. Flucht. In verschiedene Richtungen. Trennung. Sofort und endgültig. Cut bedeutete, dass die Luft brannte, dass nichts mehr zu retten war, dass Nicholas keine Alternative mehr hatte und es keinen anderen Weg mehr gab, außer diesem einen.
Sie nahm eilends den anderen.
~*~
Nicholas wusste, dass es nicht Joanas Art war, auf derartige Botschaften hin zurückzurufen. Trotzdem schaltete er das iPhone stumm. Genau so stumm war sein Wunsch, sie würde handeln wie vereinbart und fliehen. Aber darauf hatte er nun keinen Einfluss mehr, ihm blieb überhaupt nichts mehr zu tun, außer auf Jos Vernunft zu vertrauen.
Er hatte sich die unterschiedlichsten Szenarien ausgemalt, alles war vorstellbar gewesen und seine Fantasie grenzenlos. Dass er den Luzifer bei Kaffee und Gebäck erwarten würde, schien ihm dennoch skurril. Fast hätte er gelacht, doch selbst Galgenhumor hatte eine Grenze. Eine interessante Erfahrung. Wie oft hatte er sich gefragt, wie es wohl sein würde, wie er den Fürsten erkennen würde, ob er überhaupt bemerkte, wer ihm wirklich gegenüberstand.
Nun erfuhr er es. Es war eindeutig. Die Nähe des Luzifers war nicht zu leugnen, er hatte es wie einen glühenden Zwang um seinen Geist gespürt. Wie Lava, in der er gefangen war und die sich schneller durch sein Fleisch, seine Knochen bis in die tieferen Ebenen seines Seins fraß, als er realisierte, dass er in den Vulkan gestürzt war. Im gleichen Augenblick war ihm alles klar. Er war gefangen. Ein Insekt in Bernstein, unfähig zur Regung, solange sein Fürst es nicht erlaubte – und der hatte Besseres zu tun, als nachgiebig zu sein. Nicholas bestellte Kaffee und eine große Kanne Kamillentee, steckte sich eine Zigarette an, inhalierte den Rauch und wartete auf Kaffee, Tee und sein Schicksal. Was blieb ihm anderes übrig?
Das Café lag in einem Hof zwischen Häusern, die aus unterschiedlichen Zeiten zusammengewürfelt waren. Eines war sicher so alt wie der Nybbas selbst und sah weit älter aus mit seinen Wänden aus klobigen Natursteinen. Das nächste war modernerer Art, billigst verputzt und weiß getüncht. Das dritte war ein Fertighaus, hastig zwischen den Resten des zuvor abgerissenen Stalls errichtet. Davor hing zwischen zwei zu Türmen aufgestapelten Dachschindeln, die übrig waren,eine Hausfrau ihre Wäsche auf, pfiff ein Lied und sah auffallend oft zu Nicholas herüber. Die offene Seite der zum U angelegten Gebäude ließ zu, dass die Sonne in den Hof schien, ab Mai wäre es ohne Sonnenschirm kaum mehr erträglich, an den Außentischen des Cafés zu sitzen. Ein struppiger, alter Hund aalte sich auf dem warmen Boden und kratzte nur hin und wieder an einer offenen Stelle unterm Kinn. Die beiden verflohten Katzen, die meist zwischen den Tischen herumstrichen, entdeckte Nicholas nicht. Vielleicht spürten auch sie die machtvolle Präsenz, die ihm jede Regung untersagte, und hielten sich fern. Er versuchte, zu erfühlen, ob sich der Luzifer näherte, aber es gelang ihm nicht. Seine seismografischen Fähigkeiten im Aufspüren anderer Dämonen waren vorhanden, aber nicht besonders gut ausgeprägt. Bisher waren ihm andere egal gewesen. Die Bedienung brachte eine Porzellankanne, aus der es brechreizerregend nach Kamillentee roch. Er beantwortete ihre besorgte Frage, ob alles in Ordnung sei – natürlich nicht, denn wer bestellte schon einen Liter Kamillentee, wenn er nicht glaubte, im Sterben zu liegen? – indem er ihre Hand tätschelte und ihr ein bisschen ihrer guten Laune und der Früh


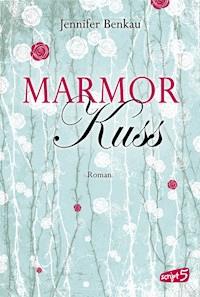














![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)










