
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sieben Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schattendämonen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Sie nennen ihn Nicholas, doch wer er wirklich ist, ahnt niemand. Sein Aussehen ist atemberaubend, sein Charme lässt allerdings zu wünschen übrig. Seine Berührungen sind so absolut unwiderstehlich, wie sein Schatten tödlich sein kann. Er ist ein Wesen, das nur einen Feind kennt: die Clerica, Dämonenjäger, die seine Art seit Jahrhunderten jagen, bannen und töten. Nach einem herben Schicksalsschlag verfällt Joana mehr und mehr der Gleichgültigkeit, und merkt erst wie wertvoll ihr das Leben ist, als Nicholas es in ernsthafte Gefahr bringt. Denn im Körper des faszinierenden Mannes verbirgt sich der Nybbas. Ein Dämon, der sich von Emotionen ernährt und nichts so sehr liebt, wie das Spiel mit seinem Opfer. Nach ihrer Begegnung gerät Joana zwischen die Fronten von Gut und Böse, und muss eine schwere Entscheidung treffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Nybbas Träume
Schattendämonen 01
Jennifer Benkau
Copyright © 2010 Sieben Verlag, Fischbachtal
Printed in Germany 2010
Umschlaggestaltung: Mark Freier, München
ISBN Printausgabe: 978-3-941547-02-5
ISBN E-Book: 978-3-941547-60-5
www.sieben-verlag.de
Du, den ich rufe.
Gebiete über meine Träume.
Vernichte meine Feinde und nähre Dich an ihrer Qual.
Errette meine Seele und führe sie in den ewigen Untergang.
Greife nach der Frucht meiner Lenden,
nimm sein Fleisch und sein Blut als mein Geschenk.
Erhebe Dich!
Mein Sohn.
Mein Geliebter.
Mein Dämon.
1
Dem Nieselregen gelang es nicht, die Hitze von den Straßen zu waschen. Fauliger Geruch von verdunstendem Hafenwasser schwängerte die Luft. Der, den sie Nicholas nannten, betrat die alte Kirche. In ihrem Inneren war es angenehm frisch, und das durch die Mosaikfenster dringende Licht der Straßenlaternen tauchte alles in zarte Schatten bunter Farben.
Mit einem spöttischen Lächeln ließ er seine Fingerspitzen durch das Weihwasserbecken gleiten und strich sich im Weitergehen mit der feuchten Hand das Haar aus dem Gesicht. Der Hall seiner Schritte wurde von der hohen, kuppelförmigen Decke zurückgeworfen. Der Priester sah auf und trat dem späten Kirchgänger sogleich entgegen. Erst jetzt kam Nicholas die Erkenntnis, warum er die Kirche aufgesucht hatte. Es war nicht der angenehmen Kühle wegen. Sein Inneres war hungrig und hatte ihn hergeführt.
„Verzeihen Sie, aber ich wollte gerade abschließen“, sagte der Priester. „Kann ich Ihnen zuvor noch helfen?“
Nicholas lachte leise. „Durchaus, das kannst du.“ Dieser junge und zudem gut aussehende Gottesdiener war alles, was er heute brauchte. „Mehr noch, Pfaffe. Du musst mir sogar helfen. Ich bin bedürftig.“
Sofort bemerkte er die leichten Veränderungen im Gesicht des Geistlichen, dessen Stimme dünner wurde. „Sie haben etwas auf dem Herzen?“
„Kann man so sagen.“
„Ich nehme Ihnen gerne die Beichte ab, mein …“
„Kein Interesse.“
Nicholas verschränkte die Arme und blickte sein Opfer durchdringend an. Die Schweißtropfen auf der hohen Stirn waren nicht nur durch die Temperaturen verursacht. Sie rochen nach Nervosität.
Köstlich.
Der Mensch wich zurück, bis an die Stufen des Altarpodestes. Er spürte, dass etwas nicht stimmte. Das taten sie immer. Emotionen erfüllten die Kirche und verdrängten den Duft von gelöschten Kerzen und Weihrauch. Misstrauen, Angst und die Gewissheit, dass beides berechtigt war, breiteten sich aus. Nicholas sog den Geruch tief ein. Ein Cocktail seiner Lieblingsfrüchte.
Steh still!, befahl er mit seiner mentalen Stimme, die er im Kopf des Priesters laut werden ließ. Die Augen seines Opfers weiteten sich in Panik, aber er gehorchte. Ein schwacher Mensch. Unendlich schwach. Das machte es einfach – gab dem Dämon aber weniger Befriedigung.
„Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade“, begann der Priester stockend zu beten, „der Herr ist mit dir, du bist …“
Amüsiert hob Nicholas eine Augenbraue. „Ein Ave Maria? Wie theatralisch.“
„Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.“
Der Geistliche hob das Kreuz, das er um den Hals trug. Filigrane Linien schimmerten auf goldenem Grund und demonstrierten katholische Eitelkeit. Das Schmuckstück entlockte Nicholas ein kopfschüttelndes Grinsen.
„Spar dir deine Predigt, Pfaffe. Es ist nicht mal Sonntag.“
Erbärmlich, wie sie es immer wieder und mit allen Mitteln versuchten. Dieser Mensch hier konnte tun was er wollte. Nicht einmal eine Kalaschnikow mit Silberkugeln hätte ihm geholfen, auch wenn er damit eine schöne Schweinerei verursacht und Nicholas’ aktuellen Körper zerstört hätte. Ihn selbst jedoch nicht. Die armseligen Gebete waren vollkommen nutzlos.
Komm her!
Mit staksenden Schritten trat der Priester näher, immer noch sein Ave Maria wimmernd, obgleich die Stimme nachließ. Nicholas öffnete einladend die Arme.
Komm! Du bist schwach. Komm her und lehn dich an meine Brust.
Wie ein verängstigtes Kind schmiegte sich der Geistliche an seinen Körper, fast, als täte er es freiwillig. „Will nicht sterben“, vernahm Nicholas zwischen den gehaspelten Gebeten.
„Nicht? So wenig Vertrauen in deinen Gott?“ Sanft strich er mit den Händen durch das Haar seines Opfers, um sie in dessen Nacken ruhen zu lassen. „Auf dich wartet das Paradies. Oder hast du gar etwas auf dem Kerbholz?“
Um die Furcht zu schüren, platzierte er eine Vision in den schwachen Geist: Eine Halluzination des Jüngsten Gerichts, das kein gutes Haar an dem braven Priester ließ. Im Takt zum Schlag des illusorischen Richterhammers zuckte der Mann in Nicholas’ Armen. Dass er nicht sterben würde, verriet Nicholas ihm nicht. Warum sollte er ihm die Angst nehmen, wenn Angst doch genau das war, was der Dämon heute schmecken wollte? Er seufzte leise, während er die Emotionen in sich aufnahm. Heiß und lebendig durchströmten sie den finsteren Schatten, den er in seiner menschlichen Hülle versteckt hielt. Ließen ihn erstarken und gegen sein Gefängnis aus Fleisch und Blut aufbegehren. Doch er durfte sich nicht erlauben, seiner schützenden Maskerade zu entfliehen, sosehr sie ihn auch einengte. Außerhalb eines menschlichen Körpers war er für die Wenigen auffindbar, die ihm gefährlich werden konnten. Die Clerica.
Fordernd drängte er seinen Leib härter an den des Priesters. Die Art und Weise, mit welcher der Dämon sich nährte, erregte das Fleisch um ihn herum. Dieser sich spürbar verhärtende Umstand verursachte weitere Angst in seinem Opfer. Herrliche Angst.
„Weiche von mir, Luzifer“, jammerte der Priester, der Ohnmacht schon nahe. Er wurde schwer im Arm des Dämons.
„Luzifer nennst du mich?“ Nicholas lachte leise. „Solche Macht vermutest du in mir? Oh nein, es ehrt mich, aber dein Luzifer bin ich nicht.“
„Wer … wer bist du?“
Die Antwort sollte der Geistliche nicht mehr hören. Er brach bewusstlos zusammen. Zur Hölle, war das schnell gegangen. Besonders viel Spaß hatte er nicht geboten, dieser Schwächling. Nicht mal auf die Jungs der Kirche war heutzutage noch Verlass. Enttäuscht ließ Nicholas den Körper zwischen den Holzbänken zu Boden fallen, zog eine Schachtel Zigaretten aus der hinteren Hosentasche, schob sich eine zwischen die Lippen und ließ sein Zippo aufschnappen, um sie zu entzünden.
„Ich bin nur der Gaukler“, murmelte er, als wäre er seinem Opfer noch die Replik schuldig. „Sie nennen mich den Nybbas.“
Er verließ die Kirche schlendernden Schrittes. Am nächsten Morgen würde man den Priester finden. Ohne Erinnerung an den Dämon und vermutlich geistig verwirrt. Irrsinn oder Umnachtung hatte man es früher genannt. Heute hinterließ der Nybbas Nervenzusammenbrüche, Depressionen oder ein Burn-Out-Syndrom.
Nicht, dass es ihn interessiert hätte.
Zwei junge Männer kämpften sich durch einen dunklen Stollen. Schweigend drückten sie sich eng an den Wänden entlang, duckten sich unter Stalaktiten hindurch und drangen tiefer in den Berg ein. Im schwachen Schein ihrer Taschenlampen, die keine Schatten warfen, schimmerte der Sinter an den Höhlenwänden mal rötlich, dann wieder metallisch blau. Sie erreichten einen Schacht, der schräg in die Tiefe führte, und warfen sich verstohlene Blicke zu. Neugier und Nervenkitzel standen in ihren Gesichtern geschrieben, doch ihre Augen verrieten auch eine gewisse Furcht. Sie zwängten ihre Körper in die schmale Öffnung. Der Tunnel war eng, sodass sie nur robben konnten, viele Meter lang und voller scharfer Felskanten, die ihnen in die bloßen Hände schnitten. Sie schienen es nicht zu spüren. Immer weiter kämpften sie sich voran und hatten die Höhle am Ende des Schachtes schließlich erreicht.
Der Erste sank erschöpft auf den Boden nieder. Der Zweite, ein langer, schlanker Mann mit kurzem, braungelocktem Haar und ebenmäßigen Gesichtszügen, durchmaß mit dem Lichtkegel seiner Lampe das Innere der Höhle. Stalagnaten bildeten Gitter, schienen die Eindringlinge am Weitergehen hindern zu wollen. Dahinter stand eine verkorkte Tonflasche auf dem Boden. Der Braunhaarige streckte die Hand danach aus, berührte das Gefäß jedoch nicht. Seine Lippen bewegten sich, doch absolute Stille schien jedes Wort zu verschlingen.
Unvermittelt sprang der andere Mann auf die Füße und warf in der gleichen Bewegung einen Stein nach der Flasche, die darauf lautlos in tausend Scherben zersprang. Sodann sackte er in sich zusammen und ein gewaltiger dunkler Schatten blieb an seiner Stelle stehen. Blaues Licht leuchtete kurz um ihn herum auf.
Panische Angst erfüllte die Höhle, ließ sie erzittern und Steine von der Decke stürzen. Der Schacht nach draußen brach in sich zusammen. Der Braunhaarige konnte seinen am Boden liegenden Kameraden nur aus aufgerissenen Augen anstarren und darauf warten, dass er erschlagen wurde. Es blieb ihm noch genug Zeit, die Hände schützend über den Kopf zu heben, doch retten konnte ihn das nicht. Für einen Moment erschien eine zweite schattenhafte Gestalt, die an menschliche Umrisse mit dem Kopf einer Katze erinnerte. Dann brach die Decke ein und Finsternis verschluckte alles.
Joana erwachte von einem erstickten Laut aus ihrem eigenen Mund. Einen quälend langen Moment kämpfte sie gegen das Gefühl, nicht atmen zu können. Ihr Brustkorb war wie zugeschnürt. Um Luft ringend setzte sie sich auf und tastete mit hektischen Bewegungen nach ihrem Asthmaspray auf dem Nachttisch. Den feinen Sprühnebel tief einzuatmen verlangte ihr alle Kraft ab, doch schließlich löste sich der Knoten in ihrer Brust und das Luftholen wurde leichter. Schweiß klebte ihr das Nachthemd an den Körper und ließ sie im Zug des Deckenventilators zittern. Sie wollte nach dem Laken greifen, doch wie jedes Mal hatte der Traum eine Wirkung auf sie zurückgelassen, die ihren Körper schwer machte, ihn beinahe lähmte. Fast war ihr, als fühle sie selbst das Gewicht der Felsbrocken, die ihren Vater vor fast siebenundzwanzig Jahren unter sich begraben hatten. Die Tragödie geschah sechs Monate vor ihrer Geburt. Frederik Sievers hatte nie erfahren, dass seine Frau Mary schwanger war.
Schwerfällig verließ Joana das Bett und schlurfte barfuß Richtung Badezimmer. Sie stieß sich den Zeh an der Staffelei, die schon seit Jahren im Flur verstaubte, fluchte und gab dem Holzgestell einen Tritt. Es war fast fünf Uhr morgens, sie war nach der Spätschicht und reichlich Überstunden erst gegen zwei ins Bett gekommen und nach diesem Traum erschöpfter als zuvor. Doch Schlaf würde sie jetzt keinen mehr finden. Der Traum ließ immer das Gleiche zurück. Schweißausbrüche, Asthmaanfälle und Müdigkeit. Darüber hinaus grüblerische Gedanken, die jeden Versuch, sich zu entspannen, regelrecht verhöhnten. Sie drehten sich alle um ihren Vater, dessen Tod ihr Unterbewusstsein in so vielen Nächten zu verarbeiten versuchte, ohne dass sie es gewollt hätte. Sie hätte etliches getan, um diese Träume endlich loszuwerden. Zumal es Schlimmeres in ihrem Leben gegeben hatte. Geschehnisse, die sich für Alpträume geradezu anboten.
Den Mord an dem Mann, den sie geliebt und schließlich mit zerschmettertem Schädel in einer Leichenhalle wiedergesehen hatte.
Das Baby.
Doch weder Sascha noch sein Kind erschienen ihr des Nachts. Stattdessen träumte sie von ihrem Vater – einem Vater, den sie nie kennen gelernt hatte. Absurd.
Joana warf das feuchte Nachthemd in den überquellenden Wäschekorb und stellte sich unter die Dusche. Trotz der schwülen Sommerwärme drehte sie das Wasser so heiß auf, wie sie es eben noch ertrug und suchte Trost in der Hitze, welche jedoch die Kälte tief in ihr nicht berühren konnte.
Ihr Vater hatte Journalismus studiert. Ein Kommilitone hatte ihn eines Morgens aus dem Bett geklingelt und wenig später waren die beiden Studenten nach Niedersachsen aufgebrochen, wo in einer Tropfsteinhöhle angeblich die Entdeckung des Jahrzehnts auf sie gewartet hatte. Niemand wusste, was die Männer dort gesucht hatten. Gefunden hatten sie den Tod.
Vom Dampf wurde ihr schwindelig. Sie stützte sich an die kühlen Kacheln und lehnte das Gesicht seitlich dagegen, drehte das Wasser aber nicht kälter. Der prähistorische Boiler gab nicht lange warmes Wasser her. Sie musste nur warten, es würde schneller kalt werden, als ihr lieb war. Ihr schwarzes Haar hing nass bis auf die Hüften und schien ihren Kopf nach unten zu ziehen, so schwer war es. Überhaupt zog alles nach unten. In manchen Momenten war es so schrecklich anstrengend, aufrecht zu stehen.
Ihre Psychologin hielt das Tongefäß in ihrem Traum für die symbolisierte Büchse der Pandora, auf deren Inhalt die Männer so neugierig gewesen waren, dass sie alle Vorsicht und die Warnhinweise in den Wind geschlagen hatten. Auch für das Erscheinen der beiden schattenhaften Wesen hatte sie eine Menge psychologischer Erklärungen vor Joana ausgebreitet. Keine davon war ihr neu. Doch nichts vermochte die Intensität der grausamen Träume zu verringern. Wer waren diese Gestalten? Was war mit ihnen geschehen? Und, verdammt, warum interessierte sie das überhaupt?
Das Wasser wurde kalt und brachte Erleichterung.
2
Gegen Mittag fuhr Joana mit ihrem Taxi zu ihrer Mutter, bei der sie zum Essen eingeladen war. Obwohl sie das Taxilicht abgeschaltet hatte und damit anzeigte, dass sie nicht frei war, versuchten mehrere Passanten, sie zu sich heranzuwinken. Einige schimpften ihr ärgerlich hinterher, da sie nur bedauernd den Kopf schütteln konnte. Fahrgäste zählten nicht immer zu den verständnisvollen Menschen, doch an und für sich liebte sie ihren Job trotzdem. In ihrem Passat durch den Hamburger Verkehr zu sausen, gab ihr die Illusion von Freiheit. Das Geplauder mit ständig wechselnden Fremden war oberflächlich, aber zumindest konnte sie sich einreden, damit ihren Bedarf an Kontakten zu decken, denn privat blieben diese oftmals auf der Strecke. Natürlich gab es Menschen, die sie gerne in ihrer Nähe hatte, doch abseits ihrer Familie waren diese schon immer rar gesät. Dass sie sich nach Saschas Tod noch weiter zurückgezogen hatte und mit kaum jemandem mehr sprach, als ein Mindestmaß an Höflichkeit es gebot, hatte ihren Freundeskreis weiter dezimiert. Joana konnte nicht behaupten, dass es ihr etwas ausmachte, und gerade diese Tatsache verunsicherte sie immer wieder. Es sollte ihr etwas ausmachen. Ihre Gleichgültigkeit kratzte bereits an einer ernsten Depression.
Vielleicht hatte Sascha viel mehr von ihr mit ins Grab genommen, als sie gedacht hatte. Oder diese Teile von ihr waren einfach nur zu tief in ihrer Seele vergraben. Ironisch, dass gerade sie Psychologie studiert hatte, ehe durch den Mord an ihrem Freund ihr ganzes Leben wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen war.
Joana schnaubte, schüttelte den Kopf und verbot sich die Melancholie. Ihr Selbstmitleid widerte sie an. Saschas Tod war drei Jahre her. Es war langsam an der Zeit, den Trauerschleier abzulegen und wieder klar zu sehen. Sie musste es wenigstens versuchen.
Um den guten Vorsatz, den sie schon so oft getroffen hatte, nicht gleich wieder mit einer Ausrede zu umschiffen, griff sie an der nächsten roten Ampel nach ihrem Handy und schickte eine SMS an ihren Kollegen Benedikt, in der sie ihn fragte, ob die Einladung fürs Kino noch galt. Nach dem Senden überlegte sie sich, wie lange es her war, dass Ben sie eingeladen hatte. Ein bis zwei Monate bestimmt. Ein Autofahrer hinter ihr hupte. Joana schüttelte die Gedanken ab und gab Gas.
Als sie beim Haus ihrer Mutter ankam, stand die Tür schon weit offen. Ein Zeichen, dass Mary in ihrer Küche beschäftigt war und die Speisen ihr selbst einen kurzen Gang zur Tür nicht verzeihen würden. Joana klopfte anstandshalber, wartete aber keine Reaktion ab. In der Küche wunderte sie sich über das bunte afrikanische Gewand und das passende Kopftuch, das ihre Mutter beim Kochen trug. Wenn Mary die traditionelle Kleidung aus der Heimat ihrer Eltern aus dem Schrank holte, konnte das nur bedeuten, dass ihre Schwägerin, Tante Agnes, zu Besuch war. Diese sollte mit möglichst viel afroamerikanischer Kultur provoziert und wieder vertrieben werden.
Mary hatte Afrika nie betreten. Sie war in New York aufgewachsen, wo sie Joanas Vater bei einer seiner Reisen kennen und lieben gelernt hatte. Die beiden hatten nicht lange gefackelt und wenige Wochen später in den Staaten geheiratet. Sehr zum Missfallen von Joanas Großvater – ihr Vater war prompt enterbt worden.
„Hi Mama.“ Mit einem inneren Seufzer drückte sie ihrer Mutter einen Kuss auf die Stirn und warf einen kurzen Blick ins Wohnzimmer.
„Deine Tante ist im Bad“, grummelte Mary, tätschelte ihr zur Begrüßung die Hüfte und schob sie auf die Seite, um sich wieder dem Herd zuzuwenden.
Joana unterdrückte den Impuls die Augen zu verdrehen und machte sich wortlos daran, den Tisch zu decken. Warum nur war es nicht möglich, dass zwei Frauen, die durch gemeinsame Familie verbunden waren, normal miteinander redeten. Wenn der Kontakt für beide unzumutbar war, warum gingen sie sich dann nicht einfach aus dem Weg? Aber nein, Agnes lud sich immer wieder ein, und Mary biss die Zähne zusammen, lächelte und kochte. Für Agnes; sowie innerlich.
„Joana! Schätzchen, lass dich drücken!“
Die Begrüßung ihrer hereineilenden Tante war wie immer überschwänglich, Joana fielen fast die Teller aus der Hand. Nach der stürmischen Umarmung schob Agnes sie ein Stück zurück und der Blick scharfer, grüner Augen glitt musternd an ihr auf und ab. Ein fast schon rituelles Verhalten, das Joana immer wieder einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Im Gegensatz zu ihrer Mutter liebte Joana ihre Tante – aber sie konnte den Umstand nicht ganz von sich weisen, dass diese ihr auch ein wenig unheimlich war. Man konnte Agnes nicht in die Augen sehen, ohne das Gefühl zu verspüren, sein Innerstes zu offenbaren und viel mehr von sich preiszugeben, als man wollte. Die Tatsache, dass Agnes grundsätzlich die falschen Fragen stellte – oder genau die richtigen – tat ihr übriges.
„Wie geht es dir? Was machen die Träume, Kind?“
Joana wusste, dass sie Agnes nicht belügen konnte. Zu oft war das schon schiefgegangen. „Wie immer.“
Agnes’ Fingerspitzen berührten den haselnussgroßen Bernstein, den sie an einer Kette um den Hals trug. In seinem Inneren schimmerte etwas Bräunliches. Schon als Kind hatte Joana sich gefragt, was es wohl war, doch ihre Tante hatte immer nur gelächelt, wenn sie sie darauf angesprochen hatte.
„Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen, Schätzchen“, tadelte Agnes und Joana musste zugeben, dass sie recht hatte.
Fast ein Jahr war seit ihrem letzten Treffen vergangen, dabei lebte Agnes in Schwerin, was keine zwei Stunden Fahrt bedeutete. Sie fragte sich, wann das lockige Haar ihrer Tante so stark ergraut war. Ihr war, als hätte Agnes beim letzten Treffen noch dunkelbraunes Haar gehabt.
Als Mary mit dem Essen den Raum betrat, war Joana dankbar für die Ablenkung und beeilte sich, den Tisch fertig zu decken.
„Eine afrikanische Spezialität“, stellte Mary klar, als alle am Tisch saßen.
Ob sie Agnes anlächelte oder ihr die Zähne zeigte, vermochte Joana nicht zu sagen. Um kein betretenes Schweigen entstehen zu lassen, mimte sie während des Essens wie üblich den Alleinunterhalter. Sie ließ ein paar Anekdoten ihrer Fahrgäste verlauten, regte sich gekünstelt über ihre neugierige Nachbarin auf, lobte das Hühnchen und flüchtete sich schließlich in nahezu verzweifelte Bemerkungen über das Wetter. Es war lächerlich.
Ihre Mutter rollte ihr Elfenbeinamulett zwischen den Fingern und strahlte dabei Provokation in solcher Penetranz aus, dass man es fast riechen konnte.
Agnes setzte dem ihre stoische Gelassenheit entgegen. Sie lächelte falsch über den Rand ihrer Brille, ließ ihren Blick immer wieder abfällig über jede unordentliche Ecke in dem gemütlichen Wohnzimmer schweifen und tat gar nicht erst so, als würde sie sich wohlfühlen.
Ein stummes Kräftemessen. Joana war dieses Verhalten seit ihrer Kindheit vertraut. Ebenso lange empfand sie es schon als albern und unnötig.
Ihre Mutter war der festen Überzeugung, dass Agnes sie nie als gut genug für Frederik befunden hatte und machte das an ihren afrikanischen Wurzeln fest. Agnes dagegen fühlte sich vom versteckten Vorwurf des Rassismus beleidigt. Keine der beiden Frauen war zum Gespräch bereit. Joana vermutete, dass sie ihre Antipathien über die Jahrzehnte hinweg so liebgewonnen hatten, dass sie gar nicht mehr willens waren, sie je abzulegen. Wer von beiden im Recht war, wagte sie nicht zu beurteilen. Dass Agnes Mary nicht respektierte war offensichtlich, aber Joana weigerte sich, dies an der Hautfarbe festzumachen. Sie hatte schließlich auch keinerlei Probleme mit Agnes. Als Mischlingskind besaß sie eine nicht ganz so dunkle Haut wie ihre Mutter. Mit ihren tiefbraunen, großen Augen und der wellenähnlichen Linie, die Stirn, Schläfe, Wange und Kinn modellierte, war sie Mary dennoch wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch die Neigung, jedes Stück Schokolade auf den Hüften wiederzufinden, hatte ihre Mutter ihr dankenswerterweise vererbt. Das Erbgut ihres Vaters hatte lediglich dafür gesorgt, dass sie Mary um einen knappen Kopf überragte. Auch ihre Liebe zur Musik und schnellen Autos schrieb man Frederik Sievers zu. Joana seufzte lautlos und verbot sich die Frage, was er ihr ansonsten noch überlassen haben könnte. Vielleicht den Hang, in sinnlose Überlegungen abzuschweifen.
Wie es ihre Art war, fuhr Agnes gleich nach dem Dessert wieder nach Hause. Die Tür war noch nicht ganz zu, da riss sich Mary schon das Tuch vom Kopf und seufzte erleichtert.
„Ich bete den Herrn auf Knien um den Tag an, an dem sie uns leid sein wird.“
Joana schnalzte missbilligend mit der Zunge. „Du könntest ihr einfach sagen, dass du keine Lust auf ihre Besuche hast.“
„Das könnte ich wohl.“ Marys Stimme war tonlos und ließ erkennen, dass es nicht so einfach war, wie Joana es gern hätte.
„Wirklich, Mama, ich meine es ernst. Agnes kann auch mal zu mir zum Essen kommen, oder ich besuche sie. Mir will nicht in den Kopf, warum wir uns immer bei dir treffen müssen, wenn dir das zuwider ist.“
Mary setzte zu einer Antwort an, schloss den Mund aber gleich wieder und rieb sich die Stirn. Für einen Moment wirkte sie bekümmert und sah viel älter aus, als sie war. Dann schüttelte sie den Kopf und das Lächeln, das Joana so liebte, legte sich auf ihre Züge.
„Vergessen wir es einfach. Erfahrungsgemäß meldet sie sich jetzt monatelang nicht. Komm, lass uns mal schauen, wie viel wir vom Nachtisch noch runter bekommen, ohne dass uns schlecht wird.“
„Herr Nyrr?“ Die monotone Stimme seiner Sekretärin Christina ließ Nicholas von seiner Zeitung aufsehen. „Die Testergebnisse sind da.“
Er hätte gern an ihrer Reaktion erkannt, ob die Berichte mehr versprachen als die letzten, aber in ihrer Miene zeigte sich schon lange keine Regung mehr. Es ging ihm auf die Nerven, auch wenn ein Teil von ihm, den er der Tarnung wegen auf menschliche Empfindungen trainierte, wusste, dass er daran nicht unschuldig war. Sie war nur noch eine leergekratzte Hülle. Alles, was an ihr gelockt hatte, war ihr längst entzogen. Ihr anziehender Körper erinnerte ihn penetrant an das kraftvolle Temperament, das er von ihr bekommen hatte. Immer und immer wieder, und schließlich ein Mal zu oft. Süß war sie gewesen, so schrecklich süß in ihrer wilden Hingabe, ihrer Leidenschaft und ihrer Angst. Es ärgerte ihn, dass von dieser Süße nichts zurückgeblieben war. Er hatte ihr Inneres vollkommen ausgesaugt. Der Rest von ihr war zu einer braven, langweiligen Arbeitskraft aus menschlichem Gewebe geworden. Seine Inane. Eine Eingeweihte, die sein Geheimnis kannte. Inanen waren so leer, gleichgültig und gehorsam, dass sie kein Risiko darstellten. Sie waren Sklaven. Zu allem zu gebrauchen, nur nicht, um den Hunger zu stillen.
Nicholas zog die Akte aus dem Umschlag, lehnte sich in seinem Ledersessel zurück und überflog die Testergebnisse.
Niederlage. Viel mehr stand nicht drin. Dreck nochmal! Die von Meyers Pharmazeutika entwickelte Droge hatte mal wieder versagt.
„Kaffee“, knurrte er frustriert und Christina machte sich auf, das Verlangte zu holen. Er zog das Handy aus der Tasche und wählte Alexander Meyers’ Nummer. Alex war sein Boss. Einerseits in diesem albernen Pharmakonzern, den sie zunächst nur an sich genommen hatten, um durch den Verkauf von Migräne- Tabletten, Anti-Baby-Pillen und sonstigem Mist, den Menschen brauchten, einen angenehmen Lebensstandart sicherzustellen. Außerdem musste ihre Suche nach den anderen finanziert werden. Archäologische Ausgrabungen hatten ihren Preis. Auf die Idee, Drogen zu entwickeln, die Menschen gefügig machten, ohne dass sie dabei ihre nahrhaften Emotionen verloren, waren sie erst kürzlich gekommen.
Andererseits war Alexander auch außerhalb des Pharmakonzerns sein Befehlshaber. Er stand im Rang schlichtweg über ihm.
„Nicholas?“, meldete sich Alex nach schier endlosem Klingeln. „Was willst du? Ich bin beschäftigt.“
„Nur ein kurzer Lagebericht, reg dich ab. Die neusten Tests waren absoluter Dreck. Ich hatte gleich gesagt, dass wir das Adrenalin nicht noch höher dosieren dürfen. Acht von zehn Testobjekten hatten ‘nen Herzkasper. Die sterben wieder wie die Fliegen. Verdammt, jetzt brauchen wir schon wieder neue!“
Alex lachte gleichgültig. „Dein Problem, Kleiner. Von mir aus kannst du das ganze Projekt abblasen. Oder versuch’s nochmal. Du hattest doch noch eine alternative Rezeptur in petto. Mach halt einen weiteren Test, wenn’s dir so wichtig ist.“
„Du hast leicht reden.“ Das hatte er, fürwahr. Der Dämon in Alexander Meyers’ Hülle war der Whiro. Ein Wesen, das Krankheiten über Menschen brachte und sich von deren schwindender Gesundheit nährte. Seine Energiebeschaffung war wesentlich unauffälliger als die von Nicholas oder Lillian, der Dritten in ihrem Bunde. Er hatte so verdammt leicht reden.
Nicholas schluckte seinen Ärger hinunter. Es war nicht klug, Alexander gegenüber das Temperament durchgehen zu lassen und ihn damit zu beleidigen. Zumindest nicht, wenn man ihn nicht gegen sich stehen haben wollte, was wiederum äußerst dumm wäre. „Wie läuft die Ausgrabung?“, wechselte er das Thema. „Habt ihr weitere Hinweise gefunden?“
„Noch nicht.“
Nicholas spürte Unbehagen durch seinen Körper kriechen. Auch wenn ihn ein Ozean von seinem cholerischen Boss trennte, spürte er dessen Wut. Also verabschiedete er sich höflich und drückte das Gespräch weg.
Der Whiro war ein mächtiger Dämon. Und mächtig leicht reizbar. Vor allem, wenn er sich Misserfolgen gegenüber sah. Doch verglichen mit denen, die alle niederen Dämonen in Asien, Afrika und Amerika befehligten, war auch er nur ein Wurm. Eine Tatsache, die Alexander schier wahnsinnig zu machen schien. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, einen der legendären, gebannten Höllenfürsten zu finden und zu befreien, um an seiner Seite zu einem mächtigen Herrscher zu werden. Sein Plan lautete, das gesamte dämonische Volk Europas zu vereinen, wozu er auf die Hilfe eines Fürsten angewiesen war. Bislang war seine Suche erfolglos gewesen. Er hatte nur Nicholas, Lillian und zwei weitere, niedere Dämonen aus dem Bannschlaf befreien können.
Die aktuelle Ausgrabung in Wales hatte Hinweise darauf versprochen, endlich einen entscheidenden Fund zu machen. Nicholas hoffte, Alexander würde dort etwas finden. Ansonsten sollten die kommenden Monate hart für ihn werden. Höllisch hart.
3
Eine Tour am späten Abend zwang Joana in einen Randbezirk von St. Georg, in dem die meisten Menschen sich schon am Tag unwohl fühlten. Außer einigen, größtenteils von Punks besetzten Häusern und einem halbverfallenen Fabrikgebäude, hatte der Straßenblock nichts zu bieten. Die Gegend galt als beliebter Sammelpunkt für diejenigen, die nach den Vergnügungen der Reeperbahn lechzten, aber nicht einen Bruchteil von deren Preisen zahlen konnten.
Der Fahrgast war ein nervöser Kerl, der heftig schwitzte, säuerlich stank und permanent mit den Lippen zuckte. Er drehte sich nach jedem Scheinwerfer und jedem Fußgänger auf der Straße um. Drogen, vermutete Joana. Vielleicht ein Dealer, der seinem eigenen Stoff nicht abgeneigt war. Er machte sie nervös. Warum hatte sie sich immer noch kein Pfefferspray besorgt?
Dass der Typ die Fahrt anstandslos zahlte, überraschte sie. Er lächelte sie kurz an und sie glaubte, der Geruch seiner faulenden Zähne würde in die Polster ihres Wagens dringen. Sie war heilfroh, als er endlich ausstieg. Die Uhr zeigte 23:05. Ihre Schicht war schon seit einer Stunde offiziell beendet. Sie loggte sich aus dem Zentralcomputer aus, schaltete das Radio an und gab Gas.
Nach etwa fünfzig Metern fiel ihr am linken Straßenrand eine Gestalt unter einer flackernden Straßenlaterne auf. Der Mann war in seiner dunklen Hose und dem modernen weißen Kurzarmhemd für diese Gegend viel zu gut gekleidet. Schwarzes Haar reichte ihm über die Ohren und eine Strähne fiel vor sein zu Boden geneigtes Gesicht. Als ihr Passat auf seiner Höhe war, blickte er auf und sah sie an. Der Augenkontakt dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, aber er reichte aus, um Joana wissen zu lassen, dass dieser Mann im schlimmsten Viertel der Stadt absolut nichts zu suchen hatte. Er wirkte deplatziert, sein Blick schien ihr nahezu verloren. Für einen Moment überlegte sie, anzuhalten und zu fragen, ob er ein Taxi bräuchte, verwarf den Gedanken aber wieder. Er würde schon seine Gründe haben, gerade hier spazieren zu gehen. Und seit wann sah man Menschen ihre Gesinnung schon auf den ersten Blick an?
Im Rückspiegel verfolgte sie, wie er ihr nachsah, sich dann umdrehte und die Straße zurück schlenderte. Joana schüttelte den Kopf und hätte den Mann vergessen, wenn ihr nicht im nächsten Moment eine zweite Person ins Auge gefallen wäre. Der Anblick brachte sie dazu, alle Fenster hochzulassen, auf die Bremse zu treten und sich umzudrehen. Ein weiterer Mann versteckte sich hinter den Betonpfeilern einer Hofeinfahrt. Die Augen verbarg er trotz der Dunkelheit hinter einer Sonnenbrille. Eng drückte er sich an die Mauer und beachtete Joana in ihrem Taxi nicht, sondern blickte dem anderen Mann nach, ohne dass dieser ihn hätte sehen können.
Sie war nicht sicher, aber sie glaubte, das Blitzen eines Messers wahrgenommen zu haben. Wurde sie jetzt hysterisch?
Sie verbarg sich hinter ihrem Sitz und beobachtete, wie der Mann seine Kapuze über den Kopf zog, sich hastig umsah und dann in raschen Schritten hinter dem anderen hereilte, der soeben um eine Ecke bog. Dort führte eine Sackgasse zu einem leer stehenden, mit Brettern verrammelten Supermarkt. Man hatte den Bau längst abreißen wollen. Ansonsten gab es da nichts. Vor allem keine Zeugen.
Sie griff nach ihrem Handy und hatte die erste Zahl schon gewählt, als ihr klar wurde, wie albern es wäre, jetzt die Polizei anzurufen. Die würden sie nicht ernst nehmen, schließlich war überhaupt nichts passiert. Noch nicht. Sie sollte weiterfahren. Es war dumm, nein, es war abgrundtief dämlich, in Gegenden wie dieser die Nase zu tief in die Angelegenheiten fremder Leute zu stecken. Andererseits war da diese düstere Vorahnung.
Wenn sie morgen im Radio erfuhr, dass hier etwas passiert war, würde sie sich Vorwürfe machen. Zu recht. Verdammt.
Sie legte den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Eine rot-weiße Absperrschranke verhinderte, dass Fahrzeuge in die Straße einfuhren, in der die Männer verschwunden waren. Joana konnte ein ganzes Stück weit sehen, aber da war niemand. Die Männer waren … weg.
„Shit“, flüsterte sie. „Gar nicht gut.“ Ihr Mund wurde trocken. Die Straße war wie ausgestorben. Nur in einem nahen Café flackerten Lichter hinter den Fenstern.
Weiterfahren. Der kleine Teil von ihr, dem Sicherheit das höchste Gut war, sprach zu ihr. Doch der Rest hatte schon entschieden, etwas völlig anderes zu tun.
Sie parkte ihren Wagen am Straßenrand. Es war der Wunsch zu helfen, redete sie sich ein. Eine gewisse Sorge um diesen Mann, der so unschuldig ausgesehen hatte. Vielleicht die Tatsache, dass sie seit Jahren auf Menschen fluchte, die in solchen Situationen einfach weitergingen. Wie viele hatten wohl registriert, dass Sascha in Schwierigkeiten gewesen war? Wie viele mochten weitergegangen sein, die Intuition verleugnend, die sich ihnen aufgedrängt hatte? Sascha könnte noch leben, wenn jemand einen Blick riskiert hätte.
Aber möglicherweise trieb sie auch etwas ganz anderes aus ihrem Wagen. Der Drang, sich durch den Nervenkitzel endlich wieder lebendig zu fühlen.
Zu lange schon versank sie in Gleichgültigkeit. Jetzt, in diesem Moment, spürte sie ihren dröhnenden Herzschlag so intensiv, als hätte sie ihn seit Jahren nicht mehr wahrgenommen. Er pulsierte bis in ihre Fingerspitzen und machte ihr unmissverständlich klar, dass sie lebte. Leben wollte. Es fühlte sich gut an. Sie wollte mehr davon. Klar war das leichtsinnig – und wenn schon.
Mit fahrigen Bewegungen verriegelte sie ihr Taxi und steckte Handy, Autoschlüssel und ihr Asthmaspray in die Taschen ihrer Cargohose. Dann huschte sie über die Straße und ging die Gasse entlang. Nur zwanzig Schritte, entschied sie. Wenn ihr bis dahin nichts verdächtig vorkam, könnte sie guten Gewissens wieder fahren.
Nach mehr als zwanzig Schritten blieb sie stehen und lauschte. Nur die Geräusche einer vielbefahrenen Straße lagen in der Luft. Irgendwo bellte ein Hund, in weiter Entfernung vernahm sie grölendes Lachen. Sie zählte weitere zwanzig Schritte ab. Nichts.
War da ein Rascheln? Sicher nur Ratten.
„Hallo?“
Sie hatte rufen wollen, doch aus ihrem Mund kam nur ein Flüstern. Das T-Shirt klebte ihr inzwischen schweißnass zwischen den Schulterblättern. Verdammte Hitze. Zu allem Überfluss fröstelte sie dennoch und bemerkte, wie sich ihre Brustwarzen unangenehm auffällig unter dem dünnen, schwarzen Stoff abzeichneten.
Nein, hier war niemand. Mit verschränkten Armen drehte sie sich um und eilte zurück zu ihrem Wagen. Dabei beobachtete sie, wie ihr Schatten vor ihr den Gehweg entlang floss und schwächer wurde, bis er unter der nächsten Laterne für einen Moment verschwunden war. Als er nach ein paar Schritten wieder vor ihr auftauchte, erschien dicht daneben ein zweiter, größerer Schatten.
Für einen Augenblick konnte sie nicht atmen, dann fuhr sie herum, gleichzeitig nach dem Handy sowie dem Asthmaspray greifend. Ein Vibrieren hallte durch ihre Knochen, wie nach einem Stromschlag.
Vor ihr stand der Mann mit den schwarzen Haaren.
Er war viel größer, als sie ihn eingeschätzt hatte und sah kein bisschen hilflos mehr aus. Die Arme hatte er verschränkt und seine Muskeln spielten provokant unter der Haut und den Ansätzen einer Tätowierung, die sie an der Innenseite des rechten Unterarms erahnen konnte.
„Ich wollte dich nicht erschrecken.“ Seine Stimme war leise und ein wenig rau, die Worte unaufrichtig.
Joana biss die Zähne zusammen, damit sie nicht zu klappern begannen. „Das ist Ihnen ja wunderbar gelungen“, presste sie hervor.
Er zog einen Mundwinkel zu einem selbstgefälligen Lächeln hoch. „Verzeihung.“
Himmel, wie hatte sie eben noch denken können, er sähe verloren aus? Er blickte auf sie herab, wie die Schlange auf das Kaninchen. Dass er dabei nahezu verboten gut aussah, schmälerte die bedrohliche Aura, die ihn zu umgeben schien, in keiner Weise. Seltsam war, dass sie keine Angst hatte. Sie war fast zu Tode erschrocken, aber nun wurde sie mit jedem Herzschlag gefasster. Der Schreck ließ nach und wich einem Gefühl, das sie entfernt an trotzigen Widerstand erinnerte.
„Was wollen Sie?“ Joana wunderte sich, wie ruhig und fest ihre Stimme war. Ihre Finger schlossen sich in ihrer Hosentasche um das Asthmaspray.
„Gar nichts.“
Klar. Und genauso wenig Wahrheit lag in seinen Zügen. Sein Grinsen war so falsch wie schön. Vielleicht könnte sie ihn mit ihrem Spray täuschen. Wenn sie schnell genug war, glaubte er sicher, es würde sich um Reizgas handeln. Die Ablenkung könnte ihr ein paar Meter bringen, wenn sie flüchten musste. Zum Auto oder in dieses Café.
Sein Blick erfasste die Bewegung ihrer Hand. „Muss ich Angst haben, dass du eine Waffe ziehst?“
Sie versuchte, das arrogante Grinsen zu erwidern „Hättest du das denn verdient?“
Seine Augen zuckten für einen Moment. Im Zwielicht konnte sie nicht mehr erkennen, als dass sie dunkel waren. Er neigte den Kopf leicht zur Seite. „Touché.“ Sein Lächeln wurde ehrlicher.
Verwirrt suchte Joana nach Worten. Mit einem Mal schien er die unheimliche Art abgelegt zu haben. Entweder hatte sie Gespenster gesehen, oder er spielte ihr etwas vor. Bis eben hatte sie ihn für Mitte dreißig gehalten, doch nun war sie nicht mehr sicher. Mit diesem sanften Gesichtsausdruck würde er auch als zehn Jahre jünger durchgehen.
„Bist du mir deshalb gefolgt?“, fragte er. „Weil ich es verdient habe?“
Ein Schauer lief ihren Rücken hinab. Hatte er gerade zugegeben, es verdient zu haben, mit einer Waffe bedroht zu werden?
„Nein.“ Sie musste sich räuspern. „Ich bin dir gefolgt, weil … weil da ein weiterer Mann war. Er ist dir nachgeschlichen. Ich wollte nur sehen, ob alles okay ist.“
Sie rechnete damit, dass er sie als dumm, leichtsinnig oder unvorsichtig schimpfen würde. Doch er murmelte: „Interessant“, und rieb sich das glattrasierte Kinn. Sein Blick bekam etwas Abschätzendes und glitt ihren Körper hinab. Sie fühlte sich begutachtet wie ein Stück Fleisch, dennoch straffte sie unweigerlich die Schultern und zog den Bauch ein. Er lachte leise. Ein Geräusch, das die Luft zu bewegen schien und auf ihrer Haut zu spüren war. „Selbstbewusst und ganz schön mutig. Das gefällt mir.“
Die Worte schmeichelten ihr nicht, sie mahnten zur Vorsicht. „Ich muss zurück zu meinem Taxi. Wenn ich in zwei Minuten keine Meldung gebe, schickt meine Zentrale die Polizei.“
„Und nicht unvernünftig.“ Offenbar hatte er beschlossen, eine Bestandsaufnahme aller Eigenschaften durchzuführen, die sie ihm vorgaukelte. „Schön, tu das. Und dann gehen wir etwas trinken.“
Nein, ganz sicher keine Gespenster. Unbehagen formte einen Kloß in ihrer Kehle. Das war keine Einladung. Keine Bitte. Nicht mal ein ungehobelter Flirtversuch. Es war eine Anweisung.
„Bitte? Was lässt dich denken, dass ich das möchte?“, erwiderte sie, sich bewusst, dass sie zu lange gezögert hatte. „Leider habe ich keine Zeit.“
Er machte einen Schritt vor und das Licht der Laterne erreichte seine Augen. Tiefes Blau, dunkles Grau und vereinzelte weiße Schaumkronen vermischten sich in ihnen. Wie das Meer bei einem Unwetter. Eiskalt. Er verengte die Augen und die Sturmfarben schienen düsterer zu werden. Gleichzeitig berührten seine Fingerspitzen ihren Unterarm und jagten einen elektrischen Impuls durch ihren Körper, der ihr die Knie weich werden ließ. Ob aus Furcht, Nervenkitzel oder einer völlig unangebrachten Erregung heraus, konnte sie nicht sagen. Es kribbelte in ihren Schläfen, in ihren Armbeugen und an sensibleren Stellen ihres Körpers.
„Ich möchte es“, sagte er schlicht. „Du hast Zeit.“
Sie spürte sich nicken, als wäre diese Reaktion nichts weiter als eine logische Konsequenz auf die Selbstverständlichkeit, mit der er sie gerade gewaltsam von sich eingenommen hatte.
Der Schatten in Nicholas’ Körper ächzte. Verdammt, diese Frau war eine harte Nuss. Er hatte alle Macht, die ihm in menschlicher Hülle zur Verfügung stand, aufbringen müssen, um nur eine einzige, banale Zusage zu erzwingen. Der verwirrte Ausdruck in ihren braunen Augen entlockte ihm fast ein Lachen. Er hatte seinen kleinen Köder doch wieder einmal an richtiger Stelle ausgeworfen. Frauen mit Mut waren leicht zu locken. Ein Augenaufschlag á la junger Hund und die Vision vom hilflosen Schönling, der vor dem Bösen gerettet werden muss. Es funktionierte immer wieder.
Er nickte ihr aufmunternd zu und sie gingen zu ihrem Taxi. Schon spürte er, wie sich erneuter Widerstand in ihr regte. Immer wieder strich sie sich nervös durchs Haar und entblößte damit kurz ihren Nacken. Eine Gänsehaut überzog die karamellbraune Haut und er stellte sich vor, wie sich diese unter seinen Lippen und seiner Zunge anfühlen würde. Nicht nur der Schatten hatte Gefallen an ihr gefunden. Vorfreude auf ihre Emotionen und auf ihren Körper brannte in seinen Lenden.
Oh ja, es würde eine echte Herausforderung darstellen, mehr von ihr zu bekommen. Ihr Geist verfügte über einen stahlharten Schutz, vielleicht einen der effektivsten, den er je bei einem Menschen erlebt hatte. Diese Härte bildete einen interessanten Kontrast zu den weichen Konturen ihres Hinterteils und der verführerisch vorgeschobenen Unterlippe.
„Wie heißt du?“
Ihre Stimme war wieder fest, sie schien ihr Selbstvertrauen wiederzufinden. Das gefiel ihm. Er würde es erneut niederreißen.
„Nenn mich Nicholas.“
„Joana.“
Ihr Arm zuckte, als hätte sie den Wunsch verspürt, ihm die Hand zu reichen und ihn im gleichen Moment verworfen. Das Chaos ihrer Emotionen war göttlich, nur leider viel zu kurz. In Sekundenschnelle hatte sie ihre Gefühle wieder hinter ihrem stählernen Wall verborgen.
Aus großen Augen warf sie ihm einen Seitenblick zu. Scheu und Misstrauen waren darin zu lesen, aber er konnte die Emotionen nur visualisieren, nicht greifen. Sie war erfüllt von einer Vielzahl an Gefühlen. Er witterte Euphorie, Leidenschaft, tiefen Kummer und bitterscharfe Verzweiflung. Sie hatte alles, was er wollte. Alles, was er brauchte, in schier unglaublicher Intensität. Leider auch unerhört gut geschützt. Doch das machte es nur interessanter, denn wahre Herausforderungen hatte er ebenso nötig wie Emotionen. Und sie waren ungleich schwieriger zu bekommen.
„Da vorn ist ein Café“, meinte sie. „Wenn du darauf bestehst, können wir dorthin gehen.“
Roch er Resignation? „Musst du dich nun doch nicht in deiner Zentrale melden?“
„Schon okay.“
Sie zuckte mit den Achseln, teilte ihre Haare im Nacken und ließ sie vorn über ihre Schultern fallen. Ihre schwarzen Locken waren schön, aber die Spitzen ihrer Brüste unter dem T-Shirt waren schöner. Er strich ihr das Haar wieder nach hinten und sie zuckte zurück, als er ihren Hals berührte. Das bisschen Angst in ihr roch gut. Aber noch viel köstlicher war der feine Hauch von Erregung, der mitschwang. Lust war nicht so einfach zu bekommen wie Angst. Das machte sie zu etwas Besonderem.
4
Café Absurd stand treffenderweise in verschnörkelten Lettern über der Eingangstür, auf der Getränkekarte und auf der Bluse der Bedienung. Joana gab sich Mühe, nicht albern zu kichern und umklammerte ihr Colaglas. Nicholas war ihr unheimlich, sie konnte es nicht anders sagen. Gleichzeitig fühlte sie sich nicht in der Lage, auch nur einen Moment nicht in seine Richtung zu sehen. Er beschränkte sich darauf, ihr gegenüber zu sitzen. Den Ellbogen hatte er lässig aufgestützt und das Kinn locker auf der Faust abgelegt. Ohne dass er sich bewegte, schien seine Präsenz das ganze Café auszufüllen, und den anderen Gästen die Luft knapp werden zu lassen. Joana bemerkte, dass sie nicht die Einzige war, die ihre Augen nicht von ihm abwenden konnte. Selbst die Männer sahen ihn an.
Mit seinem Atem ließ er die Flamme der Kerze tanzen, die zwischen ihnen auf dem Tisch stand. Er hatte es nicht nötig, zu sprechen. Seine kühlen Augen fixierten ihre Lippen, wenn sie sie bewegte oder glitten Zentimeter für Zentimeter den Ausschnitt ihres T-Shirts entlang. Er schien ihre Brüste allein durch Blicke zu seinem persönlichen Eigentum zu erklären.
Obwohl ihr ein ‚Nicht mit mir, Freundchen‘ mehrmals durch den Kopf ging, konnte sie eine gewisse Wirkung auf sich nicht leugnen, so gern sie es auch getan hätte. Jedes Mal, wenn er hinter dichten Wimpern träge blinzelte, kribbelte es tiefer in ihrem Magen.
Smalltalk schien ihn nicht zu interessieren, er stellte auch keine Fragen. Als sie sich nach seinem Beruf erkundigte, antwortete er mit dem einzelnen Wort: „Pharmaindustrie“. Dann streckte er die Hand über den Tisch und griff nach ihrer. Sie wollte sie zurückziehen, sie kannte ihn schließlich überhaupt nicht, er war ihr nicht mal sympathisch. Was fiel ihm eigentlich ein? Doch er war schneller und hielt ihr Handgelenk fest.
„Das ist okay“, stellte er klar und fuhr mit den Fingerspitzen über ihren Puls. „Ich mag das gern.“
Sie ließ es geschehen und wusste nicht, warum. Ohne hinzusehen verfolgte sie mit ganzer Konzentration jeden Kringel, jeden Kreis und jede Schleife, die er auf ihre Haut zeichnete. Seine Berührungen gaben ihr das Gefühl, als brannten sie sich in ihr Fleisch, als würden sie sichtbare Narben hinterlassen.
Ein Mann am Nebentisch beobachtete mit geöffnetem Mund jede Bewegung von Nicholas’ Fingern auf ihrer Haut. Sie schlug den Blick nieder. Oh Shit, er hatte auch noch schöne Hände. Kräftig aber elegant. Kein Ring.
Das Schweigen wurde ihr zunehmend unangenehmer, kaum mehr auszuhalten.
„Was machst du in deiner Freizeit?“ Ihre Stimme klang eine Oktave höher als üblich. Er brachte sie definitiv aus der Fassung, daher beschloss sie, die Fassade einer normalen Konversation zu errichten.
„Was glaubst du?“
Da sie ihm nicht mehr auf die Hände, aber noch viel weniger in die Augen sehen wollte, fiel ihr Blick auf seinen Oberkörper. Eine ganz tolle Idee, für die sie sich am liebsten geohrfeigt hätte. Muskulös war er, aber nicht auf bullige Art und Weise. Definitiv sportlich.
Leider war ihm dieser Blick nicht entgangen, er lächelte zufrieden, ließ aber endlich von ihr ab, legte die Arme mit den Handflächen nach oben gerichtet auf den Tisch und entblößte somit das Geheimnis um das Tattoo auf seinem Unterarm. Kryptische, ineinander verschlungene Zeichen zierten die Haut von der Ellenbeuge bis zum Puls. Sie erinnerten Joana an in blauen Flammen stehende Buchstaben, doch die Schrift war ihr unbekannt. Die Farbe schien der seiner Augen nachempfunden zu sein.
„Nordic Walking?“
Die Frage nach der Bedeutung der Tätowierung brannte intensiver und sie rang mit sich selbst, es anzusprechen.
„Ich mag das Wasser.“
Ihr drängte sich der Verdacht auf, dass seine Worte keine Antwort auf die Frage waren. Eher schien er ihr Interesse an dem Tattoo zu durchschauen und sie damit aufzuziehen.
„Okay, dann … Wassertreten und Entenfüttern.“ Aus dem Augenwinkel nahm sie ein amüsiertes Blitzen in seinen Augen wahr. Ihr Blick klebte auf den blauen Zeichen. Flammen, Wellen … oder beides?
Sie gab sich sichtlich Mühe, es sich nicht anmerken zu lassen, doch ihr Blick folgte jeder seiner Bewegungen. Er spielte mit dem Löffel in seinem Kaffee, als würde sie ihn nervös machen, und spürte, wie sie sich langsam entspannte und ihr Schutz nachließ. Das erste Gefühl, das sie ungehindert ausströmen ließ, war Neugier. Neugier, die er haben wollte, und die seine Geduld auf die Probe stellte. Sie ließ den Schatten in ihm aufbegehren, das ganze Spiel zu beenden und sogleich zu nehmen, wonach ihm dürstete. Anmerken ließ er sich das nicht. Jetzt mit Gewalt ihre Emotionen zu verschlingen, würde er später bereuen. Zu viel würde er sich selbst damit verwehren, wenn er sie überwältigte und sich allein an ihrer Angst satt tränke.
„Ich möchte dich nach Hause begleiten“, sagte er.
Unvermittelt spannte sie die Hände an und presste die Lippen aufeinander.
„Nein danke!“ Kälte gab ihrer Stimme einen Klang wie Kristall. Auf sein Lachen hin kniff sie die Augen zusammen und entließ Ärger in die Luft. „Du denkst wohl, mit deiner Macho-Masche kriegst du jede rum, was?“
„Du zweifelst nicht daran.“
In einer provokant lasziven Geste strich sie sich das Haar zurück und funkelte ihn an. Sie begann zu spielen und ahnte dabei nicht, wie sehr er diesen Moment herbeigesehnt hatte. „Deine Nummer zieht bei mir nicht.“
„Natürlich nicht. Du bist hier, weil du kein Interesse an mir hast.“ Sie war hier, weil er ihren Geist manipuliert hatte, aber das würde er ihr gewiss nicht sagen. „Joana.“ Er ließ seinen lang schon verlorenen Romani-Akzent in ihrem Namen mitklingen und sah, dass sie schauderte. „Es ist nicht nötig, dass du dich zierst. Sei du selbst und leg dich nicht durch deinen prüden Anstand in Ketten. Das ist unnötig.“
„Jetzt reicht es aber“, zischte sie. „Spar dir dein Gesülze, Don Juan, ich bin nicht interessiert!“ Sie winkte der Kellnerin, die gelangweilt hinter der Bar Gläser polierte. „Ich möchte zahlen. Sofort bitte, wenn’s möglich ist.“
„Komme gleich“, rief die Angesprochene zurück, ohne den Anschein zu erwecken, sich in Bewegung setzen zu wollen.
Nicholas warf der Kellnerin einen Blick zu und suggerierte ihr, dass sie die Aufforderung vergessen solle. Zufrieden wandte er sich wieder Joana zu.
„Du schindest nur Zeit.“ Er holte ein Päckchen Zigaretten aus der Hosentasche, nahm mit den Lippen eine aus der Packung und bot ihr ebenfalls eine an. Sie schnaubte entrüstet. „Aber das ist schon okay“, murmelte er, die Zigarette im Mundwinkel haltend. „Du kannst deine Zeit vergeuden, das macht mir nichts aus. Ich habe jede Menge Zeit.“ Geduld war dagegen etwas, worüber er nicht verfügte. Aber das ging diese Frau, die sich auf so entzückende Weise gegen ihn auflehnte, nichts an. Er entzündete seine Zigarette an der Kerze und sah ihr tief in die Augen, während er den Rauch inhalierte. Sie starrte trotzig zurück. Ihr Blick flatterte hin und wieder in Richtung Kellnerin. Auf die konnte sie lange warten.
„Arroganter Kerl! Weißt du, womit ich meine Zeit verschwende? Mit dir. Schönen Abend noch.“
Sie machte Anstalten aufzustehen, um an der Bar zu bezahlen. Zeit, ihr Selbstbewusstsein wieder ein wenig zurechtzustutzen. Er griff in einer raschen Bewegung nach ihrer Hand und legte diese auf seinen Unterarm, der sie so fasziniert hatte. Ihre warme Haut bedeckte die Symbole, die für seine Erschaffung standen. Ihr Interesse kehrte zurück, vermischt mit Unsicherheit und etwas Furcht. Unwiderstehlich. Ohne darüber nachzudenken nahm er alles an sich, was er bekommen konnte, ehe sie ihre Emotionen wieder schützend abschottete. Der Schatten in ihm schnurrte wie ein zufriedener Kater. Ihr Gesicht wurde ausdruckslos, der Blick leer. Sie schüttelte leicht den Kopf und rieb sich die Stirn.
„Ich … möchte jetzt wirklich gehen“, sagte sie leise. „Ich fühle mich nicht gut.“
Das konnte er sich vorstellen. Er fühlte sich fantastisch. „Du siehst müde aus.“ Erneut streckte er die Hand nach ihr aus. Sie war zu langsam, um zurückzuweichen und er strich über eine fein geschwungene Augenbraue und die Schläfe. Platzierte eine psychedelische Bombe in ihrem Geist. Einen Traum, der es ihm erleichtern würde, sein Ziel zu erreichen. Zu wissen, was sie in dieser Nacht sehen würde, erregte ihn mehr, als gut war. Er riss sich jedoch zusammen. Morgen früh schon würde sie sich nach seiner Nähe sehnen. Wann er sie erlöste war allein seine Entscheidung.
„Fahr nach Hause und schlaf dich aus“, sagte er und zwang sich zu einem sanften Lächeln. Sie nickte, stand auf und verabschiedete sich, ohne nach einem weiteren Treffen zu fragen. Bald würde sie das bereuen. „Und träum was Schönes.“
Nicholas drehte den Stuhl ein wenig in Richtung Kellnerin. Sie war längst nicht so hübsch, besaß nicht diese frech ins Gesicht fallenden Locken und bot bei Weitem nicht eine solche Fülle an Gefühlen. Aber er war angeheizt und wollte mal sehen, was bei ihr zu holen war.
Erschöpft, als wäre sie seit Tagen ohne Schlaf gewesen, ließ Joana sich auf ihr Bett fallen. Die Erinnerungen an den Abend brodelten in ihr, pochten von innen gegen ihre Schläfen. Seine Worte hallten echoähnlich in ihrem Schädel wider, als sei ihr Kopf ansonsten vollkommen leer. Sie verstand sich selbst nicht mehr. Dieser Mann hatte Furcht in ihr geweckt, Trotz, dann eine verstörende Faszination und schließlich war er ihr egal gewesen. So egal wie alles andere. Dass sie in Kleidern im Bett lag störte sie nicht. Sie hatte noch etwas essen wollen, aber es war ebenso bedeutungslos, wie sich die Zähne zu putzen oder das Makeup aus dem Gesicht zu waschen.
Aber war das so ungewöhnlich? Radikale Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit waren vermutlich nur weitere Zeichen dafür, dass sie depressiv wurde. Sie vergrub das Gesicht im Kissen und schluchzte auf, doch es kamen nicht mal Tränen. Nur Leere. Sie verlor sich selbst und konnte nicht mal mehr darüber weinen. Sie hätte gerne Wut verspürt, Angst oder auch Verzweiflung über diesen Zustand, der immer weiter Besitz von ihr ergriff. Aber es kam nichts. Sie war nur müde. Unendlich müde.
„Was machst du hier?“ Entsetzt richtete sich Joana im Bett auf und zog das Laken über die Brust. Sie war nackt. Warum war sie nackt? Sie schlief nie nackt. „Verschwinde! Raus hier!“
Der Fremde, Nicholas hieß er, was ihn nicht weniger fremd machte, trat ungerührt näher. Seine Schritte verursachten kein Geräusch auf dem Laminat. Panik jagte wie eine eisige Welle durch ihren Körper.
„Was willst du? Und wie bist du reingekommen?“
Sie bekam keine Antwort. Er lächelte nur, wissend und selbstbewusst. Im Gegensatz zum Abend zuvor lag seinen Zügen kein Spott mehr inne. Er hob den Zeigefinger an die Lippen. Joana schluckte den nächsten Schrei herunter. Er lächelte und sein Finger glitt an seinem Mund herab, zog seine Unterlippe leicht abwärts. Ihre Augen klebten an seinen Lippen und sie wünschte, es wäre ihr Finger, der sie berührte. Er ließ sich auf der Bettkante nieder, ohne dass die Matratze sich unter seinem Gewicht bewegte. Seine Fingerspitzen fanden ihren Handrücken und zeichneten erneut glühende Muster. Der Drang, über die Stellen zu reiben, war überwältigend, aber Joanas Körper blieb steif und schwerfällig. Er hob ihre Hand an, legte die Kuppe ihres Zeigefingers auf seine Lippen, als hätte er ihren heimlichen Wunsch in ihren Gedanken gelesen. Sein Mund fühlte sich weich und fest zugleich an. Sie tastete seine Umrisse ab, während ihr Daumen die gerade Linie seines Kiefers entlang fuhr. Noch auf das Gefühl winziger Bartstoppeln konzentriert, schob Joana ihren Zeigefinger trotz seiner leichten Gegenwehr zwischen seine Lippen, wo es feucht war. Nur mit etwas Druck konnte Joana in seinen Mund eindringen und fand seine Zunge. Nass, seidig und heiß an ihrer Haut. Sie seufzte leise und ihr Blick glitt sehnsuchtsvoll die Reihe an Knöpfen herab, die sein Hemd verschlossen. Er saugte an ihrem Finger, nahm dann ihre Hand und führte sie an den obersten Hemdknopf. Ganz langsam öffnete sie ihn, strich ein Stück hinab und machte sich an den zweiten. Fahriger diesmal, ungeduldiger. Den dritten riss sie auf, ebenso alle anderen. Mit beiden Händen streifte sie ihm das Hemd von den Schultern, fuhr über glatte Haut, unter der sich jeder Muskel sanft geschwungen abzeichnete. Gott, er war schön. Viel zu schön, doch längst nicht makellos. Mehrere Narben zogen sich über seinen durchtrainierten Oberkörper und sie fuhr jede einzelne mit den Fingern nach. Am linken Rippenbogen zeichneten sich einige Hämatome ab, wie von einem Faustkampf. Sie strich darüber, provozierte ihn mit leichtem Druck. Falls sie ihm wehtat, ließ er es sich nicht anmerken.
Unterhalb des Schlüsselbeins war eine weitere Tätowierung. Ein Drudenfuß – er stand in Flammen. Es dürstete Joana nach all den Geschichten, deren Symbolik die Male darstellten, doch sie wusste instinktiv, dass er in dieser Nacht nicht sprechen würde. Sie sah zu seinem Gesicht auf und er erwiderte ihren Blick ruhig und gelassen. Abwartend.
Ihre Hand glitt seine Brust hoch, über die Haut seiner Kehle und schließlich in seinen Nacken. Mit den Fingern kämmte sie durch schwarzes Haar, vergrub ihre Hände darin. Ihre Lippen brannten vor Verlangen, ihn zu küssen, ihn zu schmecken, doch ihr fehlte der Mut. Er lächelte eine Herausforderung. Und Joana nahm sie an.
Sie umfasste seine Hand, die das Laken schützend über ihrer Brust zusammenhielt und lockerte seinen Griff. Der Stoff fiel. Sie legte seine Hand zurück auf ihr Dekolleté und schob sie tiefer. Spöttisch hob er eine Augenbraue. Er sagte kein Wort – sie hörte ihn trotzdem.
Sag es mir. Ich will hören, was du willst.
„Küss mich“, hauchte Joana und zog ihn näher. Sein Mund war unter ihren Lippen noch weicher, als unter ihren Fingern, doch sie konnte ihn nicht schmecken. Sie atmete tief ein, doch sie roch nichts. Wie verwirrend, warum hatte er keinen Geruch? Keinen Geschmack? Sie zeichnete seine Lippen mit ihrer Zunge nach und ließ sie dann zaghaft in seinen Mund gleiten. Fand seine und spielte erst scheu, dann fordernder mit ihr. Doch sie schmeckte nur sich selbst, so leidenschaftlich der Kuss auch wurde.
An den Haaren zog sie seinen Kopf in den Nacken, leckte und saugte an seinem Hals. Ihr Körper war längst dicht an seinen gepresst. Sie bestaunte die Schönheit der Konturen, mit denen ihre karamellfarbene Haut in seine überging. Sie selbst war perfekt, sogar der Leberfleck auf ihrer Brust war verschwunden. Nicholas war nicht blass, aber direkt neben ihr mochte es den Anschein haben, seine Haut wäre hell wie Alabaster.

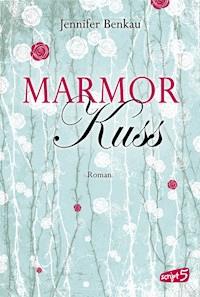















![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)










