
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sieben Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Jamian Bryonts steht mit dem Rücken zur Wand. Um seinen jüngeren Bruder zu schützen, nimmt er die Schuld für einen Fehler auf sich, den er nicht begangen hat, und unterwirft sich einem ewigen Fluch: Mittels eines Giftes raubt der Senat der Vampirjäger ihm die Sterblichkeit. Doch warum gerade diese diabolische Strafe für ihn gewählt wurde, stellt Jamian vor ein Rätsel. Und was hat es mit der Vampirfrau Laine auf sich, die zeitgleich in seinem schottischen Dorf auftaucht und über Gesetze nur lacht? Klar ist nur eins - sie ist die Letzte, der Jamian vertrauen darf. Denn Laine hat einen tödlichen Auftrag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stolen Mortality
Jennifer Benkau
Stolen Mortality
Jennifer Benkau
Copyright © 2013 Sieben Verlag, 64354 Reinheim
Umschlaggestaltung: © Andrea Gunschera
Korrektorat: Susanne Strecker, www.schreibstilratgeber.com
Druck: CPI books GmbH, 25917 Leck
ISBN-Taschenbuch: 978-3-864431-11-1
ISBN-eBook-PDF: 978-3-864431-12-8
ISBN-eBook-epub: 978-3-864431-13-5
www.sieben-verlag.de
Für alle, die so gern noch einmal achtzehn wären,
und sei es nur für eine Nacht.
Für alle,
die die schockierende Entdeckung kennen,
sich zu verlieren – oder
sich wiederzufinden.
Und für mich.
Phönix, gescheitert
Wie wehmütig mein Blick
den Himmel streift,
an dem ich gern mich selbst
gefunden hätt in weißen Wolken.
Ohne Hörner und vielleicht
mit einem Lächeln
wär ich beinah
engelsgleich.
Nun steig herab, du lichterhelles Wesen,
du Wolkentänzer, der am Himmel brennt
– ich steig empor!
Umsonst.
Ich Tor.
Denn siehe, dass auch meine helle Wolke
ihr Strahlen einbüßt durch das alte Ich.
Wie wehmütig mein Blick
sich senkt zu Boden,
auf dem mein Licht
zu Asche dann erlischt.
Alexandra Dichtler
Inhaltsverzeichnis
Intro
1. Kraft zum Leben
2. Die Hand der Feinde
3. Unsterblich
4. Das Bildnis des Jamian B.
5. Auge in Auge
6. Wenn Gestern Schatten wirft
7. Jeder Engel ist schrecklich
8. Aufmerksamkeiten
9. Beziehungsstatus: Es ist kompliziert
10. Dämonen
11. Das Monster am See
12. Gold & Grün
13. Hirnbrei
14. Schöne Lügen
15. Prophezeit
16. Blutrausch
17. In einer Sackgasse
18. Eine wirklich böse Erkenntnis
19. Das Gefühl von Ohnmacht bei vollem Bewusstsein
20. Wahrheit wird überbewertet
21. Strohfeuerhitze
22. Eis glüht kalt
23. Mitternachtsschatten
24. Was sind schon Engel?
25. Jenseits von Gut & Böse
26. Sineads Kampf gegen die Schlange
Outro
Nachwort
Die Autorin
Intro
Flüsterworte in einem Wald, irgendwo in den Highlands.
Kein Mensch könnte etwas sehen. Es ist Nacht, der Himmel wolkenverhangen. Die Brüder hüllen sich in Dunkelheit, werden beinah unsichtbar.
„Red nicht länger drum herum, Jamian. Was sind wir?“
Eine Pause dehnt sich aus. In der Ferne schreit ein Kauz, ein Totenvogel.
„Glaub, was immer du willst“, antwortet der Ältere schließlich leise. „Manche nennen uns Engel. Andere Dämonen. Beides ist richtig, das kommt auf den Standpunkt an. Wir sind vom Volk der Kienshi. Du und ich, wir sind Wächter.“
„Wächter? Wächter über was?“
„Über die Finsteren. Die Bluttrinker. Vampire. Wir sorgen dafür, dass sie sich im Zaum halten und ihren Durst kontrollieren.“
„Warum wir, Jamian?“
„Weil es unser Erbe ist, das Erbe unseres Vaters und dessen Vater. Über Jahrhunderte. Die Aufgabe, diesen Ort vor ihrer Gier zu schützen, ist die Meine.“ Sein Seufzen klingt erschöpft. „Und ab heute auch die Deine.“
„Dann sind wir die Guten“, sagt der Jüngere. Er ist im gleichen Moment allein. Sein Blick huscht zwischen den Bäumen umher wie ein Tier auf der Flucht. Sein Bruder ist verschwunden. „Das sind wir doch. Ja?“
Ein bitteres Lachen bleibt zurück und lässt dem Jungen einen Schauder über den Rücken laufen.
Wir sind nicht die Guten, Junias, nur, weil wir kein Blut trinken. Wir sind einfach etwas anderes Böses.
Kraft zum Leben
Schottlands Schafe haben die Angewohnheit, mit stoischer Gelassenheit mitten auf der Straße zu stehen.
Selten, dass Jamian Bryonts sich daran störte. Er verließ sich auf seine Reflexe, den abschätzbaren Bremsweg des Minis, sowie den Überlebenstrieb der Tiere und trat aufs Gas. Einerseits, weil er oft zu spät losfuhr, Unpünktlichkeit wiederum verabscheute, was er durch seinen Fahrstil kompensieren musste. Andererseits, weil er gern schnell fuhr.
Auch an diesem Sommerabend ließ er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit weit hinter sich. Ein Song von Snow Patrol aus dem Autoradio übertönte das Klappern des Handschuhfachs. Jamian trommelte im Rhythmus der Drums auf dem Lenkrad und unterbrach dies nur, um sich Weingummis in den Mund zu schieben. Der Wind, der durch das geöffnete Fahrerfenster in den Mini blies, zerzauste ihm die Haare. Im Westen zeugte nur noch ein rötlicher Saum über den Hügeln davon, dass den ganzen Tag die Sonne geschienen hatte. Die letzten Reste einer heilen Welt, die zum Untergang verdammt war. Jeden Abend aufs Neue.
Jamian befand seine romantische Ader für gut durchblutet, aber Sonnenuntergänge entlockten ihm selten mehr als ein finsteres Grinsen. Eine weitere Nacht brach herein. Eine Nacht, die Arbeit für ihn bedeutete. Was oft genug Ärger mit sich zog.
Erneut griff er auf den Beifahrersitz, doch unter seinen Fingern knisterte nur noch die leere Tüte. Einen Fluch grummelnd fragte er sich, wie man auf einer Fahrt von fünfzehn Minuten eine ganze Packung englischen Weingummi – Preis: immerhin drei Pfund –leer machen konnte. Tante Holly hatte ihm als Kind immer erzählt, zu viel von diesem Sassenach-Zeug würde den Magen verkleben und für ein tagelanges Problem auf dem stillen Örtchen sorgen. Denkste.
In nostalgischen Gedanken und Appetit nach weiteren Süßigkeiten versunken, parkte er seinen Wagen vor dem Backsteinhaus, in dem er mit seinem jüngeren Bruder lebte. Er tätschelte die Motorhaube und ging hinein. Kein Laut drang aus dem oberen Stockwerk. Junias war vermutlich noch unterwegs. In seinem Zimmer im Obergeschoss ließ Jamian sich am Schreibtisch nieder und sah aus dem Fenster in die windverwaschenen Farben der Dämmerung. Andere seines Alters gingen jetzt ins Kino, oder rauchten einen Joint, fuhren nach Inverness in einen Club und rissen ein paar Miezen auf.
Er spielte den Vampirjäger.
Ohne jede Vorwarnung wurde die Tür aufgestoßen, knallte gegen die Wand und ein großer Gegenstand flog auf Jamian zu. Reflexartig hob er die Arme, um seinen Kopf zu schützen. Er bekam den Drehstuhl zu fassen, den sein Bruder mit unwirklicher Kraft nach ihm geworfen hatte, dennoch traf eine der scharfkantigen Metallrollen seine Schläfe. Blut sickerte ihm über die Braue ins Auge. Der Schmerz setzte etwas zeitverzögert ein. Für einen Moment konnte Jamian an nichts anderes denken, als Junias den verdammten Stuhl über den Schädel zu ziehen. Genau so, wie er es verdient hätte!
„Mann, was ist in dich gefahren?“, brüllte er ihn an. „Bist du irregeworden?”
Junias verharrte bewegungslos in der Tür. Sein Gesicht war tränennass. In der linken Faust zitterte ein zerdrücktes Blatt Papier, altmodisch mit schwarzer Tinte von einem breiten Federkiel beschrieben.
Jamian wusste, was in dem Brief stand. Resignierend ließ er den Stuhl auf den Boden fallen.
Es war das Urteil. Sein eigenes Urteil. Es kam nicht überraschend, keineswegs. Aber viel früher als erwartet. Er brauchte es nicht zu lesen, er wollte es gar nicht lesen.
Sein Leben würde aufgrund dieses Stück Papiers von nun an ein anderes sein. Er sollte wohl nicht mal mehr zwei Tage älter werden.
„Du … du Mistkerl!”, stieß Junias hervor. „Wie kannst du mir das antun?“ Mit dem Ärmel wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht.
Jamian erwiderte nichts und schluckte den Zorn hinunter, wie er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte. Er konnte sich vorstellen, wie schmerzhaft die Schuldgefühle an seinem Bruder fraßen, denn in der Hand hielt Junias das Urteil, das Jamian die Sterblichkeit nehmen sollte. Für ein Vergehen, das er nicht begangen hatte. Einen Fehler, durch den ein Menschenleben ausgelöscht worden war. Totschlag nannten sie es, aber das traf es nicht.
„Du hättest das nicht auf dich nehmen dürfen, Jamian! Es war meine Strafe – meine Schuld! Auf dem verfluchten Wisch hier sollte mein Name stehen, nicht deiner. Du verdammter Lügner!“
„June, komm schon, reg dich ab.” Jamian zwang sich zur Ruhe. Lieber hätte er getobt, aber das würde weder ihm noch Junias nützen. Sacht legte er seinem Bruder eine Hand auf die Schulter, so vorsichtig, als tickte in dem Jungen eine Bombe. Die Geste sollte ihn selbst ebenso beruhigen wie Junias, dessen Wut langsam der Verzweiflung zu weichen schien. „Es war nicht deine Schuld. Sie hätten dir diese Kräfte noch nicht geben dürfen. Du bist zu jung. Es war absehbar, dass etwas passieren würde. Ich hätte dich nicht überfordern dürfen.“ Für einen Moment spielte er mit dem Gedanken, Junias in den Arm zu nehmen. Doch er kannte seinen Bruder zu gut und wusste, dass er das nicht zugelassen hätte. Seit dem Unfall schrak er vor jeder körperlichen Annäherung zurück und hüllte sich in einen Kokon aus sicherem, leerem Raum. „Jeder hat Schuld, Junias. Aber du am wenigsten."
„Das gibt dir nicht das Recht, die Strafe auf dich zu nehmen!“ Junias wollte weitersprechen, bekam aber nur noch ein Schluchzen zustande.
Jamian wandte sich ab, um ihm etwas Platz zu lassen. Durch die verspiegelte Tür seines Kleiderschranks beobachtete er, wie der dünne Blutstrom, der ihm an Wange und Hals hinunterlief, in seinem Ramones-T-Shirt versickerte. Er konnte Junias verstehen, er würde ebenso denken. Doch er hatte den richtigen Entschluss gefasst.
„Da ich volljährig und dein Vormund bin, in dieser sowie in der anderen Welt, habe ich nicht nur das Recht dazu, sondern die Pflicht. Ich kann schlecht zulassen, dass …“ Er schluckte gegen die Übelkeit an, die diese Förmlichkeiten ihm verursachten. Er redete wie die Speichellecker im Senat, verdammt noch eins! „Mal im Ernst, du kannst nicht für immer sechzehn bleiben. Denk mal nach, was das bedeuten würde. Ein Leben ohne Bier!“
Ein weiteres Zittern durchfuhr Junias, auf den flachen Scherz ging er nicht ein. „Du lügst doch schon wieder, oder? Das wäre nicht mein Urteil gewesen. Sie hätten mir nicht die Sterblichkeit genommen und mir diesen Fluch aufgedrückt.“
„Nein“, antwortete Jamian leise. „Nicht in diesem Sinne.“
„Oh, ich hasse sie so!“ Junias warf sich herum und versetzte dem Türrahmen einen Tritt, der das Holz unter seinen Nikes splittern ließ. „Für den Wandel bin ich ihnen alt genug. Aber zu meinem eigenen Prozess darf ich nicht kommen, weil ich zu jung bin. Das ist nicht fair!“ Er stützte seine Unterarme an die Wand, drückte das Gesicht hinein und blieb, bis auf das leichte Zittern seiner Schultern, bewegungslos stehen.
„Was wäre mein Urteil gewesen?“, flüsterte er nach einer Weile in den Stoff seines Sweatshirts.
Jamian hätte gern geschwiegen, doch Junias würde auf die Antwort aus seinem Mund bestehen, obwohl er sie kannte. „Was willst du hören? Sie hätten dich umgebracht, was denkst du denn?"
Junias nickte und legte den Kopf seitlich gegen den Arm. „Dein Leben für meins. Sehe ich das richtig?“
„Tust du. Nur dass ich“, Jamian strich sich mit beiden Händen das Haar zurück und zwang sich zum Lächeln, „nicht sterben werde. Nicht so bald.“
„Dann wirst du also für immer neunzehn bleiben. Toll. Glückwunsch. Zumindest darfst du dich besaufen.“
„Du weißt, was du mich mal kannst.“ Mit dem Handrücken wischte Jamian sich das Blut aus dem Auge. Als er den Arm sinken ließ, starrte ihm sein eigenes Gesicht völlig besudelt aus dem Spiegel entgegen. Eine schaurige Kriegsbemalung, jetzt brauchte er nur noch blaue Farbe und einen Kilt. Jamian Bryonts auf seinem blutigen Freiheitskampf gegen den Senat seines Volkes. Tolle Vorstellung!
Du hast doch einen Plan, oder?, fragte Junias still. Er wagte vermutlich nicht, die Worte laut auszusprechen, doch das war auch nicht nötig. Seitdem auch er vor drei Monaten ein Kienshi geworden war, brauchten sie ihre Stimmen nicht mehr, um miteinander zu reden.
Ich lass mir was einfallen.
„Und was?“
„Keine Ahnung. Frag nicht, oder hab ich Löcher in den Händen?“ Jamian schüttelte den Kopf und biss sich heftig auf die Unterlippe, um den schwelenden Zorn zu bändigen.
„Vielleicht können wir beweisen, dass es eine Falle von Sinead war. Sie hätten dir diese Kraft einfach noch nicht geben dürfen. Nicht umsonst ist es nach ihren Drecksgesetzen frühestens mit achtzehn erlaubt. Dass Sinead so versessen darauf bestand, ich würde Hilfe brauchen und nur darum für dich eine Ausnahme gemacht wurde, kann nur eine Falle gewesen sein. Könnte mir vorstellen, dass sie sogar gezielt darauf spekuliert hat, es würde etwas schiefgehen. Vielleicht auch der ganze verfluchte Senat. Die wollten, das etwas passiert, was mich dazu bringt, ihnen jeden erdenklichen Mist zu unterschreiben – nur aus unterschiedlichen Gründen. Unsterblich haben sie länger was von mir, richtig? Die haben dich bloß benutzt, damit ich nach ihrer Pfeife tanze.“
„Sie konnten nicht wissen, dass du ein Idiot bist, der die Strafe seines kleinen Bruders auf sich nimmt.“
Ach, June. Natürlich wussten sie es. Es gab niemanden, dem nicht bewusst war, dass Jamian für Junias’ Wohl jedem Teufel die Eier geleckt hätte, wenn es nötig gewesen wäre.
Zu gern hätte Jamian seine Wut an jemandem ausgelassen. An irgendjemandem, nur nicht an seinem Bruder. Er sehnte sich verzweifelt nach seinem Schlagzeug, das selbst die schäbigsten seiner Emotionen immer in etwas Großartiges verwandelt hatte – in Musik –, aber selbst dieses Ventil hatten sie ihm genommen. Sinead konnte von Glück reden, dass sie weit weg war. Er würde ihr den hübschen Hals auf ganz andere Weise verdrehen, als sie es von ihm gewohnt war.
„Und wenn es so ist – wie wollen wir das beweisen?“, fragte Junias. Im nächsten Moment vergrub er den Kopf wieder im Ärmel seines Sweatshirts. „Tschuldigung. Du wärst nicht so wütend, wenn du es wüsstest.“
„Nee, keine Ahnung.“ Jamian zwang sich eine Maske aus Gleichgültigkeit auf. Ein erbärmlicher Versuch. Er wusste, dass er seinem Bruder nichts mehr vormachen konnte. „Aber sicher nicht, indem wir hier heulen, während draußen die Blutsauger ohne uns Partys feiern. Also komm, lass uns gehen.“
„Heute? Musst du nicht zum Senat? Die rasten aus, wenn du dich nicht fügst.“
Sollten sie doch. „Die werden schon kommen, wenn sie was von mir wollen. Ich kann dich kaum ein paar Tage hier allein lassen. Jetzt ganz sicher nicht mehr.“
Jamian war klar, dass den Senatoren diese Einstellung nicht gefallen würde, aber sein Nichterscheinen würde auch niemanden ernsthaft verwundern. Für seine Respektlosigkeit war er inzwischen bekannt. Sie erwarteten vermutlich neue Dummheiten. Er würde sie nicht enttäuschen.
Wenig später fuhren Jamian und Junias über die nächtlichen Straßen Richtung Glen Mertha. Alles schien wie immer. Eine friedliche Sommernacht. Es war diese Art von Ruhe, die alle Wahrheiten verschweigt und ein vollkommen verlogenes Bild nach außen kehrt. Wie ein Blick in einen Zerrspiegel. Diese Art von Ruhe, die Jamian frösteln ließ, obwohl Wut unter seinen Rippen glühte.
Das Kaff wirkte ausgestorben. Jeder müsste annehmen, dass sich in diesem Städtchen, eingebettet in ein Tal, umringt von Wäldern, Fuchs und Hase Gute Nacht wünschten. Hier, inmitten des schottischen Postkartenklischees, konnte doch sicherlich nichts Schlimmeres geschehen, als dass hin und wieder einem kichernden Mädchen die Unschuld geraubt wurde. Selbst die Einwohner glaubten daran, und die Touristen waren begeistert von der natürlichen, altmodischen Romantik und der friedlichen Ruhe dieser Gegend.
Sie waren alle ahnungslos.
Auf der ganzen Welt gab es sie, die Finsteren. Aber Glen Mertha schien ein wahres Blutsaugernest zu sein, auch wenn niemand wusste, was diesen Ort für Vampire so interessant machte.
Nach Michael Bryonts Tod hatte Jamian, als dessen ältester Sohn, sein Erbe als Kienshi angetreten, ungeachtet dessen, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal achtzehn Jahre alt gewesen war.
Gerade er! Seit sein Vater ihn hatte wissen lassen, dass die Finsteren existierten und wo seine Bestimmung lag, hatte Jamian sich mit aller hilflosen Kraft an den Regeln gerieben, die Michael am liebsten nie für ihn aufgestellt hätte. Mit wachsender Besorgnis hatten beide zugesehen, dass Jamian bei seinen Versuchen, irgendwo anzuecken, mehr Zerstörung verursachte, als er sich blaue Flecken zuzog.
Nun, da sein Vater mit all seiner sanften und unfreiwilligen Autorität unter der Erde lag, war es Jamian, der gezwungen war, die Gesetze zu verteidigen. Das war im Grunde fair, aber überforderte ihn darum nicht minder.
Er hatte dafür zu sorgen, dass die Vampire nicht über die Stränge schlugen und den Menschen in und um Glen Mertha nicht mehr schadeten als unbedingt nötig. Vor allem hatte er zu verhindern, dass jemand getötet wurde.
Jamian gab sich die größte Mühe und wusste, dass er seine Sache bisher gut gemacht hatte, wenngleich die anderen Wächter fast alle verächtlich die Nase über ihn und seine Methoden rümpften. Den Traditionen seines Volkes zum Trotz pflegte er einen kühlen und sachlichen Kontakt zu einigen Blutsaugern, was ihm schon einige Kämpfe erspart hatte. Feige, nannten andere Kienshi ihn deshalb, aber das kümmerte ihn nicht. Er hatte Gründe, die gewichtiger waren als sein Ruf unter Leuten, die ihm weniger bedeuteten als die Spinnen in seinen Zimmerecken.
Heute war es wieder an der Zeit für ein kleines „Interview mit einem Vampir“, wie Jamian die Gespräche mit Vertretern der Blutsauger nannte. Davon wussten diese natürlich nichts. Sie waren nicht gerade für ihren Humor bekannt und beleidigen durfte man sie schon gar nicht. Vermutlich war dies der Grund, dass die Kienshi den Kontakt zu den Finsteren normalerweise strikt ablehnten und sich lieber auf ihre körperliche Kraft im Kampf verließen. Die Kienshi waren ein temperamentvolles Volk. Ruhige Verhandlungen mit Feinden fielen ihnen schwer. Das ging auch Jamian nicht anders, doch er hatte sich im Griff. Er musste sich zusammenreißen; der Grund hieß Junias. Er war noch kein guter Kämpfer, auch wenn er stark war. Doch er war zu aufbrausend, kopflos und überschätzte sich maßlos. Er war einfach noch zu jung. Jeder ernsthafte Kampf bedeutete eine tödliche Gefahr für ihn, daher galt es, Auseinandersetzungen zu vermeiden, soweit es möglich war. Und wenn der Preis dafür war, den Blutsaugern Honig um die Mäuler zu schmieren, dann tat Jamian das. Mit knirschenden Zähnen – zugegeben -, aber er tat es.
Er lenkte den Wagen an der aus unregelmäßigen Wackersteinen gemauerten Kirche vorbei und steuerte den zwischen Bäumen und Sträuchern versteckt liegenden Parkplatz dahinter an, den der Pfarrer jede Nacht für ihn frei hielt. Bei dem Gedanken an den kantigen Pastor MacBennet überkam ihn wie immer Schwermut. MacBennet war ein Freund der Familie, der beste Freund seines Vaters. Okay, Freunde belog man nicht, aber für diesen machten die Bryonts eine Ausnahme. Zwar wusste MacBennet, dass sie keine gewöhnlichen Männer waren – er kannte und unterstützte ihre Aufgabe, die Vampire im Zaum zu halten -, doch von der Kehrseite der Medaille, dem Opfer, das die Menschen für den Schutz der Kienshi geben mussten, ahnte er nichts. Das war auch besser so, sonst hätte er vermutlich sogleich einen Exorzisten aus dem Vatikan herbeordert.
Seufzend tastete Jamian seine Schläfe ab. Die Wunde war noch offen, ein deutliches Zeichen, dass er sich in dieser Nacht besser nicht zurückhalten sollte. Wenn der Senat seine Handlanger schickte, würde er Kraft benötigen. Kraft, die er nicht mehr hatte. Er riskierte einen kurzen Seitenblick auf Junias, der mit gesenktem Kopf auf dem Beifahrersitz hockte und die Hände in den wuscheligen, braunen Haaren vergraben hatte. Junias sah auf. Das Grün in seinen Augen war matt und dunkel geworden, die tiefen Ringe darunter und die blasse Haut waren Jamian zu Hause schon aufgefallen. Dabei hatte Junias gestern erst ein Opfer gehabt. Trotzdem schien er bereits wieder völlig kraftlos. Gar nicht gut. In dem Zustand könnte jedes harmlose Scharmützel problematisch werden. Die Vampire mochten einfältig sein, aber sie bemerkten sofort, wenn die Wächter nicht bei ganzer Stärke waren. Dies würde einer Einladung zum Ärgermachen gleichkommen. Es gab also keine Möglichkeit, den Raub aufzuschieben, nicht nur der Blutsauger wegen. Jede Stunde des Wartens machte Junias’ Beherrschung instabiler. Das war Jamian zu spät klar geworden, erst, nachdem es schiefgegangen war. Junias brauchte so viel, weil er noch jung war. Viel zu jung, um die Bürde eines Kienshi zu tragen und die Verantwortung, die der Raub der Lebenskraft mit sich brachte. Er war gefährlich, so unschuldig er aussehen mochte.
Jamian zwang den besorgten Ausdruck aus seinen Zügen und legte die Maske aus Lässigkeit darüber, die ihm in den vergangenen Jahren so vertraut geworden war, dass er sich damit selbst täuschen konnte. Junias machte sich ausreichend fertig, diesem Leid wollte er nicht noch Zunder geben.
„Wir holen uns erst, was wir brauchen“, wies er mit ungerührter Stimme an. „Danach treffen wir den Blutsauger John Petters.“
Junias nickte mit vorgeschobener Unterlippe und Jamian musste sich ein Grinsen verkneifen. Frustriert sah der Kleine noch viel jünger aus, als er tatsächlich war. Es fiel Jamian immer schwerer, die Ähnlichkeit zwischen ihnen zu erkennen, die noch vor wenigen Jahren so verblüffend gewesen war; sah man davon ab, dass er selbst hellbraune und Junias strahlend grüne Augen hatte.
„Willst du es heute allein versuchen?“, fragte er, als er den Wagen zwischen den Haselnusssträuchern einparkte. Ein paar Zweige kratzten über den Lack. Insgeheim hoffte er, dass sein Bruder verneinen würde. Junias’ Entgleisung lag über einen Monat zurück, seitdem war er sehr beherrscht und vorsichtig vorgegangen. Doch Jamian hatte ihn nie aus den Augen gelassen. Es war an der Zeit, etwas Vertrauen zurückzugeben. Zumindest anbieten wollte er es.
Zu seinem heimlichen Entsetzen nickte Junias trotzig und stieg aus dem Wagen.
„Ich schaffe es.“ Es klang, als müsste er sich selbst überzeugen. „In einer halben Stunde bin ich wieder hier.“ Damit verschwand Junias flink und lautlos wie eine Katze zwischen den Bäumen, um einen geeigneten Menschen zu suchen.
Jamian ließ das Gesicht in seine Handflächen sinken und verharrte so einen Moment, das Beste hoffend, ehe er selbst auf Jagd ging.
*
Junias fühlte den Herzschlag in jeder Faser seines Körpers. Am liebsten wäre er umgekehrt und hätte Jamian doch um Hilfe gebeten, aber er ahnte, dass es zu spät war. Bestimmt war Jamian längst weg. Und irgendwann musste er es ja auch wieder allein schaffen, das hatte er schließlich Dutzende Male getan.
Bis zu dem Tag, an dem sein Opfer, ein Campingtourist aus London, plötzlich tot unter seinen Händen gelegen hatte.
Junias bemühte sich, die Erinnerung an das leblose Gesicht und die aufgerissenen, leeren Augen zu verdrängen. Er schüttelte den Kopf, schlug sich mit der Handfläche vor die Stirn, als könnte er die Bilder damit vertreiben. Aussichtslos. Er konnte sie nie vertreiben. Wie sollte man je vergessen, dem Tod ins Auge zu blicken, wenn man ihn selbst herbeibeschworen hatte?
Was waren seine Gefühle wert im Vergleich zu denen derer, die einen Freund, einen Geliebten oder einen Sohn verloren hatten? Er würde sich das, was geschehen war, nie verzeihen. Aber weitermachen musste er ja trotzdem.
Er entdeckte ein offenes Fenster im ersten Stock eines Einfamilienhauses. Er schloss die Augen und lauschte, hörte durch die leisen Geräusche der nächtlichen Stadt einen ruhigen Atem aus der Richtung dieses Fensters. Eine Frau schlief dort im Inneren.
Verstohlen sah er sich um, nahm ein paar Schritte Anlauf und sprang mit einem kraftvollen Satz bis ans Fensterbrett. Während er hineinkletterte, bemühte er sich, die Geranien im Blumenkasten nicht zu zerdrücken, dann kauerte er sich auf dem Teppichboden des Schlafzimmers nieder. Alles blieb ruhig, so erhob er sich und trat lautlos an das Bett der Frau. Die zweite Hälfte des Ehebetts war leer. Junias verschwendete keine Zeit damit, sich lange umzusehen. Angeekelt von sich selbst legte er der Frau die Hand auf die nackte Schulter und murmelte sicherheitshalber das hypnotische, lang gezogene „Schlaf“, das seinem Opfer neben den Erinnerungen auch jede Gegenwehr nahm. Dann begann er, von ihrer Energie zu nehmen, von ihrem Prana.
Das war es, was Kienshi zum Überleben brauchten. Was sie selbst nicht mehr hatten, und was ihnen, wenn sie es raubten, nicht nur das Weiterleben ermöglichte, sondern außerdem die übernatürliche Stärke verlieh, mit der sie in der Lage waren, gegen Vampire anzutreten.
Junias keuchte leise auf, als ihre Kraft auf ihn überfloss. Er brauchte mehr. Viel mehr.
Es war immer dasselbe. Zuerst musste er sich überwinden, überhaupt anzufangen und dann war die Kraft, die in ihn überging, so berauschend, dass er sich fast darin verlor. Er kämpfte gegen die Schwere in seinem Kopf, die seine Lider langsam zudrücken wollte.
Nur noch ein bisschen, ein bisschen kann ich es noch aushalten.
Gewaltsam hielt er seine Augen offen. Es war ein schmaler Grat, auf dem er tanzte. Nahm er zu wenig, gab es ihm nichts außer stärkerer Gier nach Leben, und er müsste ein weiteres Opfer nehmen. Ein erneutes Risiko eingehen. Nahm er auch nur einen Hauch zu viel, würde er in Ekstase fallen. Sein Körper würde sich in den anderen Leib krallen wie ein Raubtier, das Blut geleckt hatte, und so lange weiter das Leben an sich reißen, bis das Opfer tot war. Die gefährliche Schattenseite des bösen Vampirzaubers käme hervor.
So, wie es schon einmal geschehen war. Der Gesetzesbruch, der einen jungen Mann das Leben gekostet hatte und Junias’ Bruder die wertvolle Sterblichkeit kosten sollte, und damit jede Aussicht auf Frieden nach dem Tod. Unsterbliche fanden niemals Frieden. Das war der Fluch des ewigen Lebens, mit dem man einst jene strafte, die es gewagt hatten, sich über den Tod zu stellen, indem sie das Blut der Dämonin Lilith tranken, durch das sie unsterblich und zu den ersten Vampiren geworden waren. Aus deren giftigem Blut wiederum hatten die Kienshi, einst ein kleines Volk aus kampferfahrenen Alchimisten, ihre Macht über die Unsterblichkeit gewonnen. Doch der Fluch, den dieses Blut trug, ließ sich nicht besiegen. Wenn der Körper vernichtet war, verwandelten sich unsterbliche Seelen allesamt in ruhelose Geister. Sklaven der Lilith, an denen sie ihren Zorn auf jene ausließ, die sie einst betrogen hatten.
„Verdammt, Jamian“, flüsterte Junias zitternd, als er seine Hände mühsam vom Körper der schlafenden Frau löste. „Warum hast du das nur getan?“
*
„Eine späte Runde mit dem Hund?“ Jamian grüßte den Mann mit einem freundlichen Nicken. Der Alte zuckte mit den Schultern, nahm die Filzmütze vom Kopf, die er auch im Sommer selten abzulegen schien, und strich sich durch das schüttere Haar.
„Ist ja schon älter, der Bobby. Schafft es mit seiner Blase nicht mehr die ganze Nacht. Da wandern wir halt noch mal ein Stück hier am Waldrand entlang.“
„Verstehe.“ Jamian kraulte dem struppigen Setter das Fell. Lange würde er es nicht mehr machen, der alte Bobby.
Man kannte sich. Schon häufiger war Jamian dem Mann in seinem Wachsmantel über den Weg gelaufen, wenn dieser den Hund ausführte. Zum Pub und wieder zurück. Gelegentlich machte der Alte einen Umweg am Waldrand entlang. Bobby zuliebe, und um heimlich eine Zigarre zu rauchen, obwohl es ihm die Frau wegen seiner kranken Lungen verboten hatte.
Jamian klopfte dem Hundebesitzer beiläufig auf die Schulter, wie er es oft tat. Im gleichen Moment griff er die Hand des Alten und gab seine mentale Anweisung. Die Augen des Mannes wurden leer, dann gaben seine Knie nach und er sackte in sich zusammen, fiel Jamian in die Arme. Mühelos trug er ihn zu einer Holzbank am Wegrand und nahm dabei von seinem Prana. So alt der Mann auch war, so kränklich sein Körper, aber seine Lebensenergie war gewaltig, gewachsen und gereift an vielen harten Jahren. Von solchen Menschen musste Jamian nicht viel nehmen. Sie erholten sich schnell.
Er legte den schlaffen Körper auf dem Holz ab. Es würde den Alten nicht wundern, hier mit Kopfschmerzen aufzuwachen. Er hatte getrunken und würde es wieder auf den Whisky schieben. Wie passend, seine Nebenwirkungen gerade auf das sogenannte „Wasser des Lebens“ schieben zu können.
Jamian spürte die erleichternde Kraft durch seine Fasern kriechen und genoss das kribbelnde Brennen, mit der sich die Wunde an seiner Schläfe schloss.
„Grüß mir meine Familie im Jenseits, Bobby“, flüsterte er dem Setter zu, als er ihn an der Bank festband. „Und vergiss meine Katze nicht. Beiß ihr ruhig in den Hintern, sie war ein Miststück. Ich hab sie trotzdem gemocht, sagst du ihr das? Meinen Leuten kannst du sagen, dass ich gern irgendwann nachgekommen wäre. Daraus wird jetzt wohl nichts mehr, für mich geht ein anderes Tor auf. Sag ihnen, dass es mir leidtut.“ Er verharrte, erheitert über sich selbst. „Und jetzt verrat mir mal, warum ich mit einem Hund über das Jenseits plaudere?“
Kopfschüttelnd stand er auf, vergewisserte sich, dass der Alte auf der Bank nicht zu unbequem lag, und schlenderte den Weg zurück Richtung Kirche.
Im nächsten Moment vernahm er einen Schrei aus dem Wald. Er dachte nicht nach, war bereits hundert Meter gerannt, als ihm der Gedanke an seinen Bruder kam. Kurz zögerte er.
Junias sollte dem Blutsauger nicht allein gegenüberstehen. Auch wenn Petters harmlos war – Junias war es nicht immer.
Doch dann ertönte wieder dieser Schrei, diesmal unmissverständlich von Panik getränkt, und Jamian hatte sich entschieden.
Junias würde keine Dummheiten machen. Hoffentlich.
Er rannte, so schnell er konnte, durch den Wald. Die Dunkelheit bereitete ihm keine Probleme, seine Augen sahen nachts kaum schlechter als am Tag. Die Schreie wurden schnell lauter. Und dringlicher. Ein Mädchen war es, das da schrie, und er konnte bereits spüren, dass mehrere Vampire in der Nähe waren. Was zum Geier taten die da? Er kämpfte sich durch ein Gestrüpp und achtete nicht auf die Zweige, die ihm ins Gesicht peitschten. All seine Gedanken kreisten um die Vorstellungen von bestialisch tötenden Vampiren. Oder Schlimmerem. Gerüchten zufolge war sein Vater tagelang von seinem Mörder gefoltert worden, ehe er starb.
Jamian rannte, als ginge es um sein Leben, oder um mehr als nur den kümmerlichen Rest davon.
Er fand die Blutsauger am Rande eines felsigen Abgrundes. Unten wand sich ein Bach durch ein Kiesbett; das Geräusch sanft plätschernden Wassers passte nicht zu dem Horrorszenario, das sich ihm im fahlen Mondlicht bot.
Sie waren zu dritt, zwei Männer und eine Frau, er kannte sie alle aus der Stadt und hatte sie für friedlich gehalten. Doch auf dem Boden lag ihr Opfer.
Eine junge Frau, mehr noch ein Mädchen, mit langem, lockigem Haar, das ihr zerzaust im Gesicht hing. Ihre Bluse war zerfetzt, regelrecht vom Leib gerissen, sodass ihre Brüste freilagen. Sie krümmte sich auf dem nackten Waldboden zusammen, blutete aus zahllosen Wunden, und drückte sich mit letzter Kraft die linke Hand auf einen großen Riss im unteren Bauchbereich, aus dem das Blut sprudelte. Die Vampirfrau trat mit ihren schweren Boots auf sie ein und einer der Männer trank an ihrem Handgelenk. Entsetzt rang Jamian nach Luft. Etwas Derartiges hatte er noch nie mit ansehen müssen.
„Zurück!“ Sein Brüllen schien ihm kalt und fremd in den Ohren. Er zog seinen Dolch aus der Scheide am Gürtel und trieb zunächst die Vampirin von dem Mädchen fort.
„Verschwindet, lasst sie in Ruhe!“ Verdammt, warum hatte er keine Pistole dabei? Er war zu spät. Das Mädchen hatte schon zu viel Blut verloren und lag mit verdrehten Augen unter halb geschlossenen Lidern auf dem Boden. Sie reagierte nicht mehr auf die Quälereien der Blutsauger. Jamian unterdrückte ein verzweifeltes Aufstöhnen. Gegen drei Vampire gleichzeitig hatte er allein keine Chance, wenn sie es auf einen Kampf anlegen würden.
„Bleib weg, Bryonts!“, rief einer der männlichen Vampire. Es war Vladin, er hatte schon häufiger mit ihm gesprochen und ihn bislang als vernünftig eingeschätzt. Etwas dümmlich, aber ohne böse Absichten. „Das hier geht dich nichts an!“
„Das sehe ich anders!“, knurrte Jamian durch die Zähne und fixierte Vladin. Er fühlte, wie der Schock die Angst erfror und den Kämpfer freiließ, zu dem sie ihn ausgebildet hatten. Kalt und hart wie Stein. „Verzieh dich augenblicklich, Nackenbeißer, sonst ist der Erste, dem ich das Maul stopfe, der Pazifist in mir. Und dann lernst du mich kennen.“
Alle drei Vampire starrten ihn höhnisch an und bewegten sich keinen Zentimeter vom Fleck. Die ließen sich nicht mit Gerede beeindrucken. Jamian ging ohne weiteres Zögern auf Vladin los und versuchte, ihn zu packen. Doch der Blutsauger war schnell und entkam. Der andere Mann riss der Frau eine weitere Wunde, diesmal in die Armbeuge. Sein Blick fixierte Jamian. Reine Provokation. Jamian brüllte seine Wut heraus und stürzte mit erhobenem Dolch in seine Richtung. Einen Sekundenbruchteil später steckte die Klinge bis zum Heft in der Schulter des Gegners. Schade, das Herz hatte er verfehlt. Die Vampirin fing sich einen platzierten Tritt vor die Kehle, der sie mehrere Meter zurückwarf. Aufgebracht kreischte sie Worte in einer Sprache, die Jamian nicht kannte. Er hätte auch akzentfreies Englisch nicht mehr verstanden. In seinen Ohren rauschte das Blut.
Vladin zerrte das Opfer in die Aufrechte, spie der Frau ein paar Worte ins Gesicht und stieß sie von sich. Direkt den Felsabhang hinunter. Jamian fuhr zusammen, als der Körper im Bachbett aufschlug. Es waren gute vier Meter bis zum Grund, trotzdem glaubte er, Knochen knirschen zu hören. Die Vampire warfen ihm verächtliche Blicke zu. Der Verwundete riss sich das Messer aus der Schulter und warf es Jamian vor die Füße.
Vladin grollte: „Die ist erledigt! Sag Danke, Bryonts. Los, verschwinden wir.“
Damit rannten sie davon. Für einen Moment wollte Jamian das Opfer aufgeben. Das konnte sie nicht überlebt haben. Er musste die Vampire verfolgen und zur Rechenschaft ziehen. Sie würden bereuen, was sie getan hatten!
Doch dann war ihm, als hätte er ein schwaches Stöhnen gehört und so musste er zunächst nachsehen, ob die Frau möglicherweise doch noch lebte. Hoffentlich nicht, denn wenn sie es tat, dann nicht mehr lange. Fluchend vor Zorn, da die Blutsauger ihm entkommen würden, eilte er an den Rand des Abhangs. Der Körper lag still und seltsam verdreht im flachen Wasser. Die Strömung bewegte ihr Haar. Sie hätte tot sein müssen. Doch aus den Wunden pulsierte weiterhin schwach das Blut, demnach war da noch ein Herzschlag. Er sprang und landete neben ihr im kiesigen Bachbett. Wasser spritzte auf und durchtränkte seine Schuhe. Er ließ sich auf die Knie fallen und hob den Kopf der Frau an, damit sie Luft bekam. Falls ihr die noch etwas nützte. Sie ertrinken zu lassen, wäre vielleicht gnädiger gewesen. Er presste seine freie Hand auf die nächstbeste Verletzung, um die Blutung einzudämmen, doch es waren zu viele Wunden, er hätte fünf Hände gebraucht und sie wäre trotzdem in seinen Armen verblutet. Auch an ihrem Hinterkopf spürte er einen klaffenden Riss. Blut rann ihm über die Hände und in den Bach, färbte eine rötliche Spur ins Wasser.
„Oh nein, Scheiße!“ Er war eindeutig zu spät. Das Mädchen – Himmel, sie musste noch jünger sein als er -, war mehr tot als lebendig. Zu viele klaffende Wunden zerfurchten ihre durchscheinende Haut. So viel Blut überall. Die Hilflosigkeit machte ihn schwindlig. Er konnte nichts tun. Hier draußen hatte er keine Möglichkeit, die Blutungen zu stoppen, von den anderen Verletzungen ganz zu schweigen. Mit all den Vampirbissen und den grausigen Erinnerungen war es ihm nicht einmal erlaubt, sie in ein Krankenhaus zu bringen, selbst wenn dazu noch Zeit geblieben wäre. Ihre Rippen waren obskur verformt, ebenso die Finger ihrer linken Hand.
„Scheiße“, schluchzte er wieder, als ihm bewusst wurde, wie barbarisch dieses Mädchen gefoltert worden war.Normalerweise hinterließen Vampire nur winzige Löcher durch ihre Reißzähne, die sie durch einen Tropfen ihres eigenen Blutes innerhalb von Sekunden schließen konnten. Ihr hatten sie die Adern buchstäblich aufgerissen. Was sie ihr sonst noch angetan hatten, wollte er gar nicht wissen. Aber da keines ihrer Kleidungsstücke unbeschädigt war und der Vampirgeruch überall an ihr haftete, ahnte er nichts Gutes.
Was konnte dieses Mädchen den Blutsaugern Böses getan haben? Er fragte sich, woher sie kam, und wo man vergeblich auf ihre Heimkehr warten würde. Mit der engen Röhrenjeans und den hochhackigen Stiefeln aus cremefarbenem Leder passte sie nicht aufs Land. Sicher war sie aus der Großstadt und hatte nicht geahnt, in was für ein Rattenloch sie gekommen war.
Um irgendetwas tun zu können, zog er sein Hemd aus, legte es um ihren halb nackten Oberkörper und hob sie vorsichtig aus dem Wasser. Sie wimmerte kaum hörbar an seiner Brust.
„Schon gut, bald ist es vorbei“, flüsterte er ihr zu. Lieber hätte er vor Wut geschrien, aber das Einzige, was er für sie tun konnte, war, ihr das Sterben ein klein wenig zu erleichtern, und ihr nicht noch mehr Angst zu machen. Mit beruhigendem „Schschsch“ wiegte er sie in den Armen und wartete darauf, dass ihr Herzschlag aussetzte.
Er hätte es beschleunigen und ihr die Schmerzen nehmen können. Dass sie litt, war offensichtlich, dass es nichts als einen seiner düstersten Gedanken bedurfte, um dies zu beenden, ebenso. Doch er hatte noch nie getötet. Sein Bruder hatte es getan, wenn auch aus einer anderen Situation heraus, und Jamian hörte fast jede Nacht die Schreie, mit denen die Schuld Junias aus dem Schlaf riss.
Er wagte es nicht, ihr das Leben zu nehmen und schämte sich, ihr diese Gnade zu verweigern.
Sie starb entsetzlich langsam und schaffte es immer wieder, ein paar Laute zu wimmern, die Jamian nicht verstehen konnte. Schließlich glaubte er, ein schwaches „Verzeih“ zu vernehmen. Dabei wäre ein Fluch auf seine Feigheit angebrachter gewesen. Was tat sie nur, betete sie? Schmerzlich getroffen drückte er sie an sich und sah zum Himmel. Bat etwas, an das er längst nicht mehr glaubte, es möge wenigstens schneller gehen.
Plötzlich machte das Mädchen eine krampfartig zuckende Bewegung und nahezu im gleichen Moment spürte er, dass sich etwas wie ein Messer in seinen Hals grub. Zwei oder drei Herzschläge lang war er vor Schmerz und Schreck wie versteinert und drückte den schwachen Körper an sich. Er spürte das heftige Pulsieren seiner Halsschlagader, den saugenden Mund unter seinem Wangenknochen im gleichen, panischen Rhythmus. Als er sie schockiert losließ, hatte sie bereits ihre Arme um ihn geschlungen und hielt sich selbst an ihm fest. Entsetzen hämmerte durch seinen Kopf, er wollte zurückweichen und sie von sich reißen, doch er stolperte und fiel.
„Nein – hör auf!" Er zerrte an ihr und schlug auf sie ein. Dann wurde ihm jäh dunkel vor Augen. „Hör auf!" Der Schock war zu groß, als dass er rechtzeitig an das Naheliegende hätte denken können – ihr Prana zu nehmen.
Seine Beine gehorchten ihm kaum noch, er kam nicht mehr auf die Füße. Sie krallte sich unbarmherzig an seinem Nacken und seiner Schulter fest, schlang ihre Beine um seine Hüften. Er gelangte nicht einmal mehr an seinen Dolch, der irgendwo im Bachbett liegen musste.
Seine Hände gaben den vergeblichen Kampf auf, wurden schwer und fielen an seinen Seiten hinab ins Wasser. Es war kalt. Das Saugen an seiner Kehle wurde ruhiger und langsamer, langsamer wie auch sein Herzschlag.
Langsamer.
Schließlich spürte er sich nach hinten kippen. Seine Panik schwoll an, als sein Kopf unter die Wasseroberfläche geriet. Sprudelnd stiegen Blasen um ihn herum auf, das eisige Quellwasser brannte in seinen Atemwegen und kreischte ein schrilles Lied vom Sterben. In seiner Brust brannte ein Feuer. Ertrinken war harmlos? Gnädig? Wer hatte ihm denn den Scheiß erzählt? Noch immer drückte sich das Mädchen gegen seinen Körper und trank selbst unter Wasser gierig an seinem Hals.
Ein Vampir. Sie war ein gottverfluchter Scheißvampir.
Und er ein Idiot. Er hatte seiner verdammten Mörderin das Leben gerettet.
Toter Idiot.
Wie Dad. Er starb und ließ Junias im Stich, genau wie Dad.
Die Gedanken entglitten ihm und wurden in den Strudel der Bewusstlosigkeit gezogen.
Die Hand der Feinde
Der Keller einer stillgelegten Fabrik nahe der Kirche erschien Junias als geeignetes Versteck.
Von hier aus könnte er Jamians mentale Stimme hören, wenn dieser zurück zum Auto ging. Hier würde er den herumschleichenden Blutsaugern nicht in die Arme laufen, die ihn seit zwei Stunden verfolgten. Mühelos glitt er durch ein eingeschlagenes Fenster. Manchmal hatte es Vorteile, so zierlich zu sein. Die Vampire würden ihre Körper kaum durch diese enge Lücke quetschen können. Er ließ seinen Blick durch die Dunkelheit in dem vollgestellten Keller gleiten. Nichts als ausrangierte Möbel, ein paar Kisten und unglaubliche Mengen Müll in blauen und schwarzen Plastiksäcken. Alles, was nicht lohnte, verkauft oder mitgenommen zu werden, hatte man hier zurückgelassen, nachdem die Fabrik geschlossen worden war. Einen Nachmieter würde es vermutlich nie geben.
Junias fand einen abgewetzten Sessel und ließ sich hineinfallen. Er hustete vom aufgewirbelten Staub, zog die Beine an den Körper und wartete. Ein paar Ratten leisteten ihm bald Gesellschaft. Den Mutigen unter ihnen warf er klebrige Stücke von dem Snickers zu, das er noch in der Tasche seiner Jeansjacke gehabt hatte. Mental rief er Jamians Namen, aber er bekam keine Antwort. Sein Bruder war immer noch zu weit weg, sonst hätte er ihn gehört.
Irgendetwas war schiefgegangen. Jamian war nicht nach einer halben und nicht nach einer ganzen Stunde zurückgekommen. Da stimmte etwas nicht, ganz und gar nicht.
Man mochte über Jamian sagen, er wäre verantwortungslos – das sagten ja nahezu alle – aber Junias wusste, dass er ihn nicht im Stich lassen würde. Nie. Und erst recht würde er ihn nicht nachts in einer Stadt voller Blutsauger zurücklassen, ohne ein Wort zu sagen.
Er hatte versucht, Jamian auf dem Handy anzurufen, doch außer der Mailbox meldete sich niemand.
Auch die Vampire hatten bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Mit einem Mal waren sie an jeder Ecke gewesen. Er hatte ihre Stimmen gehört, vor allem aber auf diese diffuse, unheimliche Art ihre Anwesenheit gespürt. Einige wirkten aufgeregt, andere richtiggehend besorgt. Sie flüsterten sich leise Warnungen zu, die er nicht verstehen konnte. Petters war nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Dafür waren plötzlich drei andere hinter ihm hergeschlichen. Wie Schatten hatten
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!


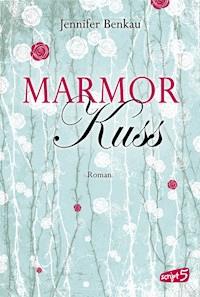














![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)










