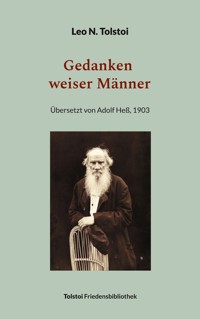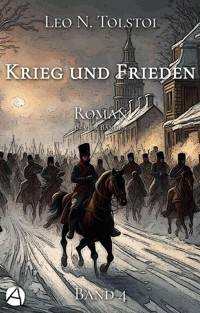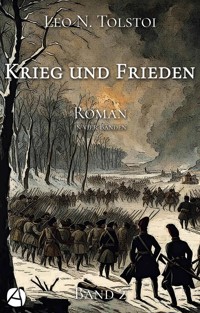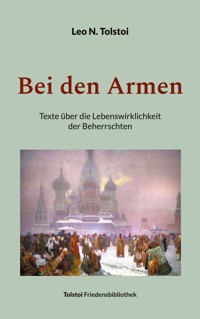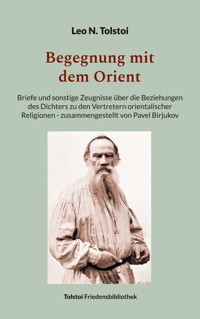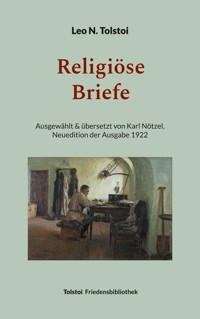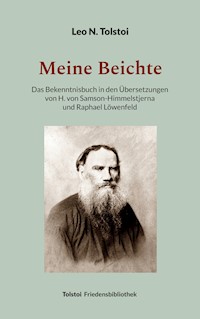
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Tolstoi-Friedensbibliothek A
- Sprache: Deutsch
Die Reihe A der Tolstoi-Friedensbibliothek erschließt in chronologischer Folge alle größeren Einzelwerke aus dem religionsphilosophischen, theologischen und gesellschaftskritischen Schriftenkreis Leo N. Tolstois. In diesem ersten Band ediert Ingrid von Heiseler zwei Übersetzungen der 1879-1882 entstandenen "Beichte" (Hermann von Samson-Himmelstjerna 1886, Raphael Löwenfeld 1901). Beigaben aus der von Pavel Birjukov bearbeiteten Dokumentation "Tolstois Biographie und Memoiren" (1909) erhellen den Hintergrund der "Bekenntnisse": "Ich lebte auf meinem Gute und vertrank, verspielte und verschlemmte, was die Bauern erarbeitet hatten; ich strafte und peinigte sie, benutzte sie zu meinen Ausschweifungen, verkaufte und betrog sie, und für alles das wurde ich gelobt. ... Zu jener Zeit bin ich im Kriege gewesen und habe gemordet und zur selben Zeit begann ich zu schreiben, aus Hoffart und Hochmuth ..." Peinliche Selbstbezichtigung bildet mitnichten das Zentrum des Werkes. In seinen Tagebuchaufzeichnungen vom April 1881 vermerkt Tolstoi: "Vor zwei Jahren bin ich Christ geworden ... Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben ... Dieses Buch, so wurde mir gesagt, kann nicht gedruckt werden. Will ich die Liebe einer Dame zu einem Offizier schildern, dann darf ich das; will ich von der Größe Russlands schreiben und Kriege besingen, so darf ich das durchaus ... Dieses Buch hingegen, in dem ich berichte, was ich erlebt und gedacht habe, drucken zu wollen, ist geradezu undenkbar ... Ein erfahrener Redakteur hob abwehrend die Hände: Dafür würden sie meine Zeitschrift verbrennen und mich gleich mit." Tolstoi-Friedensbibliothek, Reihe A, Band 1 (Signatur TFb_A001) Herausgegeben von Peter Bürger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Hintergrund und Übersetzungen von Tolstois Schrift
Ispoved’
(1879-1882)
Vorwort des Herausgebers
Leo Tolstoi
B
EKENNTNISSE
(
Ispoved’
, 1879)
Aus dem russischen Manuskript übersetzt von Hermann von Samson-Himmelstjerna (1886)
Leo N. Tolstoj
M
EINE
B
EICHTE
(
Ispoved’
, 1879/1882)
Von dem Verfasser genehmigte Ausgabe von Raphael Löwenfeld (1901/1922)
_____
Anhang
D
IE
K
RISE UND DER NEUE
G
LAUBE
Aus dem dokumentarischen Werk „Tolstois Biographie und Memoiren“ (1909)
Von Pavel Birjukov
Verzeichnis der Übersetzungen von Tolstois Schrift
Ispoved’
(1879-1880/82)
Ausgewählte Literatur zu Leo N. Tolstois religiösen Schriften
Leo N. Tolstoi (1828-1910) Sechstes Lebensjahrzehnt; commons.wikimedia.org
Hintergrund und Übersetzungen von Tolstois Schrift Ispoved’ (1879-82)
Vorwort des Herausgebers
Der Lebensweg des Dichters LEO N. TOLSTOI (1828-1910) ist schon in Jugendtagen gekennzeichnet von dem Begehren, ein ‚guter Mensch‘ zu werden. Sein Thema ist die Rechtfertigung der eigenen Existenz durch selbsterbrachte Leistung: durch herausragende kulturelle oder im ethischen Sinne gute ‚Werke‘. Das Unternehmen wird – hier ganz wörtlich zu nehmen – nach Plan angegangen und das Nichtgenügen wahrheitsgetreu in einer besonderen Buchhaltung vermerkt. Eine große Selbstbezüglichkeit scheint dem moralischen Ringen immer wieder den Atemraum zu rauben. Wie könnte man dem – um sich selbst kreisenden – ‚unglücklichen Ich‘ entkommen? Am 24. Oktober 1901 wird TOLSTOI auf der Krim niederschreiben: „Jeder Mensch ist an seine Einsamkeit gefesselt und zum Tode verurteilt. […] Das ist grauenhaft! Die einzige Rettung ist – das eigene Ich aus dem Gefängnis befreien, einen anderen zu lieben.“1 Wie bei dem von allen bewunderten und ‚geliebten‘ Augustus2 aus den Märchen von HERMANN HESSE geht es schließlich einzig darum, selbst zu lieben. – Doch wie kann man als Mensch überhaupt ein Liebender werden, also ein wirklicher ‚Hausgenosse‘ Gottes? Ob bezogen auf diese – allem anderen vorangehende – Frage die Antwort des großen Russen, der seine Bedürftigkeit und Armseligkeit doch wie ein Bettler vor aller Welt ausgebreitet hat, am Ende überzeugt, das wollen wir im weiteren Fortgang unserer Edition ‚Tolstoi-Friedensbibliothek‘ erkunden.
Nicht selten geschieht es, dass sich bei einem Menschen ein bestimmtes ‚Thema‘ wie etwas ganz Neues Bahn bricht und das gesamte Gefühlserleben vitalisiert, während ein ruhiges Nachsinnen später zeigt, dass die ‚Vision‘ oder der ‚Auftrag‘ schon Jahrzehnte früher einmal längst da war, auch dem Bewusstsein zugänglich. Die Fährte einer nachaufgeklärten, aber keineswegs zum Beiwerk degradierten Religion reicht in der lebensgeschichtlichen Suche TOLSTOIS weit zurück. Im Tagebucheintrag vom 4. März 1855 schreibt er: „War heute zum Abendmahl. Ein gestern geführtes Gespräch über das Göttliche und den Glauben brachte mich auf einen großen und erhabenen Gedanken, dem ich mein Leben zu weihen fähig wäre. Dieser Gedanke besteht in der Gründung einer neuen Religion, die dem Entwicklungsstand der Menschheit angemessen ist, einer Religion Christi, aber gereinigt von Glauben und Geheimnis, einer praktischen Religion, die kein künftiges Glück verheißt, sondern Glück auf dieser Erde gewährt. Einen solchen Gedanken können, das begreife ich wohl, nur Generationen in die Tat umsetzen, die bewußt auf dieses Ziel hinarbeiten. Eine Generation wird den Gedanken der folgenden als Vermächtnis hinterlassen, und irgendwann einmal wird Fanatismus oder Vernunft ihn verwirklichen. Bewußt daran arbeiten, Menschen und Religion zu vereinen, ist die Quintessenz dieses Gedankens, der mich hoffentlich nicht mehr losläßt.“3
In den nachfolgenden zwei Jahrzehnten bestimmen andere Schauplätze, Themen und Aufgabenstellungen TOLSTOIS Weg. Die Beunruhigung darüber, ein sterblicher Mensch zu sein, der mir nicht dir nichts auch wieder verschwinden kann, tritt zeitweilig noch stärker in den Vordergrund. Doch die Erfolge als Dichter, durchaus auch patriarchal motivierte Bemühungen um bessere Lebens- und Bildungsbedingungen der Bauern, Aufgaben der Gutsverwaltung, die Heirat und ein Familienalltag mit vielen Kindern scheinen hinreichende Antworten auf die Frage nach einem ‚Sinn des Lebens‘ zu gewähren. In den 1870er Jahren – noch während der Arbeiten am Roman Anna Karenina (1873 bis 1878) – bricht die Unruhe früherer Jahre erneut hervor, jetzt als ein Schrei. Über diese Krisenjahre orientiert uns eine im vorliegenden Band als Anhang dargebotene biographische Dokumentation des Tolstoi-Vertrauten PAWEL BIRJUKOV aus einem größeren Werk, das noch zu Lebzeiten des Dichters erschienen ist.4
TOLSTOI verzweifelt in seiner Suche nach dem ‚Sinn des Lebens‘, denn dieser kann nicht ästhetisch komponiert oder philosophisch konstruiert werden. Das reine Denken erweist seine Impotenz darin, dass es den ‚Sinn‘ eben nicht erdenken und auf den Begriff bringen kann. Die Religion der eigenen aristokratischen, besitzenden Klasse ist – sofern überhaupt vorhanden – nur hohl und heuchlerisch. Ahnungen von einem Glauben, der keine Bekenntnisleier aus bloßen, ganz unverständlichen Sätzen ist, findet TOLSTOI in Begegnungen mit Menschen aus der Tag für Tag um das Brot ringenden Mehrheitsbevölkerung. Die Theologen faseln von einer ungetrennten wie unvermischten Koexistenz der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus. Im Glauben der kleinen Leute scheint aber wirklich so etwas auf wie eine Versöhnung unserer Endlichkeit (Zufälligkeit) mit dem Unendlichen (Absoluten). ‚Glaube‘ ist hier ein neues Selbstverstehen5: Leben, kein dogmatisches System. Ohne Gott gibt es keinen ‚Sinn‘, nur den Schrei ins Leere. Der erfahrbare ‚Sinn‘ ist das wirkliche Leben selbst: Liebe.6 Ein Jahrhundert früher als die lateinamerikanischen Befreiungstheologen hat LEO TOLSTOI – ohne falsche Idealisierungen – für sich so etwas wie ein „Lehramt der Armen“ entdeckt. Vor allem deshalb nähert er sich zeitweilig wieder der volkskirchlichen Frömmigkeitspraxis seiner Kinder- und Jugendjahre an – aller Aufklärung zum Trotz und mit vergleichsweise mildem Urteil über die kleinen Fetische des Alltags. Schlimm bleibt in seinen Augen die Annahme, man könne ‚Glauben‘ in ein System von Lehrsätzen oder magischen Priesterritualen pressen und so zum Besitztum einer religiösen Verwaltung machen. Entlarvend ist ein Kirchentum, das die Menschen, statt sie zu vereinigen, trennt. Mehr als alles andere aber überschreitet die Schmerzgrenze jener Katechismus, der staatliche Gewalt bis hin zu Tötungsakten (Hinrichtungen, Militär, Krieg) legitimiert und diese Blasphemie schon den Kindern ins Hirn brennt.
In seiner Tagebuchskizze Aufzeichnungen eines Christen vom April 1881 schreibt TOLSTOI rückblickend: „Ich bin getauft und habe ein heidnisches Leben geführt, und ich halte nicht jeden, der getauft wurde, für einen Christen, und wenn ich sage: Ich bin Christ, so behaupte ich weder, die Lehre befolgt zu haben, noch besser zu sein als andere, sondern erkläre nur, der Sinn des menschlichen Lebens ist Christi Lehre und die Freude des Lebens besteht im Streben, diese Lehre zu befolgen, und daher erfüllt mich alles, was dieser Lehre entspricht, mit Liebe und Freude […]. Ich bin jetzt 52 Jahre alt, und mit Ausnahme der 14, 15 Kindheitsjahre, die ich fast unbewußt durchlebt, habe ich 35 Jahre weder als Christ noch als Mohammedaner oder Buddhist verbracht, sondern als Nihilist im direkten und eigentlichen Sinne des Wortes, das heißt ohne jeglichen Glauben. – Vor zwei Jahren bin ich Christ geworden. Seitdem erscheint mir alles, was ich höre, sehe und erlebe, in so neuem Licht, daß ich glaube, diese meine neue Ansicht vom Leben, die eine Folge davon ist, daß ich Christ geworden bin, muß interessant und möglicherweise auch lehrreich sein […] Darüber, wie ich Christ wurde, habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Es wird darin ausführlich geschildert, wie ich vor aller Welt geachtet und für meine Werke sogar ausdrücklich gelobt, über 30 Jahre als absoluter Nihilist gelebt habe. Das Wort Nihilist wird bei uns jetzt gewöhnlich im Sinne von Sozialrevolutionär gebraucht; ich hingegen gebrauche es in seinem eigentlichen Sinne: an nichts außer an den Mammon glauben. Dort, in diesem Buch, lege ich dar, wie ich 35 Jahre als ein solcher Nihilist verbracht und zur Belehrung russischer Menschen 11 Bücher geschrieben habe, die mir, abgesehen von allen möglichen Lobeserhebungen, etwa anderthalbtausend Rubel einbrachten; wie ich mich davon überzeugen mußte, daß ich die Menschen gar nichts zu lehren vermag, sondern selber nicht die geringste Vorstellung davon habe, was ich bin, was gut und schlecht ist. Und wie ich, nun von meiner Unwissenheit überzeugt und keinen Ausweg daraus sehend, verzweifelte und mich beinahe erhängt hätte und dann auf verschiedenen qualvollen und verschlungenen Wegen zum Glauben an die christliche Lehre gelangte und diese Lehre begriff.“7
Das besagte Buch – Beichte (Ispoved’, 1879-82) – enthält zwar das Bekenntnis eines Mörders (Soldatenzeit), ‚Unzüchtigen‘ und Ausbeuters, ist aber kein detailfreudiger Rechenschaftsbericht über alle Schandtaten der Vergangenheit. Der religiöse Schweizer Sozialist EMIL BLUM (1894-1978) erinnert sich so an seine Lektüre im Jahr 1912: „In jener Zeit war die kleine Schrift von Leo Tolstoi ‚Meine Beichte‘ für mich von großer Bedeutung geworden. Ich hatte sie in Erwartung irgendwelcher Pikanterien erworben. Statt dessen fand ich eine packende Darstellung der Krise, in die Tolstoi auf der Suche nach dem Sinn des Lebens geraten war. Das war gerade die Frage, die mich bewegte: Wozu leben wir, wenn doch der Tod am Ende des Lebens eines jeden steht und alles Leben auf Erden aufhören wird, wie es eines Tages geworden ist. Dabei blieb mir die Frage nach einem ‚Leben nach dem Tode‘ irrelevant.“8
Schon 1881 musste L. N. TOLSTOI feststellen, dass man seine Beichte als subversives Werk betrachtete: „Dieses Buch, wurde mir gesagt, kann nicht gedruckt werden. Will ich die Liebe einer Dame zu einem Offizier schildern, dann darf ich das; will ich von der Größe Rußlands schreiben und Kriege besingen, so darf ich das durchaus; will ich die Notwendigkeit der Volkstümlerbewegung, des orthodoxen Glaubens und des Absolutismus nachweisen, so darf ich das erst recht. Will ich beweisen, daß der Mensch ein Tier ist und außer dem, was er empfindet, nichts im Leben existiert, ich darf es; will ich vom Geist reden, vom ersten Ursprung, von den Grundlagen, von Objekt und Subjekt, von Synthese, Kraft und Materie, und dies insbesondere in einer Weise, die kein Mensch versteht, so darf ich das. Dieses Buch hingegen, in dem ich berichte, was ich erlebt und gedacht habe, in Rußland drucken zu wollen ist geradezu undenkbar, wie mir ein erfahrener und gescheiter alter Zeitschriftenredakteur sagte. Er las den Anfang meines Buches, und er gefiel ihm. Da er mich um Mitarbeit bat, sagte ich: ‚Da, drucken Sie das!‘ Er hob abwehrend die Hände und rief: ‚Du liebe Güte! Dafür würden sie meine Zeitschrift verbrennen und mich gleich mit.‘ Also lasse ich es nicht drucken.“9
Im Juni 1882 verhängt die Zensurbehörde tatsächlich ein Verbot der Beichte, weil der – bis dahin von den Zensoren unbehelligte – Verfasser „wichtige Wahrheiten des Glaubens und Erlasse der Orthodoxen Kirche in Zweifel zieht und sich abfällig äußert über Wahrheiten und Riten der Orthodoxie“. Der Text muss aus allen Exemplaren einer schon gedruckten Ausgabe der Zeitschrift Russkaja mysl’ herausgeschnitten werden. Doch Petersburger Studenten nehmen sich der Druckfahnen an. Bald schon kursieren tausende Abschriften und Kopien in Russland. Die Gesamtzahl übersteigt die Auflage der Russkaja mysl’ bei weitem.
Danach erscheint die Schrift zunächst in Genf in einer russischen Emigrantenzeitschrift (1883-1884) und als Buch (1884) bei Elpidine. WLADIMIR GRIGORJEWITSCH TSCHERTKOW eröffnet im Jahr 1901 mit der Beichte seine im englischen Exil edierte Sammlung der von der russischen Zensur verbotenen Tolstoi-Werke. Eine vollständige Ausgabe kann in Russland selbst erst 1906 veröffentlicht werden.
Wir erschließen im vorliegenden Band die Übersetzung des Balten HERMANN VON SAMSON-HIMMELSTJERNA10 (1886) nach einem frühen Manuskript und die – davon erheblich abweichende – Übersetzung nach einer bearbeiteten späteren Fassung von RAPHAEL LÖWENFELD (1901)11, dem bedeutendsten Vermittler von LEO TOLSTOIS Schriften vor dem ersten Weltkrieg. Im Anhang verzeichnen wir außerdem noch die frühen Übertragungen von L. ALBERT HAUFF (1890), ALEXIS MARKOW (1890), WILHELM LILIENTHAL (1895) und eines anonymen Übersetzers für den genannten Zeitraum (sowie nachfolgende). TOLSTOI hatte seinen Verzicht auf die Wahrnehmung von Urheberrechten, bezogen auf die nach 1881 veröffentlichten Werke, erklärt. Dies gehört zum Hintergrund eines staatlichen Sortiments deutscher Mehrfachübersetzungen seiner Schriften vor dem ersten Weltkrieg.
Zunächst hat TOLSTOI mit seiner Beichte vielleicht auch den schon länger gefassten Plan einer Rechenschaft des eigenen Lebens neu aufgenommen.12 Später bezeichnet er sie in seinem Manuskript Kratkoe izloženie Evangelija (Kurze Darlegung des Evangeliums, 1881-83) jedoch als Einleitung eines aus vier Teilen bestehenden ‚theologischen Werkes‘ (1. Beichte: persönlicher Aufbruch, 2. Kritik der dogmatischen Theologie, 3. Bibelarbeit mit dem Evangelium, 4. Darlegung eines ‚unverfälschten‘ christlichen Glaubens).13
Vorab erfolgt durch die Beichte eine entscheidende Klärung: Der Weg des Lebens nimmt seinen Ausgang nicht bei unfehlbaren Autoritäten oder Bekenntnis-Objekten. Auch so etwas wie ‚Theologie‘ vermag nur ins Auge zu fassen, wer zuvor die Ermutigung erfährt, selbst ein Subjekt – ein aus der eigenen Lebenserfahrung heraus sprechender Mensch – zu werden.
pb
1 Hier zitiert nach Volker SCHLÖNDORFF, in: Lew TOLSTOI: Für alle Tage. Ein Lebensbuch. Mit einem Geleitwort von Volker Schlöndorf und einem Nachwort von Ulrich Schmid. Auf Grundlage der russischen Ausgabe letzter Hand von Christiane Körner revidierte und ergänzte Übersetzung von E. Schmitt und A. Škarvan. Lizenzausgabe. Berlin: Fröhlich & Kaufmann Verlag 2018, S. 13.
2 Hermann HESSE: Die Märchen (suhrkamp taschenbuch 3812). Frankfurt a. M. 2006, S. 64-88 („Augustus“, September 1913).
3 Lew TOLSTOI: Tagebücher. Erster Band 1847-1884. Berlin: Rütten & Loening 1978, S. 182. – Dies berührt sich mit DIETRICH BONHOEFFERS viel später aufgeworfener Frage nach einem „religionslosen Christentum“. Was der so überaus kirchlich gesonnene BONHOEFFER als Religionskritik vorträgt, wäre im Kontext einer Zusammenschau am ehesten in Entsprechung zu dem, was TOLSTOI als Kritik des Kirchentums formuliert hat, zu betrachten.
4Leo N. Tolstois Biographie und Memoiren. Autobiographische Memoiren, Briefe und biographisches Material. Herausgegeben von Paul BIRUKOF und durchgesehen von Leo Tolstoi. Band II: Reifes Mannesalter. Wien/Leipzig: Moritz Perthes 1909, S. 307-371 (vgl. EBD., S. 495-497 zu Drucklegung und Beschlagnahme der ‚Bekenntnisse‘). – Zu religiösen Gedanken und Selbstzeugnissen TOLSTOIS lange vor und während der ‚Krisenjahre‘ vgl. Evelies SCHMIDT: Nachwort. In: Leo N. TOLSTOI: Meine Beichte. Aus dem Russischen von Raphael Löwenfeld. München: Eugen Diederichs Verlag 1990, S. 167-200 (vgl. EBD. S. 161-165: editorische Notiz zur ‚Beichte‘); Martin GEORGE / Jens HERTH / Christian MÜNCH / Ulrich SCHMID (Hg.): Tolstoj als theologischer Denker und Kirchenkritiker. (Übersetzung der Tolstoj-Texte von Olga Radetzkaja und Dorothea Trottenberg, Kommentierung von Daniel Riniker). Zweite Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, S. 37-86 (Texte) und S. 731-736 (Verzeichnis der entsprechenden Schriften). Vgl. EBD., S. 58 den Überblick zur Zensur- und Editionsgeschichte der Schrift Meine Beichte, mit dem in diesem Vorwort angeführten Zitat aus der Begründung der klerikalen russischen Zensurbehörde.
5 Eine zentrale Frage unser weiteren Werk-Erkundung: Kommt ein neues Selbstverstehen des Menschen aufgrund der Erfahrung des Geliebtseins ins Blickfeld (sodass der unheilvolle Zwang zur ewigen Rechtfertigung der eigenen Existenz nicht mehr besteht) – oder obsiegt andererseits gar der Irrweg einer ‚ethischen Vernunftreligion‘, welcher keine Antwort auf den ‚Schrei‘ geben kann?
6 Ulrich SCHMIDT formuliert – in theologischer Hinsicht ganz ‚ungeschützt‘ – zur Lösung der Krise: TOLSTOI „verkündete, dass der Sinn des Lebens im Leben selbst liege und dass das Leben letztlich Gott bedeute. Das Reich Gottes finde sich nicht im Himmel, sondern im Menschen selbst. Der Weg zu Gott war deshalb für Tolstoi im Wesentlichen identisch mit dem Weg zu sich selbst“ (Nachwort zu Lew TOLSTOI: Für alle Tage. Ein Lebensbuch. Berlin 2018, S. 729). – Im Sinne des heutigen Sprachgebrauches wird man das Verständnis von ‚Glaube‘ in L. TOLSTOISBeichte gewiss eher als ‚Mystik‘, keineswegs jedoch als erfahrungslosen ‚theologischen Rationalismus‘ bezeichnen können.
7 Lew TOLSTOI: Tagebücher. Erster Band 1847-1884. Berlin 1978, S. 342-343.
8 Hier zitiert nach Christian MÜNCH, in: Martin GEORGE u. a. (Hg.): Tolstoj als theologischer Denker und Kirchenkritiker. Göttingen 2015, S. 647.
9 Lew TOLSTOI: Tagebücher. Erster Band 1847-1884. Berlin 1978, S. 343.
10 HERMANN VON SAMSON-HIMMELSTJERNA (1826-1908) wird sich später mit einer Schrift „Anti-Tolstoi“ (Berlin: Walther 1902) hervortun. Vgl. Edith HANKE: Prophet des Unmodernen. Leo N. Tolstoi als Kulturkritiker in der deutschen Diskussion der Jahrhundertwende. Tübingen: Max Niemeyer 1993, S. 49; sowie den Eintrag zu H. SAMSON-HIMMELSTJERNA in: www.deutsche-biographie.de.
11 Löwenfeld stand in enger Verbindung mit Leo N. Tolstoi. Vgl. zu ihm Helmut SCHALLER: Raphael Löwenfeld (1854-1910) – sein Weg von der slawischen Philologie in Breslau zum Theater in Berlin. In: K. Harer /H. Schaller (Hg.): Festschrift für Hans-Bernd Harder zum 60. Geburtstag. (= Marburger Studien, Band 36). München / Berlin: Verlag Otto Sagner, S. 489-499.
12 So schreibt Günter DALITZ in: Lew TOLSTOI: Philosophische und sozialkritische Schriften. Berlin: Rütten & Loening 1974, S. 781: „In die Endfassung der Schrift arbeitete Tolstoi auch seine unvollendete Autobiographie ‚Was bin ich?‘ ein.“
13 Wir werden gemeinfreie Übersetzungen der entsprechenden Werke zu den Punkten zwei bis vier im Rahmen der hier begonnenen Reihe A der Tolstoi-Friedensbibliothek in eben dieser Reihenfolge edieren.
Leo Tolstoi
Bekenntnisse
Aus dem russischen Manuskript übersetzt von Hermann von Samson-Himmelstjerna*
* Textquelle | Leo TOLSTOI: Bekenntnisse. | Was sollen Wir denn thun? Ev. Lucä 3, 10. Aus dem russischen Manuskript übersetzt von H[ermann] von Samson-Himmelstjerna. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot 1886, S. V-VIII, 1-102.
VORWORT DES ÜBERSETZERS
Die sozialethischen Schriften des Grafen Leo Tolstoi14 sind in mehr als einer Hinsicht bedeutsam. Schon ihr Gegenstand muss in unserer Zeit, die nach Erneuerung ihrer Weltanschauung ringt, überall lebhaftes Interesse erwecken. Es kommt dazu, dass der Verfasser mit einer wohl unübertroffenen, rückhaltlosen Offenheit und Wahrhaftigkeit und mit unwiderstehlich liebenswürdiger Schlichtheit die Konflikte schildert, die in seinem Innern entstanden sind, die Gewissensqualen, unter denen er gelitten hat. Bei der Treue und Lebendigkeit, mit welcher er sein inneres Leben aufdeckt, kann es nicht fehlen, dass ein ernster Leser an manche Frage erinnert wird, deren Lösung auch er gesucht hat.
Je mehr man von des Verfassers packender Aufrichtigkeit, von seinem rücksichtslosen Streben nach Wahrheit ergriffen worden, um so mehr wird man staunen über das Verfahren, welches seinen Schriften und seiner Person gegenüber seitens der Hierarchie beobachtet wird. Seine Schriften sucht man zu unterdrücken – freilich vergeblich: um so gieriger werden sie gelesen; und um so weniger wird der Zweck des Zensurverbotes erreicht. Die einen finden in diesen Schriften mit Vergnügen und frivolem Wohlbehagen Befriedigung ihrer Skandalsucht: Keulenschläge gegen die verhasste Geistlichkeit. Die anderen sind erfreut, dadurch in ihren sozialistischen Anschauungen und Tendenzen von autoritativer Seite gestützt und befestigt zu werden. Und da eine öffentliche Diskussion über des Verfassers Lehren ausgeschlossen worden, finden diejenigen, welche etwa seinen irrthümlichen und masslosen Konsequenzen und der damit etwa verbundenen Schädlichkeit entgegentreten möchten, keine Gelegenheit, es zu thun. – Das gemeine Volk aber in Russland, welches wohl unter allen dortigen Gesellschaftsschichten allein wahrer und tiefer Religiosität zugänglich ist, muss der Anregungen des Verfassers zu ernster Selbstprüfung und zu wahrhafter Kritik seiner Überzeugungen gänzlich entbehren; es wird wie durch einen undurchbrechlichen Ring in den Schranken sittlich unfruchtbarer Kultushandlungen festgehalten, in deren Bereiche nur Differenzen über den Werth dieser oder jener Modifikation einer rituellen Handlung, keineswegs aber belebende und sittigende Erörterungen über Inhalt und Werth der – fast unbekannten – Kirchenlehre selbst aufkommen können. So bewirkt jenes Zensurverbot, dass einestheils in den Kreisen der mehr oder weniger Gebildeten, oder der „Intelligenz“, wie man in Russland sagt, die Verachtung der Kirchenlehre und ihrer Träger gefördert und dass in diesen Kreisen sozialistischen und kommunistischen Anschauungen Vorschub geleistet wird, – und dass anderentheils die grosse Masse des Volkes, aus dessen Mitte, nach Meinung der slavophilischen Chauvinisten, wenn nicht gar heute so doch morgen ein ganz Europa erleuchtendes, erwärmendes und erneuerndes, funkelnagelneues Heil aufgehen soll – dass die grosse Masse des Volkes in tiefster hierarchischer Finsternis erhalten wird. So bewirkt jenes Zensurverbot, dass die Extreme, zwischen denen die russische Welt rathlos schwankt, immer weiter hinausgerückt werden, dass die Mitte zwischen ihnen immer weiter und unfruchtbarer wurde und mehr und mehr unbefähigt, das „neue Wort“ aus sich hervorzubringen.
Wenn der Leser damit bekannt geworden ist, wie es in der Brust eines der bedeutendsten Russen, wenn nicht gar des Allerhervorragendsten seiner Nation – den tendenziöse Gerüchte für dem Wahnsinne verfallen ausgeben15 – wie es in der Brust eines solchen Mannes aussieht; wie dort manches mit unsäglichen Schmerzen durchgelebt, erworben und entbehrt werden muss, was der Abendländer als längst Erfahrenes fast mit auf die Welt bringt, – dann wird er die Öde ermessen können, welche des Verfassers weniger ernste und strebsame Landsleute, ohne es auch nur zu ahnen, in ihrem Innern umhertragen, und die entsetzliche Frivolität, mit welcher sie sich anschicken, den „unterdrückten“ Orient zu „befreien“, und den „verfaulten“ Westen zu erneuern und zu erleuchten.
14 Des bekannten Verfassers vieler beliebter Novellen und der grossen Romane „Krieg und Frieden“ und „Anna Karenina“, nämlich: 1) „Bekenntnisse“, 2) „Worin besteht mein Glaube“. 3) „Was sollen wir denn thun“. – Davon bringt der vorliegende Band die erste und dritte, während die zweite schon früher im selben Verlage erschien. Alle diese drei religiösen Schriften sind von der russischen geistlichen Zensur unterdrückt worden und haben im Originale nicht erscheinen dürfen; sie kursiren aber von Hand zu Hand in Gestalt heimlich angefertigter Hektographien und Lithographien und werden gierig gelesen. In neuester Zeit hat der Verfasser sich darauf verlegt, seine religiösen Anschauungen durch kleine „Erzählungen fürs Volk“ zu verbreiten, welche zu 6 Pfennige das Heftchen überall verkauft und kolportirt werden. Viele derselben besitzen hohen Kunstwerth. Unter diesen Erzählungen fürs Volk sind zu nennen: „Wovon lebt der Mensch?“ – „Gott sieht das Recht, aber spricht es nicht rasch“– „Der kaukasische Gefangene“ – „Iwan der Dummkopf“ – „Zwei Greise“ – „Das Kerzlein“ – „Drei Geschichten“ – „Wo Liebe ist, da ist auch Gott“ – „Der erste Branntweinbrenner“ – „Lass dem Feuer seinen Lauf, später hältst du es nicht auf“.
15 Etwa so wie in den dreissiger Jahren Tschaadajew, vielleicht der erleuchtetste Russe aller Zeiten, offiziell für verrückt erklärt und als solcher behandelt wurde. [Pjotr Jakowlewitsch Tschaadajew, 1794- 1856: russischer Philosoph und politischer Denker. Zar Nikolaus I. ließ ihn aufgrund einer Schrift für verrückt erklären. IvH]
Tolstoi-Bildnis von Jan Vilímek (1860–1938)commons.wikimedia.org
Leo Tolstoi
Bekenntnisse
I.
Ich bin als vierter Sohn reicher Eltern zur Welt gekommen. Meine Mutter starb, als ich erst anderthalb Jahre alt war. Ich zählte neun Jahre, als mein Vater starb. Von allen Seiten ist mir gesagt worden, dass mein Vater und meine Mutter gut, gebildet, mildherzig und gottesfürchtig gewesen sind. Nach dem Tode des Vaters blieben wir unter der Obhut unsrer Tanten. Zwei Tanten, denen wir zuerst anvertraut wurden, waren sehr gutherzige, gottesfürchtige Damen. Die dritte Tante, welche die Fürsorge für uns übernahm, als ich elf Jahre alt war, und welche uns nach Kasánj überführte, war gleichfalls ein gutmüthiges Wesen (so urtheilen alle, die sie gekannt haben) und sehr fromm, so sehr, dass sie ihr Leben im Kloster beschlossen hat; dabei aber war sie leichtsinnig und hoffärtig. In Kasánj habe ich auf ihren Antrieb die Universität bezogen, habe dieselbe während dreier Jahre besucht und dann verlassen; als ich unabhängig geworden war, zog ich auf das Landgut, das mir zugefallen war.
Erzogen worden bin ich im orthodoxen christlichen Glauben. Von meiner Kindheit an hat man ihn mir gelehrt, auch zur Zeit, da man mich zum Maturitätsexamen für die Universität vorbereitete. Aber schon im Alter von zwanzig Jahren, wenn ich mich recht besinne, war mir vom Glauben nichts geblieben, wenn das, was man mir in meiner Kindheit und in der Schule gelehrt hatte, diese Bezeichnung verdient.
Ich erinnere mich, dass, als ich elf Jahre alt war, ein Knabe, ein Kamerad, der das Gymnasium besucht hatte, uns erklärte, es gäbe keinen Gott, und dass wir alle diese Nachricht als etwas Neues, Interessantes und sehr Mögliches aufnahmen, obschon wir ihm keinen Glauben schenkten.
Ferner erinnere ich mich, wie ich im Frühjahre, am Tage jenes Examens am Schwarzsee promenirt bin und zu Gott gebetet habe, er möge mich das Examen bestehen lassen, und als ich die Katechismus-Texte auswendig lernte, sah ich es klar ein, dass dieser ganze Katechismus – Lüge16 sei. Ich kann es nicht genau sagen, wann ich gänzlich aufgehört habe, zu glauben.
Die Lossagung vom Glauben ist in mir, scheint es, jedenfalls in etwas complicirterer Weise vor sich gegangen, als es, wie ich sehe, ohne Ausnahme bei allen gescheuten [sic] Leuten unsrer Zeit geschieht. Der Vorgang ist, wie mir scheint, in der Mehrzahl der Fälle der, dass die verschiedenartigsten, selbst nicht philosophischen, Kenntnisse, mathematische, naturwissenschaftliche, historische – dass die Künste, die allgemeine Lebenserfahrung – dass alles das mit seinem Lichte und seiner Wärme unmerklich, aber unausbleiblich, das künstliche Gebäude der Glaubenslehre zum Schmelzen bringt. Diese Glaubenslehre aber hat keinen Theil am Leben, sie dient dem Menschen nicht als Wegweiser durchs Leben. In den Beziehungen zu andern Leuten begegnet es einem keineswegs, mit dieser Lehre, als wäre sie die Triebkraft des Lebens, in Konflikt zu gerathen, und im Leben selbst geschieht es nie, dass man sie zu Rathe zöge, so dass der Mensch es selbst nicht weiss, ob sie in ihm noch unversehrt ist oder nicht. Und geräth man doch einmal mit der Glaubenslehre in Konflikt, so ist es, als geschähe es mit einer äusseren Erscheinung, welche in keiner Verbindung zum Leben steht.
Nach dem Leben eines Menschen und nach seinem Thun zu urtheilen, hat man weder jetzt, noch damals, es irgend erkennen können, ob Jemand ein orthodox Gläubiger sei oder nicht. Sogar im Gegentheil: in der Mehrzahl der Fälle begegnete man damals und begegnet man jetzt sittlichem Leben, Ehrenhaftigkeit, Herzensgüte am häufigsten bei nichtgläubigen Menschen. Und hinwiederum Bekenntnis orthodoxen Glaubens und ersichtliche Erfüllung seiner rituellen Vorschriften trifft man meistentheils bei Leuten an, die unsittlich, grausam und hochgestellt sind und die gewaltthätig ihren Lüsten nachgehen – dem Reichthum, Ehrgeiz, der Wollust. Ohne Ausnahme haben alle Mächtigen jener Zeit, aufrichtig oder unaufrichtig, zur Orthodoxie sich bekannt, und auch heute noch thun sie es. So also hat im Leben, als Anleitung zur sittlichen Veredlung, der orthodoxe Glaube gar keine Bedeutung; die Orthodoxie ist nur ein äusserliches Kennzeichen. Ja die Orthodoxie in ihrer Verbindung mit der Macht hat es empfunden und empfindet es. Damals hat sie verlangt und auch heute verlangt sie äussere Erfüllung der rituellen Vorschriften.
In den Schulen lehrt man den Katechismus, die Schüler treibt man in die Kirche, von den Beamten verlangt man Zeugnisse über den Abendmahlsbesuch.
Wie früher, so auch jetzt zerschmelzen dergestalt allmählich der kindliche Glaube und die gewaltsam eingerichtete Glaubenslehre unter dem Einflusse der Kenntnisse und der Lebenserfahrungen, welche mit der Glaubenslehre im Widerspruche stehen, und plötzlich erweist es sich, dass an der Stelle, welche sie eingenommen hatte, schon längst ein leerer Raum sich befindet. Folgendes hat mir mein Bruder erzählt, ein gescheuter und rechtschaffener Mensch. Als er bereits sechsundzwanzig Jahre alt war, ist er einmal im Nachtquartier, während einer Jagd, nach alter, seit der Kindheit geübter Gewohnheit, Abends zum Gebete hingekniet. Der ältere Bruder, Nikolai, lag schon im Heu und sah es. Als Ssergeí geendet und sich hingestreckt hatte, hat ihm Nikolai gesagt: „Du machst also immer noch diese Faxen?“ Und weiter ist zwischen ihnen kein Wort gewechselt worden. Von diesem Tage an hat der Bruder Ssergeí aufgehört zum Gebete hinzuknien und in die Kirche zu gehen. Nun sind es dreissig Jahre, dass er nicht gebetet hat, nicht zum Abendmahle und nicht in die Kirche gegangen ist. Und zwar nicht etwa deshalb, weil er dem Bruder gefolgt wäre, sondern weil es ihm ein Hinweis darauf gewesen war, dass schon längst vom Glauben nichts mehr vorhanden gewesen und dass nur eine sinnlose Gewohnheit nachgeblieben war.
So ist es gewesen und so pflegt es, glaub’ ich, zu sein mit der weitaus überwiegenden Anzahl der Menschen. Ich rede von den Leuten unserer Bildung, ich rede von den Leuten, die sich selbst gegenüber wahrhaft sind, nicht aber von denen, welchen der Gegenstand des Glaubens als Mittel dient zur Erreichung irgend welcher zeitlicher Ziele. (Das sind die am gründlichsten Ungläubigen, denn wenn ihnen der Glaube ein Mittel ist zur Erlangung von Macht, Geld, Ruhm, so ist das bereits kein Glaube.) Diese Leute unsrer Bildungsstufe befinden sich in der Lage, dass das Licht der Kenntnisse und des Lebens bereits das künstliche Gebäude zerschmelzen gemacht hat, und dass sie dessen inne geworden sind; nicht etwa, dass sie es fortgeworfen hätten – da war bereits nichts zum Fortwerfen –: sie hatten den Platz frei gemacht, oder aber sie hatten die Lücke selbst noch nicht bemerkt.
Eben dies war auch der Fall bei jener Tante, die uns in Kasánj erzogen hatte. Ihr ganzes Leben lang war sie fromm gewesen. Aber als sie, fast achtzig Jahre alt, zum Sterben kam, wollte sie nicht das Abendmahl nehmen; den Tod fürchtend, ärgerte sie sich über alle darum, weil sie leide und hinsterbe, und offenbar erst vor dem Tode hat sie es eingesehen, dass alles, was sie im Leben gethan hatte, unnöthig gewesen war.
Das künstliche Gebäude der Glaubenslehre ist in mir ebenso verschwunden, wie in anderen, nur mit dem Unterschiede, wie er bei Leuten forschbegierigen und zur Philosophie geneigten Geistes sich zeigt. Schon mit sechzehn Jahren habe ich begonnen, mich mit Philosophie zu beschäftigen, und sofort zerflog die ganze Verstandesconstruction der Theologie zu Staub, wie sie ihrem Wesen nach gegenüber den Forderungen des gesunden Menschenverstandes zerfliegen muss. Derart bin ich verstandesmässig schon sehr frühzeitig ein Ungläubiger geworden, – sehr zeitig schon habe ich den Platz gesäubert, auf welchem das Lügengebäude gestanden hatte. Aber eine gewisse Vorliebe zum Guten, ein Streben nach sittlicher Veredlung blieb noch sehr lange in mir lebendig.
Ich kann es nicht behaupten, dass dieses Streben in meinem kindlichen Glauben begründet gewesen sei. Ich konnte und kann darüber nichts wissen; ich meine nicht, dass es der Fall gewesen sei, denn eine Richtschnur zu sittlicher Veredlung habe ich nicht in geistlichen Schriftwerken, selbst nicht im Evangelium gesucht – die Lüge, die Widersinnigkeit der ganzen Glaubenslehre stiessen mich von jeder Anknüpfung daran zurück – , vielmehr in der weltlichen, antiken und modernen, Litteratur habe ich die Richtschnur gesucht. Ich vermag jedoch auch nicht zu behaupten, dass es nicht eine Folge meines kindlichen Glaubens gewesen sei, worauf derselbe auch gegründet gewesen sein mag.
Die ersten zehn Jahre meines Jugendlebens verbrachte ich in diesen Bestrebungen nach Veredlung. Und dieses Suchen und Ringen bildete das Hauptinteresse jener Zeit. Aus dieser ganzen Epoche habe ich noch Tagebücher bewahrt, welche niemanden interessiren, mit Franklinschen Tabellen, mit Regeln zur Erlangung der Vollkommenheit.
Das dauerte etwa zehn Jahre, wenn nicht länger; mit der Zeit aber begann das Streben zu verlöschen, immer mehr zu verlöschen und war schliesslich ganz erloschen. Ja es ist von diesem Streben nichts übrig geblieben – ein anderes ist an seine Stelle getreten –, und ich blieb ohne irgend welche Richtschnur fürs Leben.
II.
Bevor ich davon rede, was an Stelle dieses Strebens getreten ist, kann ich nicht anders, als der traurigen, ergreifenden Lage zu erwähnen, in welcher ich während dieser zehn Jahre mich befunden habe. Irgend wann werde ich die Geschichte meines Lebens erzählen und die ergreifende, lehrreiche Geschichte dieser zehn Jahre. Ich meine, dass gar sehr viele dasselbe durchgemacht haben. Von ganzer Seele wünschte ich gut zu sein; ich war aber jung, ich besass Leidenschaften und ich stand allein da, vollständig allein mit meinen Bestrebungen. Ich war kühn: aber jedesmal wenn ich das, was in mir Gutes war, auszusprechen versuchte, begegnete ich Verachtung und Verhöhnung; sobald ich jedoch meinen scheusslichen Leidenschaften mich überliess, wurde ich mit offenen Armen empfangen.
Ehrgeiz, Herrschsucht, Eigennutz, Wollust – das alles stand in Ansehen.
Indem ich diesen Leidenschaften mich hingab, wurde ich einem Erwachsenen ähnlich und man achtete mich. Die gute Tante hat mir immer gesagt, dass sie für mich nichts so sehnlichst herbei wünsche, als ein Verhältnis mit einer verheiratheten Frau: „rien ne forme un jeune homme, comme une liaison avec une femme comme il faut“ –, und dass ich Adjutant werde, am besten beim Kaiser, und dass ich soviel als nur möglich leibeigne Bauern habe.
Ohne Entsetzen, Ekel und Herzweh vermag ich nicht an diese Jahre zurück zu denken. Es gab keine Laster, denen ich in jenen Jahren nicht gefröhnt hätte, es gab kein Verbrechen, das ich nicht begangen hätte. Lüge, Diebstahl, Buhlerei aller Art, Völlerei, Vergewaltigung, Todtschlag – alles habe ich begangen, und ich wünschte nur allein das Gute, und meines gleichen haben mich für einen relativ sittlichen Menschen gehalten und auch jetzt noch halten sie mich dafür.
Ich lebte auf meinem Gute und vertrank, verspielte und verschlemmte, was die Bauern erarbeitet hatten; ich strafte und peinigte sie, benutzte sie zu meinen Ausschweifungen, verkaufte und betrog sie, und für alles das wurde ich gelobt. Und ohne Ausnahme hat man mich verachtet und verlacht um des Guten willen, das ich zu thun versucht habe.
So habe ich zehn Jahre gelebt. Ich hatte auch Augenblicke der Reue, es kamen Versuche, mich zu bessern, vor; aber der breite Weg war gar zu bequem und ich verfolgte ihn weiter.
Zu jener Zeit bin ich im Kriege gewesen und habe gemordet und zur selben Zeit begann ich zu schreiben, aus Hoffart und Hochmuth. In meinen Schriften that ich dasselbe wie in meinem Leben. Um den Ruhm zu erlangen, um dessentwillen ich schrieb, musste das Gute verheimlicht und das Schlechte ausgesprochen werden. So habe ich es denn auch gethan. Wie oft habe ich es listig auskünsteln müssen, um in meinen Schriften unter dem Anscheine der Gleichgültigkeit oder gar leichten Spottes jene meine Strebungen zum Guten zu verbergen, welche den Grundgedanken meines Lebens bildeten. Und ich habe es erreicht. Man lobte mich. Mit achtundzwanzig Jahren zog ich, nach dem Kriege, nach Petersburg und trat in Verkehr mit den Schriftstellern. Man nahm mich als ebenbürtig auf, man schmeichelte mir. Und ich hatte keine Zeit, es zu bemerken, wie die zunftmässigen Lebensanschauungen der Leute, mit denen ich in Verkehr getreten war, sich meiner bemächtigten und wie sie an Stelle fast aller meiner früheren Bestrebungen nach Veredlung traten. Ich sage „fast aller“: denn wiewohl es in den von Leidenschaften freien Augenblicken nicht eigentlich früheres Streben nach Veredlung gab, so empfand ich doch dunkel, in jener Periode, dass mein Leben kein echtes sei, und ich suchte nach irgend einem Etwas. Bereits schrieb ich nicht mehr Franklinsche Tagebücher, ich sass nicht mehr zu Gericht über meine Vergehen, ich empfand keine Reue – mein Leben erschien mir so übel nicht. Die Lebensanschauung dieser Leute, meiner Kameraden in der Schriftstellerei, bestand in der Meinung, dass im allgemeinen das Leben sich entwickelt und dass an dieser Entwickelung den Hauptantheil wir haben, wir die Männer des Gedankens, und dass unter den Männern des Gedankens den Haupteinfluss wir haben, die Künstler, die Poeten. Unser Beruf ist – die Leute zu belehren. Damit aber die sehr natürliche Frage: „was weiss ich und was kann ich lehren?“ sich einem nicht aufdränge, war es in dieser Theorie klar gelegt, dass man das gar nicht zu wissen brauche, und dass der Künstler, der Poet unwissentlich belehre. Ich hielt mich für einen wunderbaren Künstler und Poeten und darum war es mir sehr natürlich, diese Theorie mir anzueignen. Man zahlte mir dafür Geld, ich hatte vorzügliches Essen, gute Wohnung, Weiber, Gesellschaft; ich war berühmt. Und während recht langer Zeit, drei Jahre lang, habe ich daran geglaubt. Je länger ich aber in diesen Gedanken lebte, um so häufiger stellten sich Zweifel ein. Dieser Glaube an die Entwickelung des Lebens, an die Kunst und Poesie, es war ein Glaube und ich war seiner Priester einer. Sein Priester zu sein, war sehr vortheilhaft und angenehm, aber ich besass genug Befähigung zur Abstraktion und zur Beobachtung, um irre zu werden an diesem Glauben, um so mehr, als die Priester desselben nicht alle unter einander einig waren. Die einen sagten: so, in dieser Weise müssen die Mysterien vollzogen werden: die andern sagten: nein, anders. Sie stritten, zankten, schalten, betrogen, trieben Schelmereien. Ausserdem gab es unter den Priestern viele Leute, die an den Glauben nicht glaubten, vielmehr einfach mit Hülfe dieses Glaubens ihre eigennützigen Zwecke erreichten.
Fast alle Priester waren unsittliche Leute und der Mehrzahl nach schlechte Menschen, nichtswürdig ihrem Charakter nach – viel niedriger stehend, als jene Leute, denen ich in meinem früheren lockeren Leben und in meinem Kriegsleben begegnet war. Aber Dünkel gab es ohne Ende. Ihre Gesellschaft wurde mir zuwider und ich begriff, dass es Lüge war. Sonderbar aber war eins: wiewohl ich bald diese ganze Lüge durchschaut und von ihrem Glauben mich losgesagt hatte, so sagte ich mich doch nicht los von dem Range, den sie mir verliehen hatten, – von dem Range eines Künstlers, Poeten, Lehrers. Naiv bildete ich mir ein, dass ich ein Poet, ein Künstler sei, und dass ich, ohne was zu wissen, alle belehren könne, selbst nicht wissend, worüber. Und so that ich denn auch.
Aus dem Verkehr mit diesen Menschen hatte ich ein neues Laster davongetragen, den Hochmuth, und ich kann es nicht anders als einen Wahnsinn nennen, diese Überzeugung, dass ich berufen sei, die Leute zu belehren, ohne selbst zu wissen, worüber. Wenn ich jetzt an jene Zeit zurückdenke und an meine damalige Gemüthsverfassung und an die Gemüthsverfassung jener Leute (solcher giebt es übrigens auch jetzt zu Tausenden), so wird mir traurig, schrecklich und lächerlich zu Muthe – es ist gerade die Empfindung, die einen in einem Irrenhause überkommt. Wir alle waren damals überzeugt, dass wir reden, reden, schreiben und drucken lassen mussten – so rasch wie möglich, so viel wie möglich, dass alles das nöthig sei fürs Wohl der Menschheit. Und tausende von uns, uns gegenseitig widersprechend und schimpfend, alle liessen wir drucken, und schrieben, die andern belehrend und dabei nicht bemerkend, dass wir nichts wussten, dass wir auf die einfachste Lebensfrage: soll man so oder anders handeln? – nicht zu antworten wussten, und dass wir, ohne einander anzuhören, alle zugleich redeten, genau wie in einem Irrenhause.
Tausend Arbeiter arbeiteten, Millionen von Worten liessen sie drucken und die Post verbreitete sie über ganz Russland, wir aber belehrten immer mehr noch, und konnten es nicht fertig bringen, über alles zu belehren, und alle ärgerten wir uns darüber, dass man sich von uns so wenig berathen lasse. Anders kann man das nicht nennen als Irrsinn, Trunkenheit, Geschwätz.
Entsetzlich sonderbar war es, aber jetzt ist es mir begreiflich. Eines der Hauptdogmen jenes Glaubens besagte: alles entwickelt sich, die Bildung ist das Heil. Die Bildung wird bemessen an der Verbreitung von Büchern, von Zeitungen. Ferner: aus dem Zusammenstosse der Meinungen geht die Wahrheit hervor und alles, was besteht, ist vernünftig; uns aber zahlt man Geld und man ehrt uns dafür – wie sollte man da nicht belehren?
Jetzt ist es mir klar, dass ein Unterschied gegenüber einem Irrenhause nicht existirt; damals aber habe ich das nur dunkel geargwöhnt, und auch das nur wie alle Irrsinnigen – ich nannte alle wahnsinnig, nur nicht mich selbst. Von der Zeit an verfiel ich diesem Wahnsinne des Belehrens ohne selbst was zu wissen. Und wie ich jetzt glaube: gerade darum war ich besonders hitzig bemüht, zu belehren, weil ich empfand, dass ich nichts wisse; ich fürchtete dieses Nichtwissen und ich bemühte mich, durchs Belehren das Entsetzliche des Nichtwissens in mir zu betäuben.
III.
So lebte ich, dieser Leidenschaft des Belehrens mich hingebend, noch sechs Jahre, bis zu meiner Verheirathung. Meine Kameraden, die Journalisten, waren mir widerwärtig geworden: ich hatte ihre Schwächen erkannt, hatte erkannt, dass sie zum Belehren nichts besassen; aber an mir selbst hatte ich dasselbe nicht beobachtet. Und da verfiel ich drauf, mit Bauerschulen mich zu befassen. Und ich verliebte mich in diese Beschäftigung, denn ich hatte da einen wirren Stützpunkt, von welchem aus ich belehren und die journalistischen Lehrer verleugnen konnte.
Dass mein Stützpunkt ein wirrer war, das war kein Unglück, denn ihr Stützpunkt war noch verworrener. Und ich fing an, sowohl das Volk zu belehren, als auch die Gebildeten – alle. Aber die ganze Zeit über empfand ich es, dass ich geistig nicht ganz gesund sei, und lange empfand ich es, und das konnte so nicht fortgehen. Und ich wäre vielleicht damals schon zu jener Verzweiflung gelangt, zu der ich bei fünfzig Jahren gelangt bin, wenn ich nicht in mir noch ein Lebensfundament besessen hätte, das mich zu jener Zeit aufrecht erhielt: das war die Vorstellung vom Familienleben, von der Liebe zu dem vorgestellten Weibe. Träume vom Familienleben, von der Liebe zum Weibe haben mich meine ganze Jugend hindurch begleitet, vom fünfzehnten Jahre an, jetzt aber waren sie noch intensiver geworden. Und ich heirathete. Die neuen Lebensbedingungen, der Einfluss einer guten Frau – das liess mich wieder ausruhen. Der Wahnsinn meines Lehrerthums nahm seinen Fortgang: ich schrieb auch als Ehemann; der Erfolg meiner Bücher machte mir Freude. Aber für diese Zeit war der Hauptgedanke meines Lebens die Familie, die Sorge um Vergrösserung der Mittel fürs Leben der Familie, die Gattin, die Kinder. So vergingen wieder zehn Jahre. Allmählich war ich zu mir gekommen, meine Leidenschaft fürs Belehren hatte abgenommen, und ich fing an mich zu fragen: was lehre ich? … Und es erwies sich, dass ich alle belehren könne, aber entschieden nicht wisse, was meinen Kindern zu lehren, dass ich entschieden nicht wisse, was ich selbst sei, wozu ich lebe, sei es gut, sei es schlecht; und es fingen Stimmungen an mich zu überkommen, wie der Verzweiflung, als stehe mein Leben stille, als wisse ich nicht, wie zu leben, was zu thun. Anfangs kamen sie nur vorübergehend – im Leben gab ich mich den früheren Gewohnheiten hin, ich lehrte auch –, dann aber immer häufiger, und darauf, zur Zeit da ich schrieb und mein Buch „Anna Karenina“ geendet hatte, stieg meine Verzweiflung soweit, dass ich nichts anderes thun konnte, als nur denken, nur denken an die entsetzliche Lage, in der ich mich befand. Zuerst war es mir erschienen, als seien es nur – zwecklose, unpassende Fragen. Es schien mir, dass das alles bekannt sei, und wenn ich nur einmal mit ihrer Lösung mich abgeben wolle, so könne mir das keine Mühe machen, – dass ich aber jetzt keine Zeit habe, mich damit zu befassen, aber wenn es mir einmal einfalle, so werde ich die Antworten finden. Aber immer häufiger und häufiger fingen die Fragen an sich zu wiederholen, immer dringlicher verlangte es nach Antworten, und wie Punkte, die alle auf eine Stelle hinfallen, drängten sich diese unbeantworteten Fragen zusammen zu einem schwarzen Fleck. Und mit Entsetzen und im Bewusstsein meiner Kraftlosigkeit blieb ich vor diesem Flecke stehen.
Ich zählte fast fünfzig Jahre, als diese unbeantworteten Fragen mich zu der schrecklichen, gänzlich unerwarteten Lage gebracht hatten. Es war dahin gekommen, dass ich – ein gesunder, glücklicher Mensch – es empfand, dass ich nicht mehr leben könne: irgend eine unbestimmbare Macht riss mich dazu fort, dass ich mich irgend wie des Lebens entledige. Ich kann nicht eben sagen, dass ich mich tödten wollte. Die Kraft, welche mich zum Selbstmorde fortriss, war stärker, vollständiger, allgemeiner, als das Wollen und Wünschen. Es war das eine Macht, ähnlich der vormaligen Lebensbestrebung, nur in umgekehrter Beziehung. Mit allen Kräften strebte ich fort vom Leben. Und dieses Streben war so mächtig, dass ich Schnüre fortthat, um mich nicht an der Querleiste zwischen den Schränken meines Zimmers zu erhängen, wo ich allabendlich beim Auskleiden allein war, und dass ich aufhörte mit einer Flinte auszugehen. Ich wusste selbst nicht, was ich wollte; ich fürchtete das Leben, ich strebte fort von ihm und ich fürchtete den Tod.
Und das geschah mir zu der Zeit, da mir von allen Seiten geworden war, was als vollkommenes Glück angesehen wird; es war damals, als ich fast fünfzig Jahre alt war. Ich besass eine gute, achtungswerthe, schöne, liebende und geliebte Ehefrau, gute Kinder, ein grosses Vermögen, welches, ohne dass ich mich zu mühen brauchte, anwuchs und sich vergrösserte. Ich wurde mehr als jemals von den mir Nahestehenden und Bekannten geachtet, von Fremden wurde ich gelobt, und ohne besondere Selbstüberhebung konnte ich meinen, dass mein Name berühmt sei. Bei alledem war ich nicht nur nicht gestört oder geisteskrank, – im Gegentheil, ich erfreute mich solcher geistiger und körperlicher Kraft, wie ich bei meinesgleichen selten angetroffen habe. Körperlich vermochte ich beim Heumähen zu arbeiten, ohne den Bauern nachzustehen. Geistig vermochte ich zu achtzehn Stunden in einem Zuge zu arbeiten, ohne von solcher Anspannung irgend welche Folgen zu verspüren. Und in solcher Verfassung kam ich darauf heraus, dass ich nicht leben könne und dass ich, bei meiner Furcht vor dem Tode, List gegen mich selbst anwenden müsse, damit ich mir nicht das Leben nehme, welches ich fürchtete.