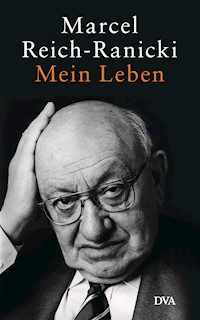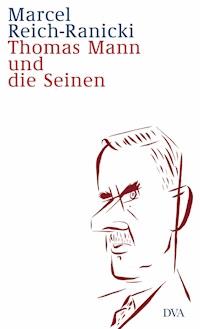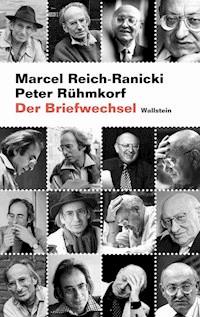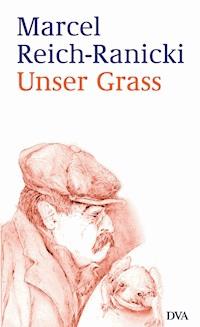9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Literaturgeschichte für jedermann: Reich-Ranickis beste, klügste, schärfste Essays zur deutschen Literatur seit 1945
Marcel Reich-Ranicki war ein halbes Jahrhundert lang der erfolgreichste, wirkungsvollste und deshalb auch umstrittenste Literaturkritiker. Wie kein anderer hat er das literarische Leben der Nachkriegszeit bis in das 21. Jahrhundert hinein mitgeprägt – als Kritiker in der Gruppe 47, in den Feuilletons einflussreicher Zeitungen und mit ständig wachsender Popularität im Fernsehen mit seinem legendären Literarischen Quartett. Nach seiner 2014 erschienenen Geschichte der deutschen Literatur seit dem Mittelalter konzentriert sich dieser Band ganz auf jene Zeit, die für ihn wie für sein Publikum die Gegenwart war, auf die deutsche Literatur seit 1945.
Das von Thomas Anz herausgegebene Buch ist eine erstmals zusammengestellte Auswahl der wichtigsten und besten Veröffentlichungen Reich-Ranickis zur Gegenwartsliteratur, seiner Entdeckungen und Provokationen, Lobreden und Verrisse, Beiträge zu Debatten und rückblickenden Bilanzen. Der Band vermittelt damit ein Bild der Literatur seit 1945, das anschaulicher und lebendiger kaum sein kann. Und er zeigt erneut: Ohne Marcel Reich-Ranicki wäre das literarische Leben der vergangenen Jahrzehnte sehr viel ärmer gewesen – und erheblich langweiliger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 810
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Marcel Reich-Ranicki
Meine deutsche Literatur seit 1945
Herausgegeben von Thomas Anz
Deutsche Verlags-Anstalt
Für Marcel Reich-Ranickis Urenkel Nico Marcel Vallauri, geboren am 4. März 2015
Inhalt
Einleitung: Der Kritiker Marcel Reich-Ranicki im literarischen Leben seiner Zeit
Von Thomas Anz
Von der Gruppe 47 bis zur Politisierung um 1968
Die deutschen Schriftsteller und die deutsche Wirklichkeit (1967)
Kritik auf den Tagungen der Gruppe 47 (1962)
Politik in den Pausen
Rückblick auf die diesjährige Tagung der Gruppe 47 (1967)
Das Ende der Gruppe 47
Ein Abschiedstreffen in Saulgau (1977)
»Das ist furchtbar, daß alles so sinnlos ist«
HEINRICH BÖLL: »Und sagte kein einziges Wort« (1957)
Ein Eisenbahner aus der DDR
Zu UWE JOHNSONS Roman »Mutmaßungen über Jakob« (1959)
Auf gut Glück getrommelt
Spielereien und Schaumschlägereien verderben die Zeitkritik des GÜNTER GRASS (1961)
Ein Gesellschaftskritiker mit Poesie und Humor
WOLFDIETRICH SCHNURRE gehört zu den besten deutschen Erzählern der Nachkriegszeit (1961)
Die Geschichte des Ritterkreuzträgers
GÜNTER GRASS: »Katz und Maus« (1961)
Der Fall WOLFGANG KOEPPEN
Ein Lehrbeispiel dafür, wie man in Deutschland mit Talenten umgeht (1961)
Deutsche Unterhaltungsliteratur (1962)
Der Zeuge KOEPPEN (1963)
Der Romancier MAX FRISCH (1963)
ALFRED ANDERSCH, ein geschlagener Revolutionär (1963)
Die Geschichte einer Liebe ohne Ehe
HEINRICH BÖLL spann seinen Roman »Ansichten eines Clowns« aus Fäden von unterschiedlicher Qualität (1963)
SIEGFRIED LENZ, der gelassene Mitwisser (1963)
Der wackere Provokateur MARTIN WALSER (1963)
ROLF HOCHHUTH und die Gemütlichkeit (1964)
In einer deutschen Angelegenheit (1964)
Engagierte Literatur – wozu?
Bemerkungen zu einer wichtigen Rede von MAX FRISCH (1964)
Der Dichter ist kein Zuckersack
Der SED-Staat fürchtet den Poeten WOLF BIERMANN (1965)
… die uns überleben werden
MARIE LUISE KASCHNITZ’ neue Erzählungssammlung (1966)
Verbeugung vor einem Raubtier
Die Theaterschriften und Reden FRIEDRICH DÜRRENMATTS (1966)
Bitterkeit ohne Zorn
Die Erzählungen der GABRIELE WOHMANN (1967)
Der exemplarische Weg …
… des Ostberliner Schriftstellers FRANZ FÜHMANN (1967)
Selfmadeworld in Halbtrauer
Das Werk ARNO SCHMIDTS (1967)
Gammler, Gauner, Ganoven
HUBERT FICHTES erstaunlicher Roman »Die Palette« (1968)
Außerordentlich (und) obszön
ROLF DIETER BRINKMANNS Sex-Roman »Keiner weiß mehr« (1968)
Ironisches und Groteskes aus Ostberlin
Die Erzählungen des GÜNTER KUNERT (1968)
Finstere Wollust aus Österreich
Die Erzählungen des THOMAS BERNHARD (1968)
Dies Marrakesch ist überall
ELIAS CANETTIS hintergründige Reiseskizzen (1968)
Von der Neuen Subjektivität bis zum Fall der Mauer
Die Literatur des kritischen Psychologismus
Ein Rückblick (1977)
UWE JOHNSONS neuer Roman
Der erste Band des Prosawerks »Jahrestage« (1970)
Eine saubere Welt, die DDR
HERMANN KANTS Roman »Das Impressum« (1972)
Die Angst des PETER HANDKE beim Erzählen (1972)
Am liebsten beim Friseur
INGEBORG BACHMANNS neuer Erzählungsband »Simultan« (1972)
Der Fänger im DDR-Roggen
ULRICH PLENZDORFS jedenfalls wichtiger Werther-Roman (1973)
Liebe zum Mittelmaß
Ein neuer Roman des DDR-Autors JUREK BECKER (1973)
Der deutschen Gegenwart mitten ins Herz
Eine unpathetische Anklage: HEINRICH BÖLLS Erzählung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« (1974)
Der Intellektuelle auf der Flucht vor dem Kollektivgespenst
NICOLAS BORNS Roman »Die erdabgewandte Seite der Geschichte« (1976)
BIERMANNS Vertreibung
Anmerkungen zu einem aktuellen Fall (1976)
NOSSACK – der nüchterne Visionär
Zum Tode eines großen Repräsentanten der deutschen Prosa nach 1945 (1977)
Zeugenschaft eines Einsamen
Laudatio auf HANS JOACHIM SCHÄDLICH, den Träger des Rauriser Literaturpreises 1977
THOMAS BERNHARDS entgegengesetzte Richtung
Seine autobiographischen Erzählungen »Die Ursache«, »Der Keller« und »Der Atem« (1978)
Der Droste jüngere Schwester
Über die Lyrik der SARAH KIRSCH (1980)
Angeklagt
Eine Attacke gegen CHRISTA WOLF im »Neuen Deutschland« (1980)
WOLF WONDRATSCHEK oder Poesie in Jeans
Zu den vier Sammlungen der Gedichte, Lieder und Chansons des erfolgreichen Lyrikers (1981)
Die Leiden des Dichters ERICH FRIED
Aus Anlass seiner neuen Lyrikbände (1982)
Der verlorene Sohn sucht den Frauenkontinent
HERMANN BURGERS Roman »Die Künstliche Mutter« (1982)
Der poetische Lehrmeister
Zum Tode des Schriftstellers MANÈS SPERBER (1984)
Manchmal wurde die Langeweile schier unerträglich
Der Roman »Der junge Mann« des erfolgreichen Autors BOTHO STRAUSS (1984)
Ein Germanist wird ermordet
FRIEDRICH DÜRRENMATTS Roman »Justiz« (1985)
Meisterin der Stille
Zum sechzigsten Geburtstag der Dichterin ELISABETH BORCHERS (1986)
Das Wappen mit dem Fragezeichen
Laudatio auf HILDE SPIEL zur Verleihung des Ernst-Robert-Curtius-Preises für Essayistik (1986)
Macht Verfolgung kreativ?
Polemische Anmerkungen aus aktuellem Anlass: CHRISTA WOLF und THOMAS BRASCH (1987)
Von der deutschen Einheit bis zum 21. Jahrhundert
Zwischen den Welten
Über die Schriftstellerin HILDE SPIEL und ihre Schwierigkeiten, eine Heimat zu finden (1991)
Der Billardmörder
CHRISTOPH HEINS »Napoleon-Spiel« (1993)
Vom Trotz getrieben, vom Stil beglaubigt
Rede auf RUTH KLÜGER aus Anlass der Verleihung des Grimmelshausen-Preises (1993).
… und es muss gesagt werden
Ein Brief an GÜNTER GRASS zu dessen Roman »Ein weites Feld« (1995)
INGO SCHULZE: »33 Augenblicke des Glücks«
Aus dem Literarischen Quartett am 19. Oktober 1995
Der Liebe Fluch
Über MONIKA MARONS Roman »Animal triste« (1996)
BIRGIT VANDERBEKE: »Alberta empfängt ihren Liebhaber«
Aus dem Literarischen Quartett am 11. Dezember 1997
BRIGITTE REIMANN: »Alles schmeckt nach Abschied. Tagebücher 1964–1970«
Aus dem Literarischen Quartett am 24. April 1998
JUDITH HERMANN: »Sommerhaus später«
Aus dem Literarischen Quartett am 30. Oktober 1998
ELKE SCHMITTER: »Frau Sartorius«
Aus dem Literarischen Quartett am 14. April 2000
MAXIM BILLER: »Die Tochter«
Aus dem Literarischen Quartett am 14. April 2000
SVEN REGENER: »Herr Lehmann«
Aus dem Literarischen Quartett am 17. August 2001
WILHELM GENAZINO: »Ein Regenschirm für diesen Tag«
Aus dem Literarischen Quartett am 17. August 2001
Jenseits des Schreckens tanzende Paare
Zu den neuen Gedichten von GÜNTER GRASS (2003)
Das künstliche Paradies
UNDINE GRUENTERS letzter Roman »Der verschlossene Garten« (2004)
Der Misere unserer Zeit hielt er sein Gedicht entgegen
Ein Poet in der Defensive: Zum Tod von PETER MAIWALD (2008)
Anhang
Literaturhinweise
Editorische Notiz
Nachweise
Personenregister
EinleitungDer Kritiker Marcel Reich-Ranicki im literarischen Leben seiner Zeit
Von Thomas Anz
1955 veröffentlichte eine der beiden wichtigsten Literaturzeitschriften der DDR, die »Neue Deutsche Literatur«, einen Aufsatz mit dem Titel »Probleme des deutschen Gegenwartsromans«. Sie stellte den Autor einleitend so vor: »Der Verfasser dieses Beitrages ist ein bekannter polnischer Literaturkritiker, der seit langem dem Schaffen der deutschen Schriftsteller große Aufmerksamkeit widmet. Sein Aufsatz ist in der Zeitschrift ›Tworczosc‹, unserem polnischen Schwesterorgan, erschienen.«
Von Marceli Ranicki, wie er sich damals nannte, war in der DDR bereits im Frühjahr 1953 ein vorher auf Polnisch publizierter Artikel erschienen, in »Sinn und Form«, sein erster in deutscher Sprache. Er führte zu einem Eklat, den Volker Hages ausführlicher »Biographischer Essay« über Reich-Ranicki 1995 und später Uwe Wittstocks Biographie eingehend beschrieben haben. Dem Dichter und damaligen Kulturminister Johannes R. Becher hatte der Kritiker beiläufig vorgehalten, dass es ihm, ähnlich wie Bertolt Brecht oder Ernst Toller und anders als dem eben gestorbenen Erich Weinert, nicht gelungen sei, sich in seiner Jugend »der Versuchung des Expressionismus zu widersetzen«, der »so fatal auf die damals entstehende deutsche revolutionäre Dichtung einwirkte« und der Arbeiterklasse unverständlich blieb.
Diese negative Einschätzung des Expressionismus entsprach zwar der des in der DDR hoch angesehenen marxistischen Literaturtheoretikers Georg Lukács, aber Becher reagierte empört und warf dem Herausgeber der Zeitschrift vor: »Ihr benutzt einen toten Genossen, um einen lebenden zu beschmutzen«. In dem Aufsatz von 1955 allerdings wird Becher persönlich von Marceli Ranicki sehr gelobt, vorbehaltloser als jedes der rezensierten Bücher. Doch auch hier verschont er die in der DDR betriebene Kulturpolitik nicht mit Vorwürfen. Dass die besprochenen Bücher die in Bodo Uhse, Willi Bredel und Anna Seghers gesetzten Hoffnungen nicht ganz erfüllen, schreibt der Kritiker nicht zuletzt den negativen Auswirkungen der damaligen Kulturpolitik zu: »Einen gewissen Einfluss darauf haben zweifellos die Fehler ausgeübt, die in der Kulturpolitik der Deutschen Demokratischen Republik in den vergangenen Jahren gemacht worden sind. (…) Man unterschätzte die Fragen der Form und ging an die Problematik des sozialistischen Realismus engherzig und sektiererisch heran.«
Der älteste Artikel Reich-Ranickis, der in der hier vorgelegten Sammlung seiner Beiträge zur deutschen Literatur seit 1945 abgedruckt ist, erschien ebenfalls in einer polnischen Zeitschrift, wurde aber erst jetzt für dieses Buch erstmals ins Deutsche übersetzt. Es ist eine Rezension zu Heinrich Bölls Roman »Und sagte kein einziges Wort«. Er hat sie 1957 veröffentlicht, fast zeitgleich mit einer Besprechung zu Wolfgang Koeppens »Tod in Rom«, und sie steht hier nur als ein Beispiel für Wandlungen und Interessenverschiebungen in der Karriere des jungen Literaturkritikers, von denen die Auswahl seiner Artikel für diesen Band mitgeprägt ist. Die »Problematik des sozialistischen Realismus« und der kommunistischen Kulturpolitik verliert an Bedeutung, das Interesse vor allem an Autorinnen und Autoren, die schon vor 1945 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt waren, die ihre literarische Laufbahn nach Kriegsende in Deutschland fortsetzten und die in der DDR publizierten, bleibt zwar erhalten, aber neu hinzu kommt die intensive Beschäftigung mit einer jüngeren Generation von Autoren in beiden Teilen Deutschlands, deren literarische Karriere erst nach 1945 begann.
Eine der letzten Rezensionen Marceli Ranickis in polnischer Sprache, 1958 erschienen in der Zeitschrift »Twórczość«, bespricht unter dem Titel »Neue deutsche Prosa« die Romane »Sansibar« von Alfred Andersch und »Der Mann im Strom« von Siegfried Lenz. Kurz vorher veröffentlichte Marceli Ranicki in der Warschauer Zeitschrift »Politika« noch eine Besprechung zu Max Frischs »Homo faber«. Andersch, Böll, Frisch, Koeppen und Lenz gehören zu den Autoren und Autorinnen, die mit dem Titel dieses Bandes »Meine deutsche Literatur seit 1945« gemeint sind. Es sind seine in dem Sinn, dass er ihre literarische Entwicklung von Anfang an und über Jahrzehnte hinweg kritisch begleitet hat – mit Lobreden und Verrissen, Hoffnungen und Enttäuschungen und zuletzt in vielen Fällen mit einem Nachruf.
Nachdem Marceli Ranicki 1958 Polen verlassen hatte und als er in der Bundesrepublik unter dem neuen Namen Marcel Reich-Ranicki sehr bald und über ein halbes Jahrhundert hinweg zum prominentesten, einflussreichsten und umstrittensten Literaturkritiker seiner Zeit wurde, erweiterte sich der Kreis seiner Autoren ständig. Kontinuierlich setzte er sich mit Hans Erich Nossack, Wolfdietrich Schnurre, Friedrich Dürrenmatt, Ingeborg Bachmann, Martin Walser, Günter Grass oder Uwe Johnson auseinander und nun auch mit jüngeren Autoren aus der DDR, die das literarische Nachkriegsleben dort mitprägten: Stephan Hermlin, Erwin Strittmatter oder Franz Fühmann. Später kamen neue hinzu: Friedrich Dürrenmatt, Erich Fried, Christa Wolf, Gabriele Wohmann, Marie Luise Kaschnitz, Hilde Spiel, Rolf Dieter Brinkmann, Ulrich Plenzdorf, Wolf Biermann, Thomas Bernhard, Sarah Kirsch, Wolf Wondratschek, Patrick Süskind und viele mehr. Über einige von ihnen hat er so oft geschrieben, dass seine Aufsätze über sie in gesonderten Büchern erschienen. Und einige kann man mit Recht als seine »Entdeckungen« ansehen, die er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen versuchte – mit großem, aber vielfach auch begrenztem Erfolg: Ulla Hahn etwa, Peter Maiwald oder Hermann Burger, für den er sich bereits als Sprecher der Jury beim Klagenfurter Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis stark machte. Seiner mündlichen Kritik später im »Literarischen Quartett« hatte vor allem Ruth Klüger viel zu verdanken, aber sie kam auch einigen der Autorinnen und Autoren zugute, die zum Erscheinungsbild der jüngeren deutschen Literatur im 21. Jahrhundert gehören: Ingo Schulze, Judith Hermann oder Maxim Biller.
Die Lektüre dessen, was Reich-Ranicki über all diese Autorinnen und Autoren geschrieben oder auch nur gesagt hat und was für diese bisher umfangreichste Sammlung seiner Beiträge zur Literatur seit dem Ende des Krieges ausgewählt wurde, ist eine Art Erinnerungsreise durch die deutschsprachige Literaturgeschichte eines halben Jahrhunderts. Er hat sie begleitet und er war ein Teil von ihr.
»Meine deutsche Literatur seit 1945« versteht sich als Ergänzung zu dem ein Jahr nach Reich-Ranickis Tod erschienenen Buch »Meine Geschichte der deutschen Literatur«, das vom »Mittelalter bis zur Gegenwart« reicht. Diese vermittelt ein Bild jener Literatur, in der er seine Heimat fand, und zeigt, dass der Literaturkritiker die bedeutenden Autoren und Autorinnen der Vergangenheit nie aus den Augen verloren hat. Aber zur Literaturkritik als Beruf gehört vor allem die Auseinandersetzung mit Neuerscheinungen und die Aufgabe, das literarische Leben der Gegenwart zu beobachten und an ihm teilzuhaben. So ist denn auch die Zahl von Reich-Ranickis Veröffentlichungen zur Literatur der zweiten Hälfte des 20. und der Anfänge des 21. Jahrhunderts um ein Vielfaches größer als die zur Literatur aller Jahrzehnte und Jahrhunderte davor. In seiner »Geschichte der deutschen Literatur« nahm sie immerhin bereits einen Umfang von 200 Seiten ein. Bis auf eine Ausnahme, die gleich noch zu begründen ist, übernimmt »Meine deutsche Literatur seit 1945« daraus keinen einzigen Beitrag. Beide Bände ergänzen sich, aber beim Lesen des einen Bandes ist man auf den anderen nicht angewiesen.
Außerdem folgen die beiden Bände wie schon frühere Aufsatzsammlungen Reich-Ranickis teilweise unterschiedlichen Konzepten in der Präsentation der gesammelten Beiträge. Seine »Geschichte der deutschen Literatur« greift zumeist auf letzte Fassungen seiner oft mehrfach veröffentlichten Essays zurück, die er für seine Bücher überarbeitet und oft mit anderen Titeln überschrieben hat. »Meine deutsche Literatur seit 1945« druckt hingegen in der Regel die ersten Fassungen ab, wie sie zumeist in Zeitungen erschienen sind. Und auch die Anordnung der Essays folgt anderen Gesichtspunkten. Die Reihenfolge ist im ersten der beiden Bände an den Geburtsdaten der Autoren und Autorinnen orientiert. Beiträgen über Goethe beispielsweise folgt ein Portrait Schillers, Artikeln über Günter Grass einer über Christa Wolf. Im neuen Band ist die Reihenfolge – mit Ausnahme der Artikel, die einleitenden Charakter haben oder sich auf ein Phänomen wie die Gruppe 47 beziehen – durch das Erscheinungsdatum bestimmt. »Meine deutsche Literatur seit 1945« wird damit zu einer chronologisch geordneten Dokumentation und Geschichte von Reich-Ranickis aktiver Teilnahme am literarischen Leben seiner Zeit. Die vier Artikel über Grass zum Beispiel stehen in verschiedenen Kapiteln. Und der erste über »Die Blechtrommel« unterscheidet sich von der Fassung, die schon in »Meine Geschichte der deutschen Literatur« und in etlichen anderen Büchern abgedruckt wurde, nicht nur im Titel.
Dass der Artikel auch in dem neuen Band erscheint, hat aber einen wichtigeren Grund. In Reich-Ranickis Kritikerkarriere ist diese Rezension eine markante Zäsur. Sie erschien am 1. Januar 1960 in der »Zeit« und ist seine erste in dieser Zeitung – ein mit deutlich erkennbarer Sympathie für den Autor geschriebener Verriss. Das Feuilleton der Wochenzeitung hatte Reich-Ranicki im Herbst 1959 eine regelmäßige Zusammenarbeit angeboten. Für die Literaturkritik der »Zeit« wurden Reich-Ranickis Beiträge rasch zu einem Markenzeichen. Anfang 1963 stellte ihn diese Zeitung fest an, ohne ihn an redaktionellen Aufgaben zu beteiligen, also nur für das Schreiben. Als Kritiker der »Zeit« wurde er denn auch zu einer einflussreichen Instanz des literarischen Lebens.
Die drei Phasen der deutschen Literaturgeschichte seit 1945, nach denen die Kapitel in diesem Buch angeordnet und überschrieben sind, decken sich weitgehend mit den Phasen seiner Kritikerlaufbahn. Die erste reicht bis in die Zeit der Studentenbewegung um 1968. Nach seiner Ankunft in der Bundesrepublik im Juli 1958 schrieb der Kritiker zunächst für die »Frankfurter Allgemeine«, das Hamburger »Sonntagsblatt« und am meisten für »Die Welt«.
Er profilierte sich hier zunächst vornehmlich als Fachmann für die Literatur Osteuropas und der DDR, die man damals in der Bundesrepublik nicht so nennen durfte. Am 7. März 1959 leitete er in der »Welt« eine ganze Serie von Artikeln unter dem Titel »Deutsche Schriftsteller, die jenseits der Elbe leben« mit den Sätzen ein: »Es gibt deutsche Schriftsteller unserer Zeit, die man an der Wolga und an der Weichsel besser kennt als am Rhein und Main. Es gibt deutsche Romane, die in chinesischer Übersetzung und in den Sprachen asiatischer Sowjetvölker vorliegen, aber in Hamburg oder Frankfurt in keiner Buchhandlung zu finden sind. Es gibt eine deutsche Literatur, die in der Bundesrepublik ignoriert wird – die Literatur der Sowjetzone.« Ein ausgewiesener Kenner und kritischer Begleiter der Autorinnen und Autoren aus der DDR, später vor allem auch jener, die das Land freiwillig oder zwangsweise verließen, ist Reich-Ranicki, wie auch dieser Band deutlich machen möchte, zeitlebens geblieben. 1963 erschien seine erste Sammlung von Aufsätzen in der Bundesrepublik unter dem bezeichnenden Titel »Deutsche Literatur in West und Ost« (zunächst mit dem Untertitel: »Prosa seit 1945«) und wurde später in erweiterten Fassungen mehrfach neu aufgelegt. 1974 veröffentlichte er die Aufsatzsammlung »Zur Literatur der DDR«, die er 1991 zu dem Buch »Ohne Rabatt. Über Literatur aus der DDR« vervollständigte.
Im Herbst 1958 wurde Reich-Ranicki von Hans Werner Richter zur Jahrestagung der Gruppe 47 in Großholzleute im Allgäu eingeladen. Am 15. November erschien in der Münchner Zeitschrift »Die Kultur« sein Bericht dazu – der erste einer kontinuierlichen Serie, die bis hin zur vorläufig letzten Tagung im Jahr 1967 und zu einem zehn Jahre später inszenierten »Abschiedstreffen« reichte. Die Zugehörigkeit zur Gruppe 47 wurde ein markanter Bestandteil seines Profils. Und die in der Gruppe kultivierte Form der mündlichen Diskussion über Literatur mit ihren Spielregeln prägte den Kritiker bei seinen frühen Auftritten im Rundfunk als Moderator der Sendung »Das literarische Kaffeehaus«, von 1977 bis 1986 noch deutlicher in seiner Rolle beim Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis und von 1988 bis 2001 seine Präsenz im Fernsehen als Protagonist im »Literarischen Quartett«.
Im ersten Jahrzehnt seiner literaturkritischen Tätigkeit in der Bundesrepublik bekannte Reich-Ranicki sich zu einer »engagierten Literatur«, wie sie damals von den linksliberalen und sozialistischen Intellektuellen unter den deutschsprachigen Schriftstellern, zum Teil in Anlehnung an Jean-Paul Sartres Begriff einer »Littérature engagée«, vielfach gefordert wurde: »Ich bin Anhänger einer engagierten Literatur«, erklärte er 1963. »Ich glaube, dass Schriftsteller sich nicht damit begnügen dürfen, das Leben mit reizvollen Arabesken zu schmücken und allerlei Ornamente beizusteuern« (»Meine Geschichte der deutschen Literatur«, S. 456).
Nach den Jahren um 1968, nach der zunehmenden Politisierung der Literatur und der Debatten über sie im Umfeld der Studentenbewegung, hätte er dies nicht mehr geschrieben. »Gegen die linken Eiferer« lautet der Titel eines Artikels von 1973 über Heinrich Bölls Nobelpreis-Rede. Ein »Klima militanter und düsterer Kunstfeindschaft« habe dazu geführt, »dass wir, die wir immer schon für das Engagement in der Dichtung waren und die wir die Gesellschaftskritik in der Literatur für etwas Selbstverständliches hielten, das Wort ›Gesellschaftskritik‹ nicht mehr verwenden können«. In späteren Rückblicken auf die Literatur der siebziger Jahre sympathisierte er, im Blick vor allem auf autobiographische Werke von Max Frisch, Wolfgang Koeppen und Thomas Bernhard, mit einer Literatur, die sich durch ihren »zeitkritischen Psychologismus« auszeichne.
Seit den achtziger Jahren findet sich das Wort »kritisch« als Kennzeichen literarischer Qualität in seinen Rezensionen kaum noch. Der Literatur weist Reich-Ranicki seither vor allem zwei Funktionen zu, die auch seine Autobiographie immer wieder hervorhebt. Im Werk Max Frischs finden wir, so erklärt er in »Mein Leben«, »was wir alle in der Literatur suchen: unsere Leiden. Oder auch: uns selber.« Eine andere Funktion der Kunst ist ihm jedoch noch wichtiger: uns Freude, Vergnügen und Glück zu verschaffen. Die Ambitionen »engagierter« Literatur und Kunst hält er für illusionär. In »Mein Leben« beruft er sich auf eine Antwort Thomas Manns auf die Frage nach dem eigentlichen Ziel seiner Arbeit: »Ich sage einfach: Freude.« Die Hoffnung, man könne durch Literatur die Menschen erziehen und die Welt verändern, habe die Geschichte der Literatur gründlich enttäuscht.
Man könnte vermuten, dass solche Veränderungen in Reich-Ranickis Einstellungen zur Literatur in den frühen siebziger Jahren im Zusammenhang stehen mit einem neuen gravierenden Einschnitt in seiner beruflichen Laufbahn. Denn 1973 beendete er seine Arbeit für die »Zeit« und wurde Leiter des Literaturteils der »Frankfurter Allgemeinen«. Dagegen spricht allerdings, dass der zitierte Artikel über Heinrich Böll und »gegen die linken Eiferer« noch in der »Zeit« erschien (am 7. Mai). Der Wechsel nach Frankfurt erfolgte erst im Dezember.
In der »Frankfurter Allgemeinen« tat Reich-Ranicki viel, um die politische Unabhängigkeit des Literaturteils hervorzuheben. Ein kleiner Skandal war es, als im Mai 1976 in der »Frankfurter Anthologie« ein Gedicht des zu fünfzehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilten Terroristen Peter Paul Zahl erschien. Die Interpretation dazu lieferte darüber hinaus der damals als radikaler Linker geltende Erich Fried. Gebilligt wurde das von den Herausgebern der Zeitung nicht zuletzt deshalb, weil Reich-Ranicki immer wieder deutlich machte, dass er jedem linken Dogmatismus und damit auch seiner eigenen Vergangenheit abgeschworen hatte. Deutlich sichtbar war auch sein Bemühen, die Arbeiten jener Schriftsteller und Intellektuellen zu honorieren, die sich ähnlich wie er selbst von ihrer kommunistischen oder sozialistischen Vergangenheit abgewendet hatten. Peter Rühmkorf notierte am 8. März 1989 in sein Tagebuch: »Er ist ein Renegatenmacher, der versucht, schwankend gewordene Sozialisten/Kommunisten im Sinne seiner Biographie zu knicken und sie über ›FAZ‹-Beiträgerschaft und Preiszuwendungen auf den rechtsliberalen Tugendpfad zu lenken. So früher bereits Erika Runge, Martin Walser, Erich Fried, Franz-Xaver Kroetz, Peter Maiwald, Ulla Hahn – und natürlich auch mich. Man darf sich nur nicht gerade als auf die Dauer unerziehbar erweisen.«
In der Zeitung selbst sah man das anders. Hier erlebten ihn die Kollegen als jemanden, der sich gegen die politische Restaurationsbewegung im Jahrzehnt nach der Studentenbewegung zur Wehr setzte. Während die politischen Leitartikel der Zeitung den Radikalenerlass begrüßten, der die Einstellung von Linksintellektuellen in den öffentlichen Dienst untersagte, erklärte Reich-Ranicki diesen für dumm und schädlich. Als während der Terroraktionen der »Roten Armee Fraktion« mancher deutsche Schriftsteller und Intellektuelle zum Sympathisanten des Terrorismus erklärt wurde, darunter auch Heinrich Böll, schrieb Reich-Ranicki einen Kommentar mit dem Titel »Böll wird diffamiert«.
Die nächste Zäsur in der Geschichte Deutschlands und der deutschsprachigen Literatur, der Zusammenbruch der staatssozialistischen Systeme in Mittel- und Osteuropa, der Fall der Mauer und das Ende der Teilung Deutschlands, liegt erneut in zeitlicher Nähe zu einem weiteren Einschnitt in Reich-Ranickis Lebensgeschichte. 1988 musste er, im Alter von 68 Jahren, die Redaktionsleitung des Literaturteils der »F.A.Z.« abgeben und amtierte lediglich als Redakteur der »Frankfurter Anthologie« weiter. Doch seinen Einfluss und seine Popularität als Literaturkritiker vermochte er noch einmal zu steigern – als Fernsehstar im »Literarischen Quartett«.
Nur noch selten veröffentlichte er in Zeitungen literaturkritische Essays alten Stils, zumal sich Reich-Ranicki in den neunziger Jahren bald einer anderen Schreibarbeit widmete: seiner Autobiographie, die nach ihrem Erscheinen im Sommer 1999 eine überwältigende Resonanz fand. Und in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts wendete er sich neuen Projekten zu: der Serie »Meine Bilder« mit kleineren Porträts von Schriftstellern, die ihm besonders wichtig waren, danach der Serie »Fragen Sie Reich-Ranicki«, in der er jede Woche knapp auf Leserbriefe zur Literatur und zu seiner Person antwortete, sowie der groß angelegten Zusammenstellung eines umfassenden Kanons der deutschen Literatur.
Dokumentieren lassen sich Reich-Ranickis Auseinandersetzungen mit der deutschen Gegenwartsliteratur im letzten Jahrzehnt des alten und in den Anfängen des neuen Jahrhunderts im Medium eines Buches zum großen Teil nur behelfsweise: mit verschriftlichten Auszügen aus seinen mündlichen Äußerungen in einigen Sendungen des »Literarischen Quartetts«. Gegenüber der Vitalität seiner Diskussionsbeiträge in dieser Sendung müssen diese Auszüge beim Lesen blass bleiben. Und verglichen mit der Qualität seiner Essays wirken sie zwangsläufig provisorisch. Aber einige exemplarische Eindrücke davon, was ihn an der jüngsten deutschen Literatur jener Jahre zu begeistern vermochte und was nicht, wie er unter ihr litt, sich über sie ärgerte und wie er sie liebte, vermitteln sie durchaus.
Bleibt am Ende noch zu danken, dass dieses Buch ein Jahr nach der »Geschichte der deutschen Literatur« und zwei Jahre nach dem Tod Marcel Reich-Ranickis erscheinen kann: seinem Sohn Andrew Ranicki für die immer raschen und hilfreichen Antworten auf Fragen, den Rezensenten, Leserinnen und Lesern des vorangehenden Bandes für die freundlichen und zur Fortsetzung motivierenden Reaktionen, Anne Anz, Kathrin Fehlberg und André Schwarz für die Unterstützung bei den Korrekturen, dem Archiv der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« für die Übersicht zu allen Artikeln, die in dieser Zeitung erschienen sind, und den Mitarbeiterinnen der Deutschen Verlags-Anstalt für die Meisterung mancher Geduldsproben.
Das Buch selbst versteht sich nicht zuletzt als Dank an Marcel Reich-Ranicki und tritt einer seiner Überlebensängste entgegen, denen er sich zeitlebens mit bewundernswerter Energie widersetzte. Über einen prominenten Schriftsteller und Journalisten des 19. Jahrhunderts, mit dem er sich in mehrfacher Hinsicht identifizierte, über Ludwig Börne, schrieb er: »Er war verliebt in Deutschland, in die deutsche Kultur. Aber diese Liebe hat Börne niemals gehindert, den Deutschen die bitterste Wahrheit zu sagen.« Am Ende seines Börne-Porträts stehen allerdings drei ernüchternde Sätze, die etwas von seinen eigenen Befürchtungen verraten: »Dass Börnes Schriften heute kaum gelesen werden, darf uns nicht wundern. So ergeht es den Publizisten und Journalisten beinahe immer: Der unmittelbaren Gegenwart verpflichtet, geraten sie in einer späteren Epoche in Vergessenheit.«
Gewidmet ist das Buch dem Urenkel Marcel Reich-Ranickis: Nico Marcel Vallauri, geboren am 4. März 2015 in London.
VON DER GRUPPE 47 BIS ZUR POLITISIERUNG UM 1968
Die deutschen Schriftsteller und die deutsche Wirklichkeit
Meine Damen und Herren,
nun sag, wie hast du’s mit der Wirklichkeit? Mit dieser Frage werden deutsche Schriftsteller seit Jahrhunderten bedrängt. Sie ist so alt wie die Literaturkritik, und sie muss stets wiederholt werden, denn sie zielt auf Fundamentales ab, auf die Substanz ebenso wie auf die Funktion der Literatur. Lessing vergisst diese Frage nie, und auch Herder kehrt zu ihr oft zurück, etwa wenn er klagt, dass die Deutschen »für Stubengelehrte und ekle Rezensenten« schrieben und dass die klassische Literatur »so bunt, so artig, ganz Flug, ganz Höhe und – ohne Fuß auf die deutsche Erde« sei. Goethe und Schiller stellen diese Fragen in ihren kritischen Schriften und natürlich auch und vor allem die großen Romantiker, so Friedrich Schlegel, der seine Vorlesungen über die »Geschichte der alten und neuen Literatur« mit Gedanken über das Verhältnis der Literatur zum Leben und über ihren Einfluss auf die Realität einleitet. Nun sag, wie hast du’s mit der Wirklichkeit? – fragen, bisweilen etwas aufdringlich und vordergründig, die Kritiker des Jungen Deutschland die Schriftsteller ihrer Zeit. Für Fontane ist diese Gretchenfrage der Kritik ebenso selbstverständlich wie für Kerr, wenn er sich, beispielsweise, mit dem Drama Hauptmanns oder Sudermanns befasst. Für die Kritik, die die gesellschaftskritischen Aspekte des literarischen Werks betont und auf soziologische Kategorien größten Wert legt – von Franz Mehring über Benjamin und Lukács bis zu Adorno und Hans Mayer –, muss dieses Problem oft im Mittelpunkt stehen. Wer immer heute über deutsche Literatur schreibt – von Robert Minder und Peter Demetz bis zu Werner Weber und Walter Jens –, behandelt die Frage, ob, in welchem Maße und auf welche Weise der Schriftsteller die ihn umgebende Wirklichkeit in den Griff bekommt.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass jedes literarische Werk, dem eine gewisse Qualität nachgesagt werden kann, von seiner Epoche zeugt und – ob der Autor es gewollt hat oder nicht – ihr Ausdruck ist, dann lässt es natürlich stets auch das Verhältnis dieses Autors zu seiner Umwelt erkennen. Mithin gibt es auf unsere Gretchenfrage so viele Antworten wie Schriftsteller, nein, noch mehr: so viele wie Werke. Damit freilich ist uns wenig gedient. Denn wir wollen wissen, ob sich das Verhältnis der Schriftsteller nach 1945 zur deutschen Wirklichkeit durch besondere Merkmale auszeichnet, die sie miteinander gemein hätten. Lässt sich die deutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg auf gewisse gemeinsame Nenner bringen? Dies wird uns, glaube ich, nur dann gelingen können, wenn wir uns zu Vereinfachungen, Vergröberungen und Überspitzungen entschließen. Aber machen wir uns nichts vor: Die Kritik kann fast nie auf Vereinfachungen verzichten. Novalis hat dies gewusst, als er forderte: »Formeln für Kunstindividuen finden, durch die sie im eigentlichsten Sinn erst verstanden werden, macht das Geschäft des artistischen Kritikers aus, dessen Arbeiten die Geschichte der Kunst vorbereiten.« Und eine Formel für ein Kunstindividuum lässt sich nur durch Reduktion und also auch durch Vereinfachung erlangen. Robert Musil verlangte von den Kritikern die »Übersetzung des teilweise Irrationalen ins Rationale« und fügte sofort hinzu, dass sie zwar nie völlig gelingen könne, »aber was Vereinfachung, Auszug, ja Auslaugung ist, hat zugleich mit den Nachteilen auch die allseitige Beweglichkeit und den großen Umfang der Verstandesbeziehungen«. Eine solche Übersetzung – meinte Musil – sei »ein Weniger und ein Mehr«; zwar bleibe sie dem Leben »viel einzelnes schuldig«, doch verleihe sie ihm dafür »etwas Allgemeines«. In diesem Sinne wollen wir jetzt vereinfachen und jenen, die hinterher sagen sollten, es sei ja alles viel komplizierter, von vornherein und gern recht geben.
Zunächst einmal brauchen wir eine einigermaßen übersichtliche Ordnung. Wie soll man die Fülle der literarischen Phänomene seit 1945 aufteilen? Strömungen, Schulen, Gruppen, Ideologien, Programme? Damit kommen wir nicht weiter, philosophische, ästhetische oder politische Kategorien scheinen zu versagen, und auch der Rückgriff auf die traditionellen Gattungen – Lyrik, Dramatik, Epik – würde uns wenig helfen, da die Grenzen zwischen diesen Gattungen immer mehr verschwimmen. Wie aber wäre es mit einer Aufteilung in Generationen? Nur sollten für unsere Zwecke nicht biologische Gegebenheiten den Begriff »Generation« determinieren, sondern Fakten des literarischen Lebens. Zu einer literarischen Generation würden also nicht jene Schriftsteller gehören, die gleichzeitig geboren wurden, sondern diejenigen, die etwa gleichzeitig zu publizieren begonnen haben. Früher konnte man eine solche Unterscheidung entbehren – die meisten Expressionisten oder die Autoren der Neuen Sachlichkeit waren Altersgenossen und haben auch ungefähr gleichzeitig debütiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hingegen beginnt der literarische Weg einer Anzahl deutscher Schriftsteller, die, obwohl nicht gleichaltrig, doch als Generationsgenossen betrachtet werden sollten. So Hans Erich Nossack, geboren 1901, und Ilse Aichinger, geboren 1921, so Alfred Andersch, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Paul Celan, Stephan Hermlin, Arno Schmidt, Wolfdietrich Schnurre. Sie alle veröffentlichten ihre ersten Arbeiten zwischen 1945 und 1948. Mehrere Autoren, die schon vorher einiges publiziert hatten, deren Hauptwerke jedoch unzweifelhaft nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, möchte ich nur zur selben Generation zählen: Marie Luise Kaschnitz, Günter Eich, Wolfgang Koeppen, Gerd Gaiser.
Welches Lebensgefühl ist für diese Schriftsteller der ersten deutschen Nachkriegsgeneration charakteristisch? Man kann es den Titeln ihrer Werke ablesen. Denn nach dem »Interview mit dem Tode« (Nossack) erzählen sie von der »Sterbenden Jagd« (Gaiser) und vom »Tod in Rom« (Koeppen), sie beschwören »Nekyia« (Nossack) und den »Totentanz« (Kaschnitz). Sie singen vom »Sand aus den Urnen« (Celan) und von den »Straßen der Furcht« (Hermlin). Ihr Gedicht ist eine »Todesfuge« (Celan). Diese Generation der »Geschlagenen« (Richter) und der »Umsiedler« (Schmidt) steht »Draußen vor der Tür« (Borchert). Sie stellt die Frage: »Wo warst du, Adam?« (Böll). Diese Schriftsteller versuchen, die vom »Leviathan« (Schmidt) bedrohte Welt zu zeigen, sie beklagen das »Haus ohne Hüter« (Böll), sie bemühen sich um eine »Inventur« (Eich). Wogegen sie sind, wissen sie genau: Sie sagen »Nein« (Jens) und »Man sollte dagegen sein« (Schnurre). Doch erschöpft sich ihr Verhältnis zur Umwelt nicht nur in Negation und Abwehr. Sie verbinden den heftigen zeitkritischen Protest mit der Sehnsucht nach den »Kirschen der Freiheit« (Andersch) und dem Glauben an die »Zeit der Gemeinsamkeit« (Hermlin). Es sind Dichter der »Größeren Hoffnung« (Aichinger).
Exemplarisch für das Verhältnis der Schriftsteller dieser ersten Nachkriegsgeneration zur bundesrepublikanischen Wirklichkeit, wie sie sich im Laufe der fünfziger Jahre kristallisiert, scheint mir die Haltung von drei Romanciers zu sein: Heinrich Böll, Alfred Andersch und Gerd Gaiser.
In seinen Büchern »Und sagte kein einziges Wort«, »Haus ohne Hüter«, »Billard um halb zehn« kritisiert Böll vor allem – ähnlich wie Koeppen oder Nossack – eine seiner Ansicht nach für die westdeutsche Gesellschaft besonders charakteristische Diskrepanz: zwischen äußerem Aufstieg und innerem Abstieg, zwischen hektischer Betriebsamkeit und der Hohlheit des Lebens. In Bölls Epik bewirkt der materielle Wohlstand nahezu automatisch die seelische Verkümmerung der Individuen. Doch ist sein Protest von einem etwas kleinbürgerlichen Beigeschmack nicht frei. Denn gegen den Stil der Neureichen, gegen die Moral großbürgerlicher Familien und gegen den Opportunismus und Zynismus der Intellektuellen spielt Böll die angeblich gesunde Welt der kleinen und armen Leute aus, der braven Handwerker und der einfachen Plebejer. In seinem Protest dominieren antibürgerliche und antiintellektuelle Elemente.
In Anderschs Roman »Die Rote« ist die Flucht einer erfolgreichen Dolmetscherin aus einer persönlichen Konstellation zugleich als radikale Abwendung von ihrem bisherigen Lebensbereich im bundesrepublikanischen Wohlstand zu verstehen. Anderschs Heldin verzichtet auf ihre gesellschaftliche Position und die damit verbundenen beträchtlichen Vorteile: Sie wird, nachdem sie in einer proletarischen Familie Unterkunft gefunden hat, als gewöhnliche Arbeiterin in einer Seifenfabrik tätig sein. Allerdings bemüht sich Andersch, die Not jener Familie durch den italienischen Hintergrund einigermaßen malerisch wirken zu lassen, ferner handelt es sich, wie ausdrücklich vermerkt, um wohlduftende Seife, die die deklassierte Dame produzieren wird, und schließlich muss sie zwar in einem engen Zimmer wohnen, doch kann sie aus ihrem Fenster den Blick auf die Lagune von Venedig genießen. Wie auch immer: Andersch spielt gegen die Schicht der Arrivierten und Besitzenden ein geradliniges, militantes und moralisch hochstehendes proletarisches Milieu aus. In seinem Protest dominieren antikapitalistische Tendenzen.
Auch die Protagonisten Gerd Gaisers lehnen die bundesrepublikanische Welt entschieden ab, freilich aus ganz anderen Gründen. Sie trauern ihrer heroischen Zeit nach, den Jahren des Krieges, der als romantisches Abenteuer und als die Zeit der Bewährung männlicher Tugenden besungen wird. Während die Helden Gaisers (meist ehemalige Offiziere) stolz auf das Provisorische ihres Daseins sind und ins Seelische, in die Innerlichkeit fliehen, erweisen sich als die Nutznießer des westdeutschen Wirtschaftswunders – etwa in dem Roman »Schlußball« – entweder Ausländer, fremdstämmige Menschen oder ehemalige Unteroffiziere, also plebejische Emporkömmlinge. In dieser Epik, in der die Zivilisation im Gegensatz zur Natur steht, werden gegen die bundesrepublikanische Wirklichkeit die Seele, die Stimme des Blutes und die Beständigkeit des Bodens ausgespielt. Gaisers Protest entspringt vornehmlich einem antizivilisatorischen Affekt.
Böll, Andersch, Gaiser – drei Prosaisten, die, so verschieden sie auch sind, doch viel miteinander gemeinsam haben: Alle drei verurteilen sie die westdeutsche Wohlstandsgesellschaft. Ob Bölls Fred Bogner und, später, sein Clown, ob Anderschs rothaarige Dolmetscherin oder Gaisers von der Natur schwärmender Lehrer Soldner – sie alle wenden sich von der neuen Wirklichkeit mit Abscheu ab, sie wollen nicht mitmachen, sie ziehen sich zurück. Und ob sie dabei in Deutschland bleiben oder sich nach Italien absetzen, ist ziemlich gleichgültig. Denn alle drei Schriftsteller halten der verurteilten bundesrepublikanischen Gesellschaft, wenn auch bisweilen nur am Rande ihrer Romane, Kontrastwelten entgegen, die trotz der unterschiedlichen Ausgangspositionen ein gemeinsames Fundament haben. Einst sang Brecht, frei nach Villon: »Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.« Böll, Andersch und Gaiser singen hingegen: Nur wer im Elend lebt, lebt angenehm. In der Epoche des Wirtschaftswunders wird in der deutschen Literatur, im Roman vor allem, die Armut zum moralischen Faktor und zum Wert an sich.
Da diese Schriftsteller an etwas glauben, worauf sie sich offenbar verlassen, können sie der von ihnen kritisierten Welt auch Rezepte, Vorschläge und Angebote unterbreiten. Böll, der Katholik, glaubt an die Einfalt, die Schlichtheit, die Naivität; Andersch, der Exkommunist, bleibt dem Klassenbewusstsein und der Solidarität des kämpfenden Proletariats treu; Gaiser lässt sich vom Mythos des Blutes und des Bodens faszinieren. Bezeichnend für die Kontrastwelten dieser Schriftsteller sind archetypische Figuren – bei Böll die Brot schneidende Mutter, bei Andersch der geigende Revolutionär, bei Gaiser der Lehrer mit der Sehnsucht nach dem Lagerfeuer im deutschen Wald. Für diese drei Schriftsteller gilt wie für ihre Helden: Enttäuschte sind es, und aus einer tiefen Enttäuschung resultiert ihr Verhältnis zur deutschen Wirklichkeit nach 1945.
Von einer derartigen Haltung kann bei den Vertretern der zweiten deutschen Nachkriegsgeneration keine Rede sein. Ihnen blieb in der Regel eine ideologische Enttäuschung erspart. Denn sie haben nie an eine Ideologie geglaubt. Zu dieser zweiten Generation zähle ich Schriftsteller, deren Weg Mitte oder Ende der fünfziger Jahre begann. Ich denke an Ingeborg Bachmann, Johannes Bobrowski, Heinz von Cramer, Herbert Eisenreich, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Uwe Johnson, Siegfried Lenz, Jens Rehn, Peter Rühmkorf, Martin Walser, Gabriele Wohmann.
Auch sie missbilligen offensichtlich die bestehende moralische Ordnung. Sie warten jedoch mit keinerlei Rezepten auf, sie hüten sich, ein moralisches System anzubieten. Gegenwelten wird man bei ihnen vergeblich suchen. Diese Autoren haben, versteht sich, Grundsätze, aber von einer Satzung wollen sie nichts wissen. Dogmen sind ihnen verhasst, Normen kommen ihnen verdächtig vor. Mit Begriffen wie »Christentum« und »Katholizismus«, »Marxismus« und »Kommunismus«, »Pazifismus« und »Antifaschismus« lassen sich die Schriftsteller dieser Generation nicht mehr charakterisieren. Sie können im Grunde mit keiner Weltanschauung oder Religion, mit keiner Kirche, Partei oder Organisation identifiziert werden. Wo sie es versucht haben – so Günter Grass mit der SPD, um nur dieses prominenteste Beispiel anzuführen –, mussten sie ihren Irrtum rasch einsehen. Es sind Moralisten ohne Kodex und Gläubige ohne Glaubensbekenntnis. Engagierte Schriftsteller? Ja, natürlich – aber engagiert ohne Programm.
Für das Lebensgefühl der Vertreter dieser zweiten Generation scheinen mir wiederum einige ihrer Buchtitel bezeichnend zu sein: In ihnen ist nicht mehr vom Tod, vom Sterben und vom Ausgestoßensein die Rede, vielmehr deuten sie häufig Gefühle der Unsicherheit und der Vorläufigkeit an. Nicht der »Sand aus den Urnen« wird jetzt besungen, sondern die »Gestundete Zeit« (Bachmann). Nicht das »Interview mit dem Tode« hören wir, vielmehr wird jetzt die »Halbzeit« (Walser) verkündet. Die Jahre, da es einfacher war, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden und zu protestieren, sind vorbei, jetzt sehen die Autoren deutlicher die Ambivalenz der Phänomene, jetzt heißt es: »Böse schöne Welt« (Eisenreich). Seltener werden Gewissheiten geboten, häufiger »Mutmaßungen« (Johnson). War das Gedicht der Generation einst die »Todesfuge«, so ist es jetzt »Zweifel« (Enzensberger) betitelt. Und die wichtigste Anthologie dieser Zeit nennt sich »Transit« (Höllerer).
Verändert haben sich auch die Zentralgestalt und ihre Funktion. Borchert, Böll und Schnurre, Koeppen und Arno Schmidt, Andersch und Gaiser zeigten vor allem das leidende Opfer der Geschichte. Fast immer endete es mit der Klage des Borchert’schen Beckmann: »Gibt denn keiner Antwort?« Die Schriftsteller der zweiten Generation hingegen zeigen im Mittelpunkt Menschen, die sich häufig als Medien erweisen und die vor allem Beobachter der Vorgänge sind und sein sollen. Das gilt, beispielsweise, für den Handelsvertreter in Walsers »Halbzeit«, für den Journalisten Karsch im »Dritten Buch über Achim« und auch für den Helden der Grass’schen »Blechtrommel«, für Oskar Matzerath, der überall Zugang hat und alles beobachten kann, weil er für ein kleines Kind gehalten wird.
Indes macht sich Anfang der sechziger Jahre bei vielen Zentralgestalten deutscher Romane und Erzählungen eine erstaunliche Labilität bemerkbar. Ihr Verhältnis zur Umwelt verdeutlichen zahlreiche Autoren am Beispiel von Individuen, die sich mit Ansprüchen des Lebens konfrontiert sehen, denen sie nicht gewachsen sind oder zumindest nicht gewachsen zu sein glauben. Meist zeichnen sich die Figuren durch übermäßige Affektbereitschaft aus, immer häufiger kommt es zu akuten Störungen ihres psychischen Gleichgewichts, ja sogar zu gänzlichen Zusammenbrüchen. Auf jeden Fall reagieren diese Menschen auf die bundesrepublikanische Wirklichkeit vornehmlich hysterisch, es sind Neurotiker und Neurastheniker, bisweilen leiden sie an schweren Psychosen.
Das gilt zunächst einmal für die Protagonisten jener Schriftsteller, die wir der ersten deutschen Nachkriegsgeneration zugerechnet haben. Schon in den fünfziger Jahren fielen bei den wichtigsten Figuren Bölls – etwa bei Fred Bogner aus »Und sagte kein einziges Wort« oder bei dem Architekten Robert Fähmel aus »Billard um halb zehn« – Zeichen von Gemütserkrankungen auf. Der Clown Hans Schnier, der schließlich weinend und bettelnd auf der Treppe des Bahnhofs von Bonn sitzt, scheint vollends ein pathologischer Fall zu sein – mit allen Symptomen einer regelrechten und akuten Hysterie. Der Ich-Erzähler in Bölls nächstem Buch, »Entfernung von der Truppe«, sagt selber, er sei ein Neurotiker. Ähnlich äußern sich Alfred Anderschs Gestalten in dem Erzählungsband »Der Liebhaber des Halbschattens«; die Titelgeschichte endet mit einem Nervenzusammenbruch ihres Helden. Auch in Schnurres Erzählungsband »Funke im Reisig« leiden die meisten Gestalten an psychischen Störungen, hier vor allem an zwangsneurotischer Angst. Von Nervenkranken erzählt nicht selten Marie Luise Kaschnitz in ihren Geschichten. Vermutlich ist auch Melitta, die Ich-Erzählerin des Buches »Das kennt man« von Nossack, psychisch krank, was sich allerdings nicht mit Sicherheit sagen lässt, weil wir einzig ihre Fieberphantasien hören.
Trifft das alles nur auf die Bücher der Autoren jener ersten Generation zu? Die psychische Struktur der Menschen, von denen Ingeborg Bachmann im »Dreißigsten Jahr« erzählt, gerät ebenfalls schnell ins Wanken: Einer erkennt selber, dass er nicht mehr zurechnungsfähig ist, eines anderen muss sich der Nervenarzt annehmen, ein dritter muss im Krankenhaus untergebracht werden. Der Journalist Karsch, der in Johnsons »Drittem Buch über Achim« ein offenbar gesunder Mann war, erweist sich in der Erzählung »Eine Reise wegwohin, 1960« als ein von Schlaflosigkeit geplagter Neurastheniker, der schließlich in einer Nervenklinik – übrigens in Italien – landet. Und dass Oskar Matzerath »Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt« ist, erfahren wir schon im ersten Satz der »Blechtrommel«.
Aber ist dies nur für die westdeutsche Literatur typisch? In dem Roman »Der geteilte Himmel« der 1929 geborenen Ostberlinerin Christa Wolf, einer Generationsgenossin also der Grass, Walser und Enzensberger, hören wir von einem jungen Paar, dessen Liebe an den politischen Verhältnissen scheitert: Er geht nach dem Westen, sie bleibt in der DDR. Die Geschichte ist aus der Perspektive des Mädchens erzählt. Wo? In einem Krankenhaus, in das dieses Mädchen nach einem Nervenzusammenbruch eingeliefert werden musste. Und an einer schweren psychischen Krankheit leidet die Landarbeiterin, die im Mittelpunkt der Erzählung »Böhmen am Meer« von Franz Fühmann steht.
Und gilt das alles etwa nur für die Epik? Nein, auch die Dramatiker sind in diesen Jahren an der Psychiatrie ganz besonders interessiert: In Irrenanstalten spielen Dürrenmatts »Physiker«, Peter Weiss’ »Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats«, Walsers »Schwarzer Schwan«.
Meine Damen und Herren: »Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren« – lässt Lessing seine Gräfin Orsina sagen, wobei er selber freilich nie in der Gefahr war, seinen Verstand zu verlieren. Wenn der deutsche Schriftsteller heutzutage zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater geht, trifft er im Warteraum seinen Kollegen. Und nicht nur die Schriftsteller sind immer häufiger auf die Hilfe von Psychoanalytikern und Psychiatern und auf allerlei Drogen angewiesen. Es gibt wahrlich mehr als genug Gründe für derartige Tendenzen in der neuen deutschen Literatur, wobei nur am Rande vermerkt werden soll, dass die Irrenanstalt oder das Nervensanatorium als Schauplatz literarischer Werke nicht immer die gleiche Funktion erfüllt – es ist eine andere in den »Physikern« von Dürrenmatt und eine andere im »Marat« von Weiss und wiederum eine andere in der »Blechtrommel«. Ferner handelt es sich hierbei mitnichten nur um ein deutsches Phänomen. Von den vielen möglichen Beispielen aus der Weltliteratur des letzten Jahrzehnts nur eins – Saul Bellows Roman »Herzog« beginnt mit den Worten: »Wenn ich den Verstand verloren habe, dann soll’s mir auch recht sein.« Das außergewöhnlich intensive Interesse deutscher Autoren Anfang der sechziger Jahre für psychiatrische Motive ist also vollauf begreiflich – und dennoch beunruhigend. Bisweilen will es nämlich scheinen, dass wir es hier mit zwar naheliegenden, aber auch allzu bequemen literarischen Lösungen zu tun haben. Anders ausgedrückt: Der Verdacht ist nicht immer von der Hand zu weisen, dass manche Schriftsteller mit der Unzurechnungsfähigkeit, die sie ihren Helden zuschreiben, eigene künstlerische Schwierigkeiten zu bemänteln versuchen.
Nicht weniger charakteristisch für das Verhältnis deutscher Schriftsteller zur deutschen Wirklichkeit in diesen Jahren ist wohl auch die große Anhäufung der Utopien. Nossacks »Nach dem letzten Aufstand«, Gaisers »Am Paß Nascondo«, Schmidts »Gelehrtenrepublik« und »Kaff, auch Mare Crisium«, Bölls »Schluck Erde«, Schnurres »Los unserer Stadt«, Cramers »Leben wie im Paradies« – immer wieder werden utopische Welten entworfen, deren Elemente, versteht sich, unserer Zeit entnommen sind oder aus ihr abgeleitet wurden. Kein Zweifel, in diesen Büchern dominiert die Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Aber sind es nicht mitunter auch unbewusste oder bewusste Ausweichmanöver der Autoren? Wie also? Rückzug in die Irrenanstalt oder Flucht in die Utopie? Der wahnsinnige oder nervenkranke oder jedenfalls nicht ganz zurechnungsfähige Protagonist und andererseits der reduzierte Held wie etwa Oskar Matzerath, der es ablehnt, in einer solchen Welt ein Erwachsener zu sein? Gibt es nur diese Alternativen? Oder können wir vielleicht von einer dritten Phase der deutschen Nachkriegsliteratur sprechen?
Schon 1962 wurden die ersten Zeichen einer Gegenbewegung bemerkbar, die man mit der »Neuen Sachlichkeit« vergleichen könnte und die ein verändertes Verhältnis zur Wirklichkeit und zur Gegenwart erkennen ließ. Man war allmählich des Abstrakten, des Esoterischen und des Artifiziellen überdrüssig geworden. Dieser Abkehr entsprach wiederum die Hinwendung zum Stoff und zum Konkreten, zu unserer tatsächlichen Umwelt und zum greifbaren Gedanken. Den Platz von Chiffren und Symbolen nahmen wieder Fakten und Details ein.
Besonders deutlich ist diese Veränderung und Gegenströmung im Drama, wo sie sich als Reaktion auf das absurde Theater erweist. Wieder stehen zeitgeschichtliche und oft auch politische Themen im Vordergrund, Dokument, Chronik und Protokoll gewinnen erneut Bedeutung. So begann der Weg des Bühnenautors Peter Weiss mit dem absurden Einakter »Nacht mit Gästen« und führte über das »Marat«-Drama zum Dokumentarstück »Die Ermittlung«. Ähnlich verlief die Entwicklung des Stückeschreibers Walser vom »Abstecher« über »Eiche und Angora« bis zum »Schwarzen Schwan«. Grass debütierte als Dramatiker mit dem Stück »Hochwasser« und ist mittlerweile bei dem deutschen Trauerspiel »Die Plebejer proben den Aufstand« angelangt: statt der abstrakten Parabel, in der eine Naturkatastrophe die Menschheitskatastrophe symbolisieren sollte, nun das Drama von der konkreten politischen und moralischen Katastrophe; und es spielt mitnichten immer und überall, sondern am 17. Juni 1953 im Theater am Schiffbauerdamm in Ost-Berlin. Hochhuths »Stellvertreter«, Kipphardts »In der Sache J. Robert Oppenheimer« und »Joel Brand«, Siegfried Lenz’ »Zeit der Schuldlosen«, Michelsens »Helm«, Tankred Dorsts Stück »Ernst Toller« – alle diese Werke beweisen, dass die deutsche Schaubühne wieder als moralpolitische Anstalt betrachtet wird.
Mit diesem Wandel hängt auch die auffallende Veränderung der Zentralgestalt im zeitgenössischen deutschen Drama zusammen. In den fünfziger Jahren hatten wir eher anonyme Helden – auch und vor allem in den bedeutendsten Stücken. Herr Biedermann und der Güllener III sind wenig bemerkenswerte, ja fast schon gleichgültige Figuren. Wichtig ist lediglich die Situation, in die sie geraten: durch das Eindringen der Brandstifter oder durch den Besuch der alten Dame. Jetzt hingegen scheinen die Bühnenautoren nicht mehr von den Situationen und Konstellationen auszugehen, sondern primär von den Hauptgestalten – und das sind nicht mehr durchschnittliche Menschen, sondern ausgeprägte Persönlichkeiten, meist übrigens Politiker oder Schriftsteller und Wissenschaftler, die sich mit politischen Fragen befassen: Marat, Marquis de Sade, Toller, Pius XII., Brecht, Robert Oppenheimer.
Während die Dramatiker die Konflikte des Individuums auf dem Hintergrund der Weltgeschichte zeigen, während in der Lyrik politische Motive eine wachsende Rolle spielen und auch hier die größere Gegenständlichkeit und Lesbarkeit auffällt – etwa in den Versen von Günter Grass, von Peter Rühmkorf, Horst Bienek und Erich Fried und, jenseits der Elbe, von Wolf Biermann und Günter Kunert –, zeichnet sich die neue Phase in der erzählenden Prosa zunächst einmal durch erfreuliche und konsequente Selbstbeschränkung der Autoren aus. Mehr als vorher begnügen sie sich mit bescheidenen Ausschnitten, und mehr als vorher gilt ihre Aufmerksamkeit den Details. Ein Vergleich des großzügig konzipierten Romans »Billard um halb zehn« von Böll mit seinem späteren Buch »Ende einer Dienstfahrt« scheint mir in dieser Hinsicht besonders aufschlussreich. Auch die vier Prosabücher Johnsons zeugen in zunehmendem Maße von seinen Bemühungen um Reduktion und Konzentration.
Dies gilt aber vor allem für mehrere jüngere Prosaisten, die in den sechziger Jahren debütierten, unter anderem für Thomas Bernhard, Peter Bichsel, Rolf Dieter Brinkmann, Hubert Fichte, Günter Herburger, Alexander Kluge, Reinhard Lettau, Hugo Loetscher, Rolf Schneider, Günter Seuren.
Nichts liegt mir ferner, als diese sehr verschiedenen Schriftsteller gewaltsam unter einen Hut zu bringen. Indes ist unverkennbar, dass sie sich alle auf wenige Motive und Figuren und auf eng umgrenzte Schauplätze beschränken. Die Erzählung wird bevorzugt, die Form der Geschichte und auch die Prosaminiatur. Und wenn diese Autoren Romane schreiben, dann sind sie fast immer auffallend kurz. Neben dem Hang zum Sachlichen und zum Nüchternen kann man den Debütanten der sechziger Jahre auch einen sicheren Blick für reale Gegebenheiten und für konkrete gesellschaftliche Milieus nachsagen. Bisweilen wird auch die Arbeitswelt berücksichtigt, immer bemüht man sich um die Gegenwart. Wenn die Schreibweise realistisch ist oder doch zu sein scheint, dann handelt es sich jedenfalls um einen offenen und aufgeklärten, einen undogmatischen Realismus, der sich glücklicherweise jeder programmatischen Festlegung entzieht. Illusionen machen sich diese Erzähler offenbar nicht: Häufiger als um die großen Probleme, vor denen sie eher zurückschrecken – und das ist verständlich –, geht es ihnen um die Darstellung des Nächstliegenden, etwa des Alltags des kleinen Mannes. Das Exemplarische wird meist im Gewöhnlichen und Mittelmäßigen, ja im Banalen gesucht.
Auch die dritte Phase der deutschen Nachkriegsliteratur gibt sich, glaube ich, in manchen Buchtiteln dieser Jahre deutlich zu erkennen. Man könnte etwa sagen: Die Schriftsteller wollen vor allem die »Einzelheiten« (Enzensberger) bewusst machen, an die »Lebensläufe« (Kluge) der Zeitgenossen erinnern und die »Gleichmäßige Landschaft« (Herburger) unseres Alltags zeigen. Hieß es einst »Mutmaßungen über Jakob«, so heißt es jetzt »Zwei Ansichten« (Johnson). Die Titel werden sachlicher und rationaler. Und symptomatisch scheint auch der Titel einer neuen Zeitschrift jener Jahre zu sein: »Kursbuch«. Man hat sich übrigens schon Gedanken gemacht, wie man diese Phase der deutschen Literatur eigentlich nennen soll. Walter Höllerer schlug den Begriff »Neuer Realismus« vor, Martin Walser sprach von einem »Realismus X«. Beide Bezeichnungen überzeugen mich nicht ganz: Ich befürchte, dass sie entweder die Vielfalt der jetzigen Gegenströmung ungebührlich einschränken oder aber den Begriff »Realismus« so sehr erweitern, dass vor seiner Anwendung dringend gewarnt werden müsste. Vielleicht sollte man die Bezeichnung »Literatur der kleinen Schritte« erwägen? Das ist allerdings eine nicht gerade exakte und auch eine sehr allgemeine Formel, was aber ein Nachteil und ein Vorteil zugleich sein kann.
So präsentiert sich also die deutsche Literatur seit 1945 in drei Phasen. Nach dem Interview mit dem Tode wurde gefragt: Wo warst du, Adam? Dann kam die Zeit des Zweifels und der Mutmaßungen – und dann die der Einzelheiten und der Lebensläufe. Die Phasen folgen aufeinander wie These, Antithese und Synthese. Eine übersichtliche und handliche Aufteilung, doch eben das sollte uns misstrauisch machen. In Wirklichkeit ist die Literaturgeschichte vielschichtiger und verworrener. Die Wege der Schriftsteller kreuzen und überschneiden sich immer wieder, die Schattierungen und Möglichkeiten kennen glücklicherweise keine Grenzen, alle Versuche, eine literarische Landkarte zu entwerfen, müssen die Phänomene schematisieren und simplifizieren. So provoziert fast jede Behauptung eine Frage, und auf fast jede Frage gibt es mehr als eine Antwort. Auch aus unserem Spiel mit den Titeln – denn ein Spiel ist es natürlich, wenn auch, wie ich hoffe, ein nützliches – ergeben sich viele Fragen, aber vielleicht auch einige jener Formeln, auf deren Notwendigkeit einst Novalis hinwies.
Und schließlich und endlich, meine Damen und Herren: Was immer der zeitgenössischen deutschen Literatur vorgeworfen werden muss, ihren Vertretern kann man, glaube ich, bestätigen, was Nietzsche für ein Merkmal der guten Schriftsteller gehalten hat – dass sie es vorziehen, verstanden statt angestaunt zu werden. Auch das weist darauf hin, dass sie die uralte Frage nicht zu fürchten brauchen – die Frage: Nun sag, wie hast du’s mit der Wirklichkeit?
(1967)
Kritik auf den Tagungen der Gruppe 47
Am 28. Oktober 1961, kurz nach zwei Uhr morgens – es war auf einer Tagung der Gruppe 47 – richtete der deutsche Schriftsteller Martin Walser an den Schreiber dieser Zeilen in Gegenwart mehrerer prominenter Zeugen eine kraftvoll-männliche, militärisch-knappe Ansprache, in der er die Literaturkritiker aller Länder und Zeiten mehrfach und nachdrücklich als »Lumpenhunde« bezeichnete.
Als der Autor der »Halbzeit« diese ebenso aufrichtigen wie kernigen Worte sprach, konnte er auf eine stolze Ahnenreihe zurückblicken. Bereits Goethe hielt die Rezensenten für Hunde, die man schleunigst totschlagen sollte. Zu zoologischen, freilich etwas komplizierten Vergleichen fühlte sich auch Dickens angeregt: Er meinte, der Kritiker sei eine mit Pygmäenpfeilen bewaffnete Laus, welche die Gestalt eines Menschen und das Herz eines Teufels hätte. Leo Tolstoi wiederum, der ja schließlich auch kein ganz schlechter Schriftsteller war, erklärte in seinem Buch »Was ist Kunst?« klipp und klar, dass jemand, der sich damit befasse, Kritiken zu schreiben, nicht ganz normal sein könne.
Nun muss man aber – denn fair wollen wir sein! – zugeben, dass Martin Walser etwas mehr Grund hat als seine Kollegen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die Kritiker mit wuchtig-harten Worten zu bedenken. Die genannten Romanciers und Dramatiker meinten nämlich, als sie so wohlwollend und menschenfreundlich der Rezensenten gedachten, lediglich die gedruckte Kritik. Goethe, Dickens und Tolstoi war es nicht gegeben, an einer Tagung der Gruppe 47 teilzunehmen. Die mündliche, improvisierte und dennoch öffentliche Kritik war ihnen unbekannt. Die Autoren der »Gruppe« dagegen werden das ganze Jahr hindurch von den schreibenden und auf den Tagungen überdies noch von den redenden Kritikern bedrängt. Aber Martin Walser hätte, als er damals, nach dem Genuss einiger Flaschen vortrefflichen Alkohols, jenes denkwürdige Wort von den »Lumpenhunden« prägte, sich auch auf die Kritiker aus Vergangenheit und Gegenwart berufen können. Denn es gehört zu den nicht unsympathischen Gepflogenheiten zumal der deutschen Literaturkritik, recht häufig an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzt. Das soll heißen: Solange es eine deutsche Literaturkritik gibt, solange zweifelt sie an sich selber. Und stellt immer wieder sich selbst in Frage. Und das gilt, offen gesagt, auch für die Kritiker der Gruppe 47.
Wollen wir jetzt also ein bisschen an unserem Ast sägen? Wir wollen es.
Wer an einer der Tagungen der Gruppe 47 in den letzten Jahren – sei es als Autor oder als Diskutant, sei es als schweigender Beobachter – teilgenommen hat, kann sich der Befürchtung nicht erwehren, dass auf diesen Schriftstellertreffen literarische Versuche leichtfertig beurteilt und oft genug auch verurteilt werden. Muss nicht schon die Prozedur, die auf den Tagungen üblich ist, eine unseriöse und verantwortungslose Kritik zur Folge haben? Zunächst einmal: Ist es möglich, ist es sinnvoll, Gedichte, Erzählungen oder Romanfragmente zu bewerten, die man nicht gelesen, sondern nur gehört hat?
Bei der lediglich akustischen Darbietung literarischer Texte werden die Gegenstände der Betrachtung nicht in ihrer ursprünglichen, in ihrer natürlichen Gestalt präsentiert, sondern zugleich mit einer Interpretation des Autors versehen. Indem er seine Prosa oder seine Verse laut vorliest, empfiehlt er den Zuhörern allein durch die Art des Vortrags, seine Arbeit auf die von ihm erwünschte Weise zu verstehen. Er stützt seinen Text mit außerliterarischen Mitteln. Die Betonung einzelner Worte und Sätze lenkt die Aufmerksamkeit auf gewisse inhaltliche Elemente. Die Pointen werden mehr oder weniger hervorgehoben. Stimme und Tonfall erzeugen eine Atmosphäre, die vielleicht, hätte man nur das Manuskript in der Hand, unbemerkt geblieben wäre. In diesem Zusammenhang ist es im Grunde belanglos, ob der Verfasser eine Deutung mit außerliterarischen Mitteln anstrebt oder vermeiden möchte, ob sie bewusst oder unbewusst erfolgt: Mag er sich um einen konsequent-sachlichen, vollkommen gleichgültigen, monotonen oder unterkühlten Vortrag bemühen – eine von jeglicher Auslegung freie, also gewissermaßen klinisch reine akustische Darbietung literarischer Texte kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ferner muss berücksichtigt werden, dass es neben Autoren mit rezitatorischer Begabung auch solche gibt, deren Unfähigkeit auf diesem Gebiet erstaunlich groß ist. Während also die einen die Wirkung ihrer Arbeit steigern, verderben andere den Eindruck, den sie bei gewöhnlicher Lektüre erwecken könnte. Nicht selten geschieht es sogar, dass der lesende Autor seinen Text verstümmelt, indem er undeutlich liest und einzelne Silben, ja ganze Worte verschluckt. Überdies eignen sich manche Arbeiten vortrefflich zur akustischen Darbietung, andere hingegen können eigentlich nur mit dem Auge wahrgenommen werden. In einer Geschichte, beispielsweise, in der die Darstellung des Erzählers mit Dialogen und inneren Monologen der auftretenden Gestalten kombiniert ist und in der sich der Autor womöglich noch einige Rückblenden leistet, kann selbst dem aufmerksamen und geübten Zuhörer mit Leichtigkeit ein Zeitsprung oder ein Wechsel der Bewusstseinsebene entgehen, wodurch das Ganze in der Regel nahezu unbegreiflich wird. Der Verfasser eines eingleisigen oder jedenfalls einfacher komponierten Prosastücks hat von vornherein geringere Widerstände zu überwinden.
Die Kritiker sollen jedoch weder über die Möglichkeiten des Autors als Vortragskünstler befinden noch darüber, ob sich sein Produkt zur Rezitation eignet. Sie haben einen literarischen Text sachgemäß und möglichst gerecht zu beurteilen, müssen also alle Faktoren, die sich aus der akustischen Darbietung zum Vorteil oder zum Nachteil des Verfassers ergeben, rücksichtslos eliminieren. Mithin entstehen für den Kritiker zusätzliche Schwierigkeiten. Übertreibe ich? Man könnte diese Schwierigkeiten getrost bagatellisieren, wenn ansonsten auf den Tagungen die Voraussetzungen für eine einigermaßen normale Arbeit der Kritik gegeben wären. Dies ist aber keineswegs der Fall. Der Kritiker hat nicht die Möglichkeit, den gebotenen Text oder auch nur einzelne Passagen, die ihm besonders wichtig oder symptomatisch zu sein scheinen, zu überprüfen. Er muss sich ganz und gar auf den ersten Eindruck verlassen. Wenn er etwa meint, die Arbeit zeuge von einem bemerkenswerten Fortschritt oder Rückschritt im Vergleich zu früheren Büchern desselben Verfassers, so muss er seinem Gedächtnis vertrauen.
Sogar das Zitieren aus dem zur Debatte stehenden Stück ist sehr schwierig. Natürlich kann sich der Kritiker während der Lesung Notizen machen. Aber welcher Kritiker kann stenographieren? Wenn er sich einen Satz notiert, riskiert er, dass ihm der nächste entgeht – und wer kann wissen, ob dieser nächste nicht just der Schlüsselsatz des ganzen Prosastücks ist? Vor allem wird der Kritik nicht die geringste Bedenkzeit zugestanden. Wenn sich auf den Tagungen zwanzig Sekunden nach dem letzten Wort eines vorgelesenen Stücks niemand zur kritischen Äußerung meldet, wird Hans Werner Richter in der Regel bereits unwillig. Beim Eiskunstlauf oder beim Kunstspringen der Wassersportler wird blitzschnell entschieden – noch ist der Körper des Springers nicht ganz im Wasser verschwunden, und schon heben die Schiedsrichter die Tafeln mit der Punktbewertung des Sprunges. Das wäre wohl das Ideal auch für die Tagungen der »Gruppe«, auf denen tatsächlich mit ähnlicher Geschwindigkeit geurteilt wird, nur dass die Schiedsrichter glücklicherweise nicht gleichzeitig, sondern nacheinander ihre Sprüche vorbringen. Beim besten Willen kann man also dieser Kritik weder Sorgfalt noch Gründlichkeit nachsagen.
Der Beurteilung von literarischen Kunstwerken haftet fast immer etwas Fragwürdiges an. Auf den Tagungen der »Gruppe« wird diese Fragwürdigkeit der Kritik noch außerordentlich gesteigert. Kurzum: Wir haben es mit einem ziemlich unseriösen Phänomen zu tun, das sich der intellektuellen Hochstapelei bedenklich nähert.
Nachdem wir also den Ast, auf dem die Kritik der Gruppe 47 sitzt, zu Walsers maßloser Freude fast ganz abgesägt haben, wollen wir versuchen, ihn wieder anzukleben. Zwei Fragen drängen sich vor allem auf. Die Autoren, die auf den Tagungen ihre Arbeit lesen, wissen, dass sie nur improvisierte Soforturteile hören werden, die oft schonungslos und unbarmherzig sind. Sie wissen, dass sie, nach den schon traditionellen Spielregeln der Tagungen, nichts erwidern dürfen, sondern alles stumm über sich ergehen lassen müssen. Warum kommen sie trotzdem? Warum setzen sich angesehene und preisgekrönte Schriftsteller, deren Bücher hohe Auflagen erzielen und in viele Sprachen übersetzt werden, einer scheinbar so unernsten Kritik aus? Sind sie etwa Masochisten?
Und jetzt zur zweiten Frage. Jeder Literaturkritiker weiß, wie problematisch das Gewerbe ist, dem er nachgeht. Es gibt wohl kaum einen Kritiker, den nicht immer wieder bei seiner Arbeit die Erinnerung an die Fehlurteile und Sünden aufschreckt, von denen die Geschichte der Literaturkritik strotzt. Wie ist es nun zu verstehen, dass Menschen, die sich also der Fragwürdigkeit ihres Berufes bewusst sind, ihn einige Tage lang unter Umständen ausüben, die diese Fragwürdigkeit allem Anschein nach noch vergrößern? Warum sind hierzu Kritiker bereit, die schließlich einen Ruf zu verlieren haben? Sind etwa aus denselben Kritikern, die in ihren Aufsätzen jedes Wort abwägen, plötzlich für die Dauer der Tagung leichtfertige Burschen geworden, die flott und unbekümmert über literarische Arbeiten reden?
Die Kritik, wie sie auf den Tagungen geübt wird, hat sich aus der Praxis ergeben. Die Autoren kommen, weil sie Urteile über ihre Arbeit hören wollen – meist suchen sie eine Bestätigung des Weges, den sie eingeschlagen haben. Die Kritiker kommen, weil sie wissen wollen, was die Autoren schreiben. Sie alle sitzen im selben Boot, sie haben das Gleiche im Auge: die Literatur. Um derartige Tagungen, die ohne mündliche Sofortkritik kaum vorstellbar sind, überhaupt durchführen zu können, haben sich beide Seiten stillschweigend auf einen Kompromiss geeinigt: Die Kritisierten und die Kritisierenden nehmen das Risiko und die Makel in Kauf, die improvisierten Kunsturteilen anhaften und anhaften müssen. Dieser Kompromiss hat sich, wie bisher, durchaus bewährt. Aus der Perspektive der Zeit kann wohl ohne Übertreibung gesagt werden, dass die meisten von der Kritik der »Gruppe« gefällten Urteile sich nicht als falsch erwiesen haben. Dies bezieht sich nicht auf Äußerungen einzelner mehr oder weniger prominenter Diskussionsteilnehmer, sondern lediglich auf das Gesamturteil, das nach einer Lesung gefällt wird und das immer aus der Summe mehrerer Ansichten besteht. So misstrauisch uns auch das Wort »Kollektiv« stimmen mag, so muss doch gesagt werden: Die Kritik der Gruppe 47 ist eine Kollektivkritik. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Umstand viele Schwächen, die durch die Improvisation und das Tempo bedingt werden, auszugleichen vermag. Diejenigen, die sich zu einem soeben gebotenen Text äußern, tun es in dem Bewusstsein, dass sie nicht so sehr ein Urteil fällen als zu einem Urteil beitragen. Dies gilt für die Erzähler und Lyriker, die über die Arbeiten ihrer Kollegen sprechen, nicht weniger als für die Berufskritiker, auf deren Schultern die Last der Kritik vor allem ruht.
Wie alles andere, das die Gruppe 47 und die Prozedur ihrer Tagungen betrifft, hat sich auch die dominierende Rolle der professionellen Kritiker bei der Bewertung der Arbeiten aus der Praxis ergeben. Niemals wurde beschlossen, dass sie vor allem urteilen sollen. Es hat sich jedoch erwiesen, dass sie am ehesten dazu fähig sind, die Eigenarten eines nur gehörten Textes zu erkennen, ihn sofort zu bewerten und zugleich die Bewertung zu begründen. Dass eine improvisierte Äußerung mitunter einem druckreifen Gutachten ähneln kann, hat Walter Jens, der Konzertmeister unserer Kritik, also sozusagen der »Ober-Lumpenhund«, oft genug bewiesen. Die Mannigfaltigkeit der literaturkritischen Konzeptionen und Methoden wirkt sich fast immer günstig aus. Denn derselbe Gegenstand wird von verschiedenen Seiten beleuchtet, die Ansichten ergänzen sich, die Diskussionsteilnehmer korrigieren sich gegenseitig. Walter Höllerer plus Joachim Kaiser ist in der Regel ergiebiger als Höllerer allein oder Kaiser allein. Und wenn der Kaiser in seiner Qual verstummt, ist es dem Jens gegeben, zu sagen, wie er leidet.