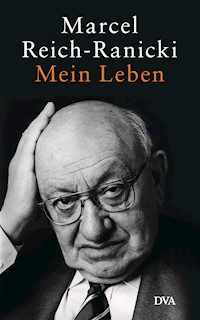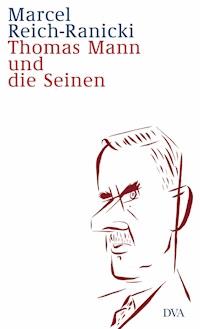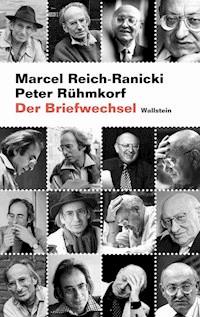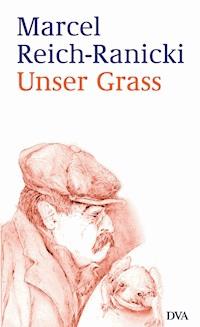14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Marcel Reich-Ranicki über die ihm wichtigsten Werke der deutschen Literatur
Zeit seines Lebens trat Marcel Reich-Ranicki unermüdlich für die Literatur ein und scheute sich dabei nie, eine ganz eigenwillige Auswahl der bedeutendsten Autoren und ihrer Werke zu treffen. Denn »der Verzicht auf einen Kanon«, so seine Überzeugung, »würde den Rückfall in die Barbarei bedeuten«. Hier erscheint nun eine umfassende Sammlung der wichtigsten und besten Essays dieses leidenschaftlichen Kritikers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Marcel Reich-Ranicki
Meine Geschichte
der deutschen Literatur
Vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Herausgegeben von Thomas Anz
Deutsche Verlags-Anstalt
Inhalt
Einleitung Der Kritiker Marcel Reich-Ranicki und seine Literaturgeschichte
ZUR EINFÜHRUNG
Das Herz – der Joker der deutschen Dichtung
Die verkehrte Krone oder Juden in der deutschen Literatur
Frauen dichten anders
VOM MITTELALTER BIS ZUR ROMANTIK
Walther von der Vogelweide Das Glück der Liebe
Paul Fleming Ohne sie, also ohne mich
Gotthold Ephraim Lessing Der Vater der deutschen Kritik
Moses Mendelssohn Ein Porträt
Johann Wolfgang von Goethe Die Literatur ist ein Spiel – wie die Liebe
Friedrich Schiller Ein Porträt
Friedrich Hölderlin Wie von Furien gejagt
Friedrich Schlegel Ein Porträt
E. T. A. Hoffmann Ein Porträt
Heinrich von Kleist Das preußische Genie
VORMÄRZ UND REALISMUS
Ludwig Börne Ein Porträt
Georg Büchner Dichter meiner Jugend
Heinrich Heine Eine Provokation und eine Zumutung
Friedrich Hebbel Die Kammern der Mädchen werden nicht verschlossen
Theodor Storm Spiegel unserer Seele
Richard Wagner Die Meistersinger von Nürnberg
Theodor Fontane Bruchstücke einer großen Konversation
LITERARISCHE MODERNE BIS 1945
Arthur Schnitzler Auch das Grausame kann diskret sein
Ricarda Huch Ein Porträt
Alfred Kerr Ein Porträt
Alfred Polgar Ein Porträt
Karl Kraus Seine Liebe war wie sein Hass
Thomas Mann Deutschlands Glück in Deutschlands Unglück
Hermann Hesse Ein Beitrag zur deutschen Sentimentalität
Alfred Döblin Unser Biberkopf und seine Mieze
Franz Kafka Ich könnte leben und lebe nicht
Arnold Zweig Deutscher Idealist, jüdischer Traditionalist
Kurt Tucholsky Sein Ruhm und Nachruhm
Bertolt Brecht Ungeheuer oben
Erich Kästner Der Dichter der kleinen Freiheit
Anna Seghers Nicht gedacht soll ihrer werden?
Klaus Mann »Mephisto«, der Roman einer Karriere
Mascha Kaléko Kleine Liebe in der großen Stadt
VON DER NACHKRIEGSLITERATUR BIS ZUR GEGENWART
Ein deutscher Schriftsteller-Atlas
Anmerkungen zur deutschen Literatur der siebziger Jahre
Marie Luise Kaschnitz Die sprachgewaltige Lektion der Stille
Elias Canetti Der Triumph des Elias Canetti
Wolfgang Koeppen Der Dichter unserer Niederlagen
Max Frisch Mein Name sei Frisch
Alfred Andersch Der enttäuschte Revolutionär
Peter Weiss Poet und Ermittler
Heinrich Böll Dichter, Narr, Prediger
Friedrich Dürrenmatt Leider ein Mythos
Erich Fried Ein deutscher Dichter
Ernst Jandl Er war ein Avantgardist, er wurde ein Klassiker
Siegfried Lenz Deutschstunden
Ingeborg Bachmann Die Kehrseite des Schreckens
Martin Walser Martin Walsers Rückkehr zu sich selbst
Günter Grass Auf gut Glück getrommelt
Christa Wolf Christa Wolfs unruhige Elegie
Peter Rühmkorf Der Prediger mit der Schiebermütze
Thomas Bernhard Konfessionen eines Besessenen
Uwe Johnson Der trotzige Einzelgänger
Sarah Kirsch Liebe und Rebellion
Wolf Biermann Der leidende Liedermacher
Jurek Becker Das Prinzip Radio
Hermann Burger Artist am Abgrund
Peter Handke Peter Handke und der liebe Gott
Eva Demski Liebevolle Rebellin
Botho Strauß Gleicht die Liebe einem Monolog?
Ulla Hahn Über die Lyrik der Ulla Hahn
Elfriede Jelinek Die missbrauchte Frau
Patrick Süskind Des Mörders betörender Duft
ANHANG
Literaturhinweise
Editorische Notiz
Nachweise
Personenregister
Einleitung Der Kritiker Marcel Reich-Ranicki und seine Literaturgeschichte
Von Thomas Anz
Das erste größere Buch, das Marcel Reich-Ranicki veröffentlicht hat, erschien 1955 unter dem Namen Marceli Ranicki in Warschau. Es blieb außerhalb Polens unbekannt, hat einen Umfang von 370 Seiten und ist eine Geschichte der deutschen Literatur. Genauer: ihre Geschichte ab der Reichsgründung im Jahre 1871 bis zur damaligen Gegenwart. Der Titel: »Z dziejów literatury niemieckiej 1871–1954«, zu Deutsch: »Aus der Geschichte der deutschen Literatur 1871–1954«. Es beginnt mit Theodor Fontane und Gerhart Hauptmann, geht ausführlich auf Thomas und Heinrich Mann ein, auf Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig und vor allem auf Anna Seghers, über die er 1957 sein zweites Buch veröffentlichte. In der Vorbemerkung erklärt der Verfasser seinen polnischen Landsleuten: »Wenn dieses Buch neue Liebhaber der deutschen Literatur gewinnt und dazu beiträgt, unsere Verbindung zum friedliebenden und demokratischen Deutschland zu vertiefen – so werde ich meine Aufgabe erfüllt haben.«
An der Aufgabe, andere zu dem zu machen, was er selbst war: zu »Liebhabern der deutschen Literatur«, hat er bis zu seinem Lebensende festgehalten. »Meine Geschichte der deutschen Literatur«, das erste Buch Marcel Reich-Ranickis, das nach seinem Tod erscheint, ist die bisher umfangreichste Auswahl aus den wichtigsten und besten Essays dieses Kritikers. Sie ist in der Weise geordnet, dass sie ein Bild jener deutschen Literaturgeschichte vermittelt, in der er seine Heimat fand. Sie kann als Fortführung seines vor sechzig Jahren begonnenen Vorhabens verstanden werden, aber auch als Gegenstück dazu. Denn sie entstand unter ganz anderen Voraussetzungen, ist geschrieben in anderer Form und richtet sich an ein anderes Publikum.
Als Kritiker eigener Bücher erinnert sich Reich-Ranicki in seiner Autobiographie »Mein Leben« an die frühe Publikation nicht eben begeistert: »Auf dieses Opus stolz zu sein, habe ich nicht den geringsten Grund. Auch wenn manch ein Kapitel, manch ein Abschnitt mir erträglich scheint, erröte ich nicht selten, wenn ich heute in diesem Buch blättere.« Es sei »eine ziemlich schludrige Arbeit«, die allzu deutlich erkennen lasse, »welche verheerende Doktrin auf den Autor Einfluß ausgeübt hat – der sozialistische Realismus. Jawohl, meine Literaturkritik war bis etwa 1955 von der marxistischen und gewiß auch vulgärmarxistischen Literaturtheorie geprägt.« Als er 1951 als Literaturkritiker zu schreiben begann, sei er außerdem Anfänger gewesen. Und in Polen seien noch dazu seine Bemühungen, jene Bücher zu bekommen, die nur im Westen verlegt wurden, zum Beispiel die von Franz Kafka oder Robert Musil, vergeblich geblieben.
Alles, was in Reich-Ranickis jetzt vorliegender Geschichte der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu lesen ist, hat er in den Jahrzehnten nach 1955 geschrieben, die Zusammenstellung seiner Arbeiten dazu jedoch nicht mehr selbst vornehmen können. Fragmentarisch bleibt seine neue Geschichte der deutschen Literatur trotz oder gerade wegen ihrer erheblichen Erweiterung immer noch, doch das kommt ihr durchaus zugute. Was jetzt zu lesen ist, genügt nicht dem ohnehin problematischen Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit, mit der uns akademische Literaturgeschichten so oft ermüden, sondern vermittelt ein Bild der ganz persönlichen Vorlieben und Abneigungen eines Literaturkritikers, der diese in seiner Literaturgeschichte mit großer Leiden- und Kennerschaft mitreißend und oft provokativ zu begründen versucht. Allerdings gibt es auch andere Gründe dafür, dass die Beiträge dieses Kritikers Lücken in seiner Literaturgeschichte lassen – und zwar solche, die er selbst gerne gefüllt hätte und die er mit verschiedenen Mitteln zumindest in Ansätzen auszugleichen versuchte.
1958 reiste Reich-Ranicki in die Bundesrepublik, kehrte nicht mehr nach Polen zurück und verschrieb sich ganz dem Beruf des Literaturkritikers. Literaturkritiker haben anderes zu tun, als literaturgeschichtliche Forschungen zu betreiben. Literaturkritik zeichnet sich, seit es sie in unserem heutigen Sinn gibt, also seit dem frühen 18. Jahrhundert, dadurch aus, dass sie sich vorrangig der Gegenwart zuwendet und sich von ihr herausfordern lässt. Im Gegensatz zum gelehrten »Bücherwurm« und seiner pedantischen Anhäufung von Wissen über eine ferne Vergangenheit sowie zum methodisch geschulten Philologen, der sich vornehmlich um die gesicherte Erkenntnis und Interpretation antiker Texte bemüht, entsteht in Frankreich nach dem Vorbild des Juristen, Politikers und Philosophen Michel de Montaigne, der als Begründer der Essayistik gilt, der neue Typus des »weltmännischen« Kritikers. Dessen »critique mondaine« richtet den Blick stärker auf die Gegenwart und die aktuelle Buchproduktion, er schreibt nicht mehr in der lateinischen Sprache der Gelehrten, sondern in der jeweiligen Volkssprache und wendet sich, bevorzugt in Zeitschriften, an ein breiteres Publikum.
Dieser neue Typus des »Criticus«, aus dem der Literaturkritiker im heutigen Verständnis hervorging, etabliert sich im Laufe des 18. Jahrhunderts. Das Prestige, das der Begriff »Kritik« im Zeitalter der Aufklärung gewinnt, hat seine Arbeit motiviert und gefördert.
In der Tradition der Aufklärung war Marcel Reich-Ranicki ein Kritiker mit Leib und Seele. Literarische Neuerscheinungen zu sichten und zu sondieren, welche es verdienen, rezensiert zu werden, von ihm selbst oder von seinen Mitarbeitern, das literarische Leben der Gegenwart zu beobachten und an ihm teilzuhaben, stand im Mittelpunkt seiner Arbeit. Die Zahl seiner Veröffentlichungen zur Literatur des 20. Jahrhunderts ist um ein Vielfaches größer als die zur Literatur aller Jahrhunderte davor. Umso bemerkenswerter bleibt es, dass er trotzdem die Geschichte der Literatur, vor allem der deutschsprachigen, die Auseinandersetzung mit Autoren und Autorinnen der Vergangenheit nie aus dem Auge verloren hat. Von den Gelegenheiten, die auch gegenwartsorientierte Literaturkritiker haben, sich mit der nahen und fernen Vergangenheit auseinanderzusetzen, hat er ausgiebig Gebrauch gemacht: Gedenktage, Preisverleihungen im Namen Büchners oder Hölderlins, Todesfälle, die Veröffentlichung von Werkausgaben, Briefen oder Tagebüchern längst toter Dichter.
Was haben sie ihm bedeutet? Spätestens bei der Lektüre von »Mein Leben« konnte jeder begreifen, dass sein passionierter Umgang mit der Literatur der Gegenwart und der Vergangenheit einem existentiellen, lebenserhaltenden und -intensivierenden Bedürfnis entsprach. Er war Sohn einer deutschen Jüdin und eines polnischen Juden, die jüdische Religion blieb ihm fremd, er wurde in Polen geboren, ging in Berlin zur Schule, wurde 1938 von den Nationalsozialisten nach Warschau deportiert, seine Eltern und sein Bruder wurden von Deutschen ermordet, er lebte nach dem Krieg wenige Monate in Berlin, beinahe zwei Jahre in London und dann wieder in Warschau, wohnte nach seiner Ausreise aus Polen einige Jahre in Hamburg und nach 1973 in Frankfurt. Für ihn konnte kein Ort auf dieser Welt zu einer Heimat werden. Seine Heimat war die Literatur, vor allem die deutsche. Sie war, mit dem von ihm oft zitierten Wort Heinrich Heines, sein »portatives Vaterland«, eigentlich aber sein Mutterland. Die Liebe zur deutschen Literatur und Kultur ist mit der Liebe zu seiner Mutter Helene Reich, geborene Auerbach, unmittelbar verbunden. Die Mutter beschaffte sich in Polen deutsche Bücher, abonnierte das »Berliner Tageblatt«, zitierte in Gesprächen gerne die deutschen Klassiker, und wenn der Sohn ihr zum Geburtstag gratulierte, machte sie ihn regelmäßig darauf aufmerksam, dass sie am gleichen Tag wie Goethe geboren sei.
Reich-Ranickis Veröffentlichungen zur Literatur sind Liebesbekundungen. Noch seiner heftigsten Kritik ist die Enttäuschung eines Liebhabers eingeschrieben, der nicht gefunden hat, was er leidenschaftlich suchte: eine Literatur, die derart intelligent, fesselnd und schön ist, dass man sie ein Leben lang lieben kann. Seine Literaturgeschichte ist eine Liebesgeschichte, gekennzeichnet von oft sehr persönlichen, höchst eigenwilligen Vorlieben, Abneigungen und Ambivalenzen. »Nein, ich liebe ihn nicht, diesen Friedrich Hölderlin«, beginnt einer seiner Essays, der diese Erklärung am Ende widerruft. Bewunderung und Dankbarkeit empfinde er gegenüber diesem Dichter, bekennt er, und fügt hinzu: »Wo ich mich vor der deutschen Dichtung in Dankbarkeit und in Bewunderung verneige, da ist stets auch sie im Spiel, die Liebe.«
Über den Literaturkritiker Ludwig Börne schreibt Reich-Ranicki: »Er war verliebt in Deutschland und die deutsche Kultur. Aber diese Liebe hat Börne niemals gehindert, den Deutschen die bittersten Wahrheiten zu sagen.« Und: »An Feinden freilich hat es ihm nicht gefehlt. Aber verächtlich ist der Kritiker, der keine Feinde hat.« Wie so oft in seinen Essays, die nicht nur die Texte von Autorinnen und Autoren im Blick haben, sondern Psychogramme von Persönlichkeiten und Schilderungen der Lebensumstände sind, unter denen sie geschrieben und gelitten haben, charakterisiert er hier auch sich selbst. Das gilt besonders für die Essays, die sich mit seinen eigenen Vorläufern auseinandersetzen. So intensiv wie bislang kein anderer Kritiker hat er sich mit der Geschichte der Literaturkritik befasst, die in einer (und gerade auch in seiner)Geschichte der Literatur nicht fehlen darf. Sie hat daher in diesem Band mit Beiträgen über Lessing, Friedrich Schlegel, Ludwig Börne oder Alfred Kerr ihren angemessenen Platz gefunden.
Seine Aufsätze dazu sind in einem seiner besten und auch für die Literaturwissenschaft unverzichtbaren Bücher gesammelt: »Die Anwälte der Literatur«. Interessiert hat ihn an dieser Geschichte nicht zuletzt die Beziehung zwischen Kritik und Geschichtsschreibung, zwischen der Tätigkeit des Kritikers und des Historikers. »Häufig gelang es Schlegel, als Kritiker auch ein Literaturhistoriker und als Literaturhistoriker auch ein Kritiker zu sein.« Der Satz formuliert ein Ideal, dem Reich-Ranicki selbst zu entsprechen versuchte. Am Beispiel des Kritikers illustrierte er aber auch, was er selbst vermeiden wollte: »Nur eine einzige Epoche faszinierte ihn: die Gegenwart.« Dass Börnes Schriften heute weitgehend vergessen sind, sei nicht verwunderlich: »So ergeht es den Publizisten und Journalisten beinahe immer: Der unmittelbaren Gegenwart verpflichtet, geraten sie in einer späteren Epoche in Vergessenheit.«
Der Literaturkritiker Reich-Ranicki war immer auch Literaturhistoriker. Das zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Seine Rezensionen nehmen literarische Neuerscheinungen oft zum Anlass für weit gespannte literaturgeschichtliche Überlegungen und Vergleiche. Längere Aufsätze wie die »Anmerkungen zur Literatur der siebziger Jahre« geben rückschauende und noch heute unübertroffene Überblicke zu literarischen Entwicklungen eines ganzen Jahrzehnts. Der 1981 erschienene Band »Entgegnung«, in dem dieser Überblick einleitend steht, enthält eine Sammlung seiner Artikel, die zusammen ein umfassendes und höchst anschauliches Bild von der Literaturgeschichte dieser Jahre vermitteln. Eine Art Geschichte der deutschen Nachkriegsliteratur bis Ende der 1960er Jahre enthalten die zuvor erschienenen Sammelbände »Deutsche Literatur in West und Ost« und »Literatur der kleinen Schritte«. Weiter zurück blicken die Bände »Nachprüfung« sowie »Sieben Wegbereiter«, die mit Essays über Fontane bis hin zu Klaus Mann etwa den Zeitraum umfassen, den Reich-Ranickis erstes Buch behandelte.
Der Titel »Nachprüfung« ist kennzeichnend für seinen Umgang mit der literarischen Vergangenheit. Der Literaturhistoriker war immer auch Literaturkritiker. In dem Buch »Der doppelte Boden«, einem langen, spannenden, höchst anregenden und lehrreichen Gespräch mit dem Züricher Literaturwissenschaftler und Kritiker Peter von Matt, nennt er die Klassikerverehrung eine »Spezialität des deutschen Untertanen-Staates« und bewundert die Engländer, die nie vor der Frage zurückscheuten: »How good is ›Hamlet‹?« In Reich-Ranickis Übersetzung: »Was taugt eigentlich der Shakespeare?« Shakespeare sei dadurch lebendig geblieben. »Durch das Anzweifeln wird die überlieferte Literatur am Leben erhalten, zumindest in vielen Fällen.«
Das Anzweifeln macht keineswegs vor den Autoren halt, die er ganz besonders schätzt. Sogar der wie kein anderer verehrte Goethe wird davon nicht verschont. Dessen Gedicht »Rezensent« disqualifiziert er als sein »dümmstes«. Sein Essay über Lessing, den bewunderten »Vater der Kritik«, kritisiert seine kritiklosen Verehrer, die mit ihren »ehrerbietigen Hymnen und huldvollen Lobsprüchen« versuchen, sich »den unbequemen, wenn nicht gar etwas unheimlichen Klassiker vom Leibe zu halten«, und damit nur zeigen, wie wenig sie von Lessing gelernt haben und »wie fremd« ihnen »der kritische Geist dieses Autors ist«. Kein Autor und kein Leser kann bei Reich-Ranicki vor überraschenden und provozierenden Respektlosigkeiten sicher sein. »Nachprüfungen« sind jedenfalls auch jene Essays, Reden oder Porträts, die sich mit Autoren befassen, die vor dem 20. Jahrhundert berühmt geworden sind und zum Kanon der deutschen Literaturgeschichte gehören.
Aber reicht seine Geschichte wirklich bis zum Mittelalter zurück? Fehlt die Zeit bis zur deutschen Klassik nicht fast völlig? Die diesem Band zur Einführung vorangestellten Essays erzählen Geschichten zur Literatur, die sogar noch weiter zurückreichen, dabei Beispiele der Weltliteratur zum Vergleich heranziehen und ganze Jahrhunderte durchforsten. Die Geschichte zum Motiv des Herzens in der deutschen Literatur geht auf die »Edda« ein, das »Atlilied« oder auch auf Gottfried von Straßburgs »Tristan«. Das »Mittelalter« im Untertitel dieses Bandes ist jedenfalls nicht allein durch seine Interpretation des Gedichtes »Under der linden« von Walther von der Vogelweide gerechtfertigt. Die im zweiten Essay erzählte »Geschichte der Juden in der deutschen Literatur« beginnt im 18. Jahrhundert. Und indem sie sich ziemlich ausführlich mit Rahel Varnhagen von Ense befasst, begegnet sie auch einer weiteren Lückenhaftigkeit, die man seiner Literaturgeschichte vorwerfen könnte. Zumindest im Inhaltsverzeichnis sind bis zur literarischen Moderne Autorinnen nicht vertreten, bis 1945 nur drei und erst danach in großer Zahl. Der dritte einführende Essay, der eine kleine Geschichte der schreibenden Frauen in der deutschen Literatur erzählt, das Mittelalter und die frühe Neuzeit mit im Blick hat und sich dann dem bedeutenden Anteil schreibender Frauen in der Romantik zuwendet, zeigt allerdings, dass diese Lücken keineswegs auf Ignoranz oder Geringschätzung des Literaturhistorikers zurückzuführen sind.
Dass Reich-Ranickis Geschichte der deutschen Literatur dennoch Lücken aufweist, würde er allerdings auch selbst nicht bestreiten. Sie sind im 18. und 19. Jahrhundert sogar da offen sichtbar, wo es sich um von ihm besonders geschätzte Autoren handelt. Über Büchner, den »Dichter meiner Jugend«, oder E. T. A. Hoffmann hat er erst spät etwas geschrieben, und das nur kurz. Über Goethe viel, doch über den von ihm geliebten Schiller fast gar nichts. Dabei ist beispielsweise Friedrich Schillers erstes Theaterstück »Die Räuber« für Marcel Reich-Ranicki, wie er 2010 in einer Fernsehsendung bekannte, »eines der schönsten Stücke der deutschen Literatur«. Er hat es in seinen »Kanon der deutschen Literatur« aufgenommen.
Will man die gesammelten Beiträge zu Reich-Ranickis Geschichte der deutschen Literatur, wie sie hier vorliegen, mit weiteren von ihm vervollständigen, gibt der Anhang Hinweise zur Orientierung in seinen zahlreichen und nicht eben leicht überschaubaren Buchpublikationen, in denen seine Arbeiten in unterschiedlichen Zusammenhängen, Fassungen und zum Teil unter verschiedenen Titeln erschienen sind. Weiterführende Hinweise, auch auf Arbeiten, die in diesem Band eigentlich stehen sollten, aber aus Umfangsgründen keinen Platz mehr fanden, sind auf der Website www.m-reich-ranicki.de zu finden.
Darüber hinaus ist man auf Arbeiten des Kritikers und Literaturhistorikers angewiesen, die seine publizistischen Werke begleitet und ergänzt haben: auf die von 1974 bis zu seinem Tod herausgegebene »Frankfurter Anthologie«, auf die Interpretationsreihe mit dem bezeichnenden Titel »Romane von gestern – heute gelesen« und auf zahlreiche Anthologien von Gedichten, Erzählungen oder auch Romanen. Sein ehrgeizigstes und bekanntestes Projekt war dabei seine Kanon-Bibliothek, eine 2002 und in den folgenden Jahren erschienene Sammlung von deutschsprachigen Romanen, Erzählungen, Dramen, Gedichten und Essays, die zusammen eine große Lesebuch-Reihe zu seiner Geschichte der deutschen Literatur sind. Wie sehr dem Kritiker im hohen Alter daran gelegen war, das literaturhistorische Vorhaben seiner jungen Jahre fortzuführen, zeigt nicht zuletzt auch seine kleine, fragmentarische Geschichte der Literatur von Shakespeare bis Thomas Bernhard, als die sich der 2003 erschienene Band »Meine Bilder« verstehen lässt. Die hier mit von ihm gesammelten Zeichnungen, Radierungen und Lithographien abgebildeten Autoren und Autorinnen hat er in knapper Form porträtiert. Einige Porträts aus dem Band wurden hier übernommen.
Fragmentarisch bleibt die hier vorgelegte Literaturgeschichte aber auch mit Blick auf die »Gegenwart«. Die Literatur der 1990er Jahre und des 21. Jahrhunderts hat Reich-Ranicki kaum noch publizistisch kommentiert, aber sehr wohl in anderer Weise: vor allem als Initiator und Leiter des Literarischen Quartetts. Hier wurden zwischen 1988 und 2001 Bücher von Autorinnen und Autoren besprochen, die das Profil der deutschen Gegenwartsliteratur mit geprägt haben: von Ruth Klüger, Urs Widmer, Christoph Ransmayr, Robert Schneider, Bernhard Schlink, Ingo Schulze, Judith Hermann und vielen anderen, über die er nur selten oder überhaupt nicht geschrieben hat. Doch auch im Literarischen Quartett agierte Reich-Ranicki mit Nachprüfungen zur Literaturgeschichte. Das letzte Buch, über das dort gesprochen wurde, war Goethes »Werther«, der »Roman eines Anfängers« mit »bahnbrechender Wirkung in der Geschichte der Weltliteratur«, den am liebsten er selbst entdeckt hätte. Spätere Sondersendungen hatten Todesjahre von Friedrich Schiller, Thomas Mann, Heinrich Heine und Bertolt Brecht zum Anlass.
Reich-Ranicki ist seit seinem Literarischen Quartett als Fernsehstar und als literaturkritischer Unterhaltungskünstler populär geworden. Das war er in der Tat, und er war es gerne. Doch sollte man nicht vergessen, dass der gegen Ende der sechziger Jahre an Universitäten der USA, in den siebziger Jahren an den Universitäten von Stockholm und Uppsala lehrende, 1974 von der Universität Tübingen zum Honorarprofessor ernannte Literaturwissenschaftler, dessen Leistungen mit insgesamt neun Ehrendoktorwürden ausgezeichnet wurden, ein sehr ernsthafter und ernst zu nehmender, historisch ungemein belesener Gelehrter war. Seine Leistungen als Literaturkritiker und Literaturhistoriker, die ihn in die bedeutende Reihe der von ihm porträtierten »Anwälte« der Literatur von Lessing bis Walter Benjamin stellen, sind an Arbeiten, wie sie in dieser Sammlung zur Geschichte der deutschen Literatur vorliegen, deutlicher zu erkennen als in seinen Fernsehauftritten. Doch auch die hier gesammelten Essays und Artikel sind alles andere als nur gelehrt. Sie geben Einblicke in die Geschichte der deutschen Literatur, die an herausfordernder Lebendigkeit nicht ihresgleichen haben. Reich-Ranicki ist es wie keinem anderen Kritiker und Literaturwissenschaftler gelungen, im Umgang mit Literatur die Kluft zwischen populärer Unterhaltung und historisch fundierter Intellektualität zu schließen. Lessing war ihm da ein Vorbild. Denn »er diente der Wissenschaft mit dem Temperament des Journalisten und dem Journalismus mit dem Ernst des Wissenschaftlers«.
Dafür, dass seine Geschichte der deutschen Literatur in relativ kurzer Zeit nach seinem Tod erscheinen kann, ist einigen zu danken: der Universität Marburg, die mir bei der Vorbereitung auf eine Digitalisierung und vollständige Sammlung von Marcel Reich-Ranickis literaturkritischen Schriften und damit auch für die Zusammenstellung dieses Buches erste Hilfe geleistet hat, Charlotte Lamping für die Unterstützung bei der Einrichtung der Marburger »Arbeitsstelle Marcel Reich-Ranicki für Literaturkritik in Deutschland«, Kathrin Fehlberg, Reich-Ranickis Mitarbeiterin in der Redaktion der »Frankfurter Anthologie«, für die gründliche Bearbeitung der Druckvorlagen, seinen »Schülern« Volker Hage und Uwe Wittstock, seinem Freund und Mitstreiter im Literarischen Quartett Hellmuth Karasek, seinem Sohn Andrew Ranicki und manchen anderen für wichtige Anregungen, Vorarbeiten oder letzte Hilfen beim Korrigieren, dem Archiv der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« für die Übersicht über alle in dieser Zeitung erschienenen Artikel Reich-Ranickis und der Deutschen Verlags-Anstalt für die geduldige und produktive Zusammenarbeit. Dank schulde ich vor allem aber Marcel Reich-Ranicki selbst, der mir schon Jahre vor seinem Tod einen Teil seines Nachlasses und die Verantwortung dafür über seinen Tod hinaus anvertraut hat.
Viele der im letzten Kapitel seiner Literaturgeschichte abgedruckten Essays sind Abschiede, Nachrufe auf Schriftsteller, denen er eng verbunden war: Wolfgang Koeppen, Alfred Andersch, Heinrich Böll, Peter Weiss, Erich Fried, Uwe Johnson, Ernst Jandl und Hermann Burger. Sein »Abschied von Arnold Zweig« im Dezember 1968 stellte diesen heimatlosen »preußischen Juden« und sein »umfangreiches schriftstellerisches Werk« mit Dankbarkeit in die Tradition einer »eigentümlichen« und »unheimlichen« deutsch-jüdischen Symbiose, die mit den Namen Heine und Kafka assoziiert ist und »die sich aus der Geschichte der deutschen Literatur nicht mehr wegdenken lässt«. Das gilt auch für den Kritiker und Schriftsteller Marcel Reich-Ranicki. Er hat diese Geschichte nicht nur erzählt, sondern sie auch über ein halbes Jahrhundert hinweg maßgeblich mitgeprägt.
ZUR EINFÜHRUNG
Das Herz – der Joker der deutschen Dichtung
Mit dem Herzen hat es eine eigene Bewandtnis. Es ist – sagt der Prophet Jeremias – »das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?« Ohne das Herz, weiß jedes Kind, kann niemand existieren. Nur stellt sich meist heraus, dass gerade die herzlosen Menschen lange und gut leben. Man kann sein Herz verschenken: »Ich schenk mein Herz nur dir allein« – singt die Madame Dubarry in Millöckers Operette. Man kann sich auch ein Menschenherz als Geschenk wünschen, ohne deshalb der Grausamkeit bezichtigt zu werden. Aus dem »Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach« kennen wir ja das wunderbare Lied, das mit den Worten beginnt: »Willst du dein Herz mir schenken, /so fang es heimlich an …« Bisweilen sind jene Menschen besonders glücklich, die ihr Herz verschenkt oder die es ganz einfach verloren haben, beispielsweise in Heidelberg.
Verwunderlich ist auch, was das Herz alles vermag. Denn es kann schlagen und klopfen, pochen und hämmern, es kann zittern und flattern, aber auch schmachten und jubeln, es kann stillstehen, aber auch aufwachen und erglühen, es kann stocken und versagen, brechen und zerspringen. Das Herz kann sich an sehr verschiedenen Orten befinden, mitunter sogar gleichzeitig. Man kann es auf der Zunge haben, aber es kann einem auch in die Hose rutschen. Es kann einem im Leibe lachen, aber sich auch im Leibe umdrehen. Man kann es auf dem rechten Fleck haben, aber auch stehlen und erobern.
Man kann sich ein Herz fassen, aber auch sein Herz an jemanden hängen. Man kann seinem Herzen Luft machen und ihm einen Stoß geben, es kann einem ein Stein vom Herzen fallen. Man kann etwas auf dem Herzen haben und ein Kind unter dem Herzen tragen.
Man kann die Zwietracht, zumal die deutsche, mitten ins Herz treffen. Und wes das Herz voll ist – wir wissen es aus der Bibel –, des kann der Mund übergehen. Und da man sich einer Sache mit halbem Herzen zuwenden kann, lässt es sich offenbar auch halbieren. Natürlich kann man aus seinem Herzen eine Mördergrube und, häufiger noch, keine Mördergrube machen. Auch kann man jemanden in sein Herz schließen, ja, dort ist so viel Platz, dass sich sogar ein ganzer Chor ins Herz schließen lässt. Und weil das Herz, wie man schon im Mittelalter zu wissen glaubte, eben verschließbar ist, kann es gewisse Schwierigkeiten und auch Möglichkeiten geben – nämlich mit dem Schlüssel. In einem der ältesten und schönsten deutschen Liebesgedichte, in jenem, das aus nur sechs Versen besteht und mit den Worten beginnt: »Du bist min, ich bin din: /Des solt du gewis sin«, ist die oder der Geliebte im Herzen verschlossen, zu dem es ein Schlüsselein gibt; aber es ist abhanden gekommen, und so muss sie oder er immer darin, im Herzen also, bleiben.
Es gibt kaum ein Substantiv, das die Menschen, jedenfalls in Europa, so häufig und in so vielen Verbindungen gebrauchen wie dieses eine: das Herz. Es gibt auch kaum ein Eigenschaftswort, das man nicht früher oder später mit der Vokabel »Herz« gekoppelt hätte. Ein Herz kann warm und weich sein, treu und traurig, klein und kalt, heiß und hart, gütig und großzügig, stolz und steinern. Kurz: Es kann alles sein. Groß ist auch die Zahl der deutschen Adjektive, die aus dem Wort »Herz« gebildet wurden. Wir sprechen von barmherzigen, engherzigen und hartherzigen, von herzlichen und herzhaften, von herzlosen und herzgläubigen Menschen.
Mehr noch: Das Herz, ein Körperteil, kann seinerseits, so wollen es manche Dichter, und nicht die schlechtesten, ebenfalls Körperteile haben, zumindest Knie. Jedenfalls schrieb Kleist am 24. Januar 1808 an Goethe, dem er das erste Heft des »Phoebus« zuschickte: »Es ist auf den ›Knien meines Herzens‹, daß ich damit vor Ihnen erscheine.« Allerdings hat Kleist die Wendung »Knien meines Herzens« mit Anführungszeichen versehen.
Woher stammen diese Worte? Wir wissen es nicht, doch wurde vermutet, er habe jenen Autor zitiert, den die Schriftsteller am liebsten zitieren – nämlich sich selbst. Denn in seiner »Penthesilea« heißt es: »O du, /Vor der mein Herz auf Knien niederfällt …« Es kann aber auch sein, dass Kleist – fleißige Germanisten haben es nachgewiesen – artigerweise seinen Adressaten zitiert hat, dem diese Wendung schon in frühen Jahren unterlaufen ist. Nur hat auch Goethe die »Knie des Herzens« keineswegs erfunden, es gab sie schon bei Petrarca. Und auch dieser hat sie entliehen, nämlich aus der Bibel.
Was immer das Herz betrifft oder mit dem Herzen zusammenhängt – es hat eine lange, eine uralte Tradition. Seit die Menschen denken und ihre Gedanken ausdrücken und notieren konnten, war für sie das Herz ungleich mehr als nur ein Muskel. Und so unterschiedlich die alten Völker das Herz beurteilt haben, so wurde ihm doch stets eine zentrale Funktion zugesprochen.
Klare, wenn auch falsche Vorstellungen von der Funktion des Herzens hatten die alten Ägypter: Sie waren überzeugt, in ihm sei das Gewissen des Menschen untergebracht. Daher haben sie auch, um sich von der Redlichkeit eines Verstorbenen zu überzeugen, dessen Herz gewogen: Je schwerer es war, desto besser war sein Charakter. Die Chinesen wiederum glaubten, das Herz sei das intellektuelle Zentrum des Menschen. Auch die alten Griechen, Aristoteles zumal, haben das Herz keineswegs unterschätzt: Sie hielten es für das wichtigste Organ des Körpers, sie waren sicher, dass alle anderen von ihm abhingen. Aber zugleich meinten sie, in ihm sei die Seele des Menschen zu finden.
Und die Liebe? Schon in dem berühmten »Gilgamesch«, dem vor über viertausend Jahren entstandenen babylonischen Nationalepos, hat das Herz mit der Liebe zu tun. So wird hier in einer eindeutig erotischen Episode ein Jäger von einer hübschen Frau, offensichtlich einer Hure, zärtlich betreut: »Er wurde« – lesen wir – »heiter, und sein Herz war voll Freude …«
Doch sind derartige Verweise in der alten Literatur nur selten, nur in Ausnahmefällen zu finden: Noch hat man erotische Gefühle keineswegs, wie immer wieder in späteren Zeiten, dem Herzen zugeschrieben. Und dies gilt, trotz der aristotelischen Lehre von der Allmacht des Herzens, auch für das alte Griechenland. Erst aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert stammt eine bemerkenswerte, wenn nicht gar bahnbrechende Geschichte.
Es geschah, dass der Sohn des Königs von Syrien, der Kronprinz Antiochus, schwer erkrankt war. Niemand konnte ihn heilen. Da ließ der alte König den berühmten Arzt Erasistratos rufen. Dieser untersuchte und beobachtete den Patienten sorgfältig und fand heraus, dass dessen Puls besonders schnell ging, sobald er seine Stiefmutter, die junge und schöne Königin, zu sehen bekam. Die Diagnose des Arztes lautete: Der Kronprinz sei herzkrank, doch heilbar. Er leide an der Liebe zur Stiefmutter. Sein Vater war klug und wollte nichts von König Philipps Glück. Er verzichtete also auf seine jugendliche Gemahlin, und der Kronprinz wurde gesund und glücklich: Die Don-Carlos-Tragödie fand in Syrien nicht statt. Erasistratos, der also bestimmte Herzleiden zu heilen vermochte, war natürlich kein Kardiologe, vielmehr ein Arzt, der sich vor allem auf die psychischen Ursachen der Erkrankungen verstand. Seitdem sind über zweitausend Jahre vergangen, und in der Dichtung ist, schon seit dem frühen Mittelalter, von dem Herzen die Rede. Aber in der Regel sind es nicht die Kardiologen, die den Helden der Literatur helfen könnten.
Nicht etwa, dass die Ärzte angesichts dieser Leiden überflüssig wären. Im Gegenteil, auch und gerade jene Menschen, von denen wir in Romanen, in Dramen und Gedichten hören, brauchten oft die Mediziner. Patienten sind sie allemal, nur fallen ihre Krankheiten wohl eher in die Kompetenz der Psychotherapeuten, wenn nicht gar der Psychiater. Sicher ist jedenfalls, dass schon in den ältesten deutschen Dichtungen, in den Epen des 9. Jahrhunderts, auf »Herz« »Schmerz« gereimt wurde und dass diesen Schmerzen nicht die Ärzte ihre Einkünfte verdankten, sondern die Literaten.
Wenn das Herz keine Leiden bereitete, zahllose Gedichte wären ungeschrieben geblieben und viele Romane und Dramen ebenfalls. Das Motto der Deutschen Herzstiftung – »Hab’ ein Auge auf dein Herz« – ist gewiss ein guter Spruch, ein notwendiger Appell an uns alle. Nur an eine Adresse braucht man ihn nicht zu richten: an die Literatur. Ja, mir will es scheinen, dass sich viele Jahrhunderte hindurch die Dichtung mehr um das Herz gekümmert hat als die Medizin. Und heute wird den Schriftstellern bisweilen vorgeworfen, dass sie sich allzu intensiv und extensiv mit dem eigenen Herzen, mit der eigenen Person beschäftigen.
In alten Zeiten wurde allerdings in deutschen Ländern das Herz, wenn man der Literatur trauen kann, oft gegessen. So hat, der »Edda« zufolge, Siegfried das Herz des Riesen Fafnir verspeist und dadurch die Sprache der Vögel erlernt; bei Richard Wagner wird dieser aus linguistischen Gründen erforderliche Konsum deutlich eingeschränkt: Hier genügen, um das Vogelidiom zu erlernen, schon einige Blutstropfen. Im »Atlilied« geht es noch barbarischer zu: Gudrun setzt ihrem Gatten, dem König Atli, auch Attila genannt, die Herzen ihrer Kinder zur Mahlzeit vor. Aus dem frühen Mittelalter wird noch von einem anderen Herzkonsum berichtet, der mir, bei aller Grausamkeit, doch etwas zweideutig scheint. Es seien, heißt es, Hexen oft ausgeflogen, um sich an Männerherzen gütlich zu tun: Sie rissen ihren Opfern das Herz aus dem Leibe, um es zu verschmausen. Sonderbarerweise blieben aber die Männer, denen das Herz auf diese Weise entwendet wurde, am Leben. Jene Hexen mögen verwerflich gewesen sein, ob sie auch abstoßend waren – dessen bin ich nicht so sicher. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie der feschen Lola ähnelten, die im »Blauen Engel« dem guten Professor Unrat aus Lübeck das Herz geraubt hat und auch den Verstand.
Sicher ist jedenfalls, dass niemand im Laufe der Jahrhunderte herzgläubiger war als die Dichter. Den Vermutungen oder Einsichten oder auch Irrtümern der Wissenschaft zum Trotz besangen sie das Herz als das Organ, in dem nahezu alle menschlichen Affekte ihren Ursprung haben sollten – nur wenige, und meist eher unangenehme, wurden anderen Organen zugewiesen, so etwa der Galle.
Keiner der großen mittelhochdeutschen Epiker und Lyriker kann auf die Vokabel »Herz« verzichten, sie ist das Schlüsselwort der höfischen Poesie. In Gottfried von Straßburgs »Tristan« kommt das Wort »Herz« allein im Prolog fast dreißigmal vor. Aber für Gottfried ist dieser Körperteil mehr als der Sitz der Gefühle und der Leidenschaften. Er beherbergt zugleich die Kraft, die die Welt in Bewegung setzt und hält: Das Herz ist für ihn das Zentrum des Lebens.
Daran hat sich nicht mehr viel geändert: Etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kreist die deutsche Dichtung um das Herz. Und kaum ein Autor, der nicht noch einmal den Lesern den ältesten, den beliebtesten und vielleicht auch schönsten deutschen Reim offerieren würde, jenen, der schon im Spätmittelalter, im 15. Jahrhundert, von Oswald von Wolkenstein erweitert wurde, nämlich zu dem Dreireim »Herz – Schmerz – Scherz«.
Seinen Höhepunkt erreicht der Herzkult der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert – im Sturm und Drang ebenso wie in der Zeit der Klassik. Das Herz ist gleichsam das Sammelbecken aller sinnlichen Triebe und aller idealistischen Bestrebungen. Doch bei keinem der großen Dichter spielt es eine so wichtige, eine so zentrale Rolle wie bei Goethe.
Er nannte das Herz den »jüngsten, mannigfaltigsten, beweglichsten, veränderlichsten, erschütterlichsten Teil der Schöpfung«. Wie man sieht, hat er mit Beiworten nicht gespart. Aber was heißt denn das eigentlich – der mannigfaltigste, der beweglichste, der veränderlichste Teil der Schöpfung? Die Formulierung findet sich in einer der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes. Dennoch fällt es schwer, ihr Exaktheit nachzurühmen. Der mannigfaltigste oder der veränderlichste Teil der Schöpfung – das kann viel bedeuten oder auch nichts.
Tatsache ist, dass die Vokabel »Herz« wie kaum ein anderes deutsches Wort oft zu leeren Phrasen verleitet – und nicht nur die schwachen Dichter, sondern bisweilen auch die größten, so eben Goethe. Im »Götz von Berlichingen« äußert sich der Diener Franz emphatisch über die Schönheit des Fräuleins Adelheid. Sein Herr, Weislingen, bemerkt kühl: »Du bist drüber gar zum Dichter geworden.« Hierauf Franz: »So fühl’ ich denn in dem Augenblick, was den Dichter macht, ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz!«
Das aber ist, mit Verlaub, barer Unsinn: Würde ein »ganz von einer Empfindung volles Herz« schon ausreichen, um das Individuum in einen Dichter zu verwandeln, wir könnten uns vor lauter Dichtern gar nicht retten. Das volle Herz haben die Poeten oft genug mit ihren Lesern gemein, was aber jene von diesen unterscheidet, ist eben nicht die Empfindung, sondern die Fähigkeit, sie auszudrücken. Natürlich hat Goethe das gewusst, doch wenn er das Wort »Herz« gebrauchte, ließ seine Selbstkontrolle ein wenig nach.
Man mag einwenden, dass er, als er den »Götz« schrieb, noch jung war. Aber auch der alte Goethe, der Autor des zweiten Teils des »Faust«, liebte die Herz-Phrasen. Beeindruckt von der Redeweise des Lynkeus, fragt Helena: »So sage denn, wie sprech’ ich auch so schön?« Und Faust belehrt sie: »Das ist gar leicht, es muß von Herzen gehn.« Wenn das schon genügte, wir könnten uns auch vor lauter Meistern der Rhetorik nicht retten.
Wie bedenklich der Umgang unseres Goethe mit dem Wort »Herz« ist, zeigt vielleicht am deutlichsten eine berühmte und auf ihre Weise herrliche Szene aus dem ersten Teil des »Faust«. Ich meine jenes Gespräch in Marthens Garten, in dem Gretchen, ein wenig altklug und etwas aufdringlich, wissen möchte, wie Faust es mit der Religion halte, ob er an Gott glaube. Die Frage ist klar und ganz und gar unmissverständlich, die Antwort eher nebulös und auf jeden Fall ausweichend: Er habe keinen Namen dafür. Gefühl sei alles: »Name ist Schall und Rauch /Umnebelnd Himmelsglut.« Dies sagt Faust just in dem Augenblick, da er Gretchen eben doch mehrere Namen zur Auswahl angeboten hat: »Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!«
Wie also? Ist das Herz etwa ein Synonym für Glück, für Liebe und auch noch für Gott? Sollte das Herz ein Allerweltswort sein, das nahezu alles symbolisieren kann, also gleichsam der Joker der deutschen Sprache, der deutschen Dichtung?
Wer Goethe und vielen seiner Zeitgenossen und Nachfolger Derartiges vorwirft, sollte allerdings bedenken, dass es sich hier um ein nicht nur deutsches Übel handelt, sondern um eine Art Zeitkrankheit. Bei Rousseau, um nur dieses eine Beispiel anzuführen, gibt es das Wort »Herz« so häufig, dass man ihm nachgesagt hat, er gebrauche es immer dann, wenn er ein Phänomen überhaupt nicht erklären könne. Sicher ist: das Herz, das war der Ausdruck für alles Unbegreifliche, für alles Unfassbare.
So wird es auch verständlich, dass die neue Generation, die der Romantiker, dem Herzkult misstraute, ohne sich indes von ihm ganz lösen zu können. Wenn die Romantiker vom Herzen sprachen, dann meist von dem der Frau. Vom eigenen zu reden galt, wenn es nicht eindeutig ironisch gemeint war, als sentimental und pathetisch oder gar – ganz anders als in der Zeit des jungen Goethe – als schlechthin lächerlich.
Für Shelley war es ein konventionelles, ein längst abgestandenes Motiv: Er verhöhnte die Dichter, die das Moor und die felsigen Gebirgsseen besangen und auch »the heart of man«, das Herz des Menschen. Alfred de Musset äußerte sich über die Verwendung des Wortes »cœur« in der Poesie – das sich übrigens im Französischen ebenfalls auf »Schmerz«, auf »douleur« also, reimt – geradezu verächtlich. Wenn es in seinen Versen überhaupt vorkommt, dann eher als »steriles Herz«.
Und wie ist es um das Herz bei Heine bestellt? Folgt auch er der Mode der Spätromantiker? Wird auch in seiner Dichtung das noch kurz zuvor beliebteste Symbol der Liebe verspottet oder ausgespart? Keineswegs. So gewiss Heine der Zweifler und Skeptiker unter den deutschen Romantikern war, so wenig war er bereit, sich in seiner Lyrik von dem traditionellen Herzsymbol zu trennen. Das Herz gehört zu den zentralen Motiven seiner frühen Dichtung.
Es zeigt sich, dass auch bei ihm – wie bei Goethe – das Herz alles ausdrücken kann, dass er es mit allem vergleicht, etwa, ein wenig überraschend, mit dem Meer. Warum gleicht das Herz dem Meer? Auch in seinem Herzen gebe es – lesen wir im »Buch der Lieder« – »Sturm und Ebb’ und Flut, /und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht«. Wie man sieht, dient auch bei Heine die Vokabel »Herz« als Joker im Spiel der Poesie. Allerdings ist in Heines Lyrik das Herz nicht mehr – wie beim jungen Goethe – ein fröhliches, ein den Dichter ermunterndes und häufig zu amourösen Abenteuern anspornendes Organ. »Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!« – hieß es in den Sesenheimer Liedern. Das Herz Heines hingegen ist wund und krank, es bricht und blutet, in ihm verbirgt sich »meist Angst und Weh«. Und während Goethe enthusiastisch rufen konnte: »In meinem Herzen welche Glut!«, spricht Heine von einer Schlangengrube: »Ich trage im Herzen, viel Schlangen, /Und dich, Geliebte mein.«
Aber da für Heine das Herz letztlich doch nicht mehr war als eben poetisches Spielmaterial, hatte er wenig Lust, die fast schon konventionelle Alternative – Herz oder Geist – noch einmal aufzugreifen. Es ist eine uralte Alternative, ihre Wurzeln mag man in der Bibel suchen, doch keiner hat sie mehr popularisiert als – wieder einmal – Goethe.
Schon im »Werther« findet sich das (doch nicht ganz überzeugende) Bekenntnis: »Was ich weiß, kann jeder wissen. Mein Herz habe ich allein.« Und in »Dichtung und Wahrheit« verkündet und begründet er den Primat des Herzens: »… Da uns das Herz immer näher liegt als der Geist und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helfen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des Herzens immer als die wichtigsten erschienen.«
Auch Schiller liebt es, das Emotionale gegen das Rationale auszuspielen, das Herz also gegen den Verstand, jedenfalls lässt er seine Figuren derartige Sprüche recht häufig aufsagen. Max Piccolomini entgegnet seinem Vater: »Dein Urteil kann sich irren, nicht mein Herz.« Und in »Wallensteins Tod« erklärt der Kommandant von Eger: »Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.« Ähnliches hört man auch von den Autoren des Jungen Deutschland, wenn nicht von Heine, so doch von seinem großen Bundesgenossen und Widersacher, von Ludwig Börne, der nicht zögert, zu behaupten: »Nicht der Geist, das Herz macht frei.«
Indes wären wir fahrlässig, wollten wir vergessen, dass es noch eine andere deutsche Tradition gibt. An ihrer Spitze steht kein geringerer Mann als Martin Luther. Er hatte wenig Vertrauen zum Urteil des Herzens: Es sei – meinte er – wie das Quecksilber, »das jetzt da, bald anderswo ist, heut also, morgen anders gesinnt«.
Von den vielen deutschen Schriftstellern, die in den folgenden Jahrhunderten glaubten, vor dem Herzen als dem Symbol unkontrollierter Gefühle warnen zu müssen, sei jener vor allem zitiert, vor dem sich zu verneigen wir immer wieder Anlass haben: »Das Herz redet uns gewaltig gern nach dem Maule« – bemerkt ganz nüchtern Franziska, die gescheite Kammerzofe des Fräuleins von Barnhelm. Und bei Hegel ist gar vom »Brei des Herzens« die Rede, der die »Architektonik der Vernünftigkeit des Staates« gefährde.
Doch wer weiß, ob nicht klüger als alle, die immer wieder für das Herz oder den Geist plädierten, unser Fontane war, der von dieser Alternative nichts wissen wollte und stattdessen die Synthese empfahl: »O, lerne denken mit dem Herzen /und lerne fühlen mit dem Geist.«
Als Fontane dies schrieb, da war es freilich um das Herz in der Literatur nicht mehr gut bestellt: Es war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kaum dass man es merkte, in die Zuständigkeit der Trivialautoren übergegangen. Von den Schriftstellern, die auf sich hielten, wurde es nur noch wenig beachtet – vielleicht deshalb, weil sie sich von den Naturwissenschaftlern, den Physiologen zumal, überzeugen ließen, dass die Gefühle des Menschen im Gehirn lokalisiert seien und eben nicht im Herzen.
Im Mittelpunkt der großen Romane dieser Jahrzehnte stehen Frauen, die an ihrer Sehnsucht leiden. Wonach sehnen sie sich? Heute reden die Frauen alle von der Selbstverwirklichung, der fehlenden natürlich. Das Wort kannte man damals nicht, die Frauen waren indes ebenfalls auf der Suche, nur nach etwas anderem. Emma Bovary, Anna Karenina, Effi Briest – sie sehnten sich nach Liebe. Und vielleicht hatte diese Sehnsucht doch etwas mit Selbstverwirklichung zu tun. Wie auch immer: Das Herz ließ man lieber unerwähnt.
Fontane war Deutschlands größter Romancier der langen Epoche zwischen Goethe und Thomas Mann. Aber vor dem Hintergrund des europäischen Romans war er nun doch, es lässt sich nicht verschweigen, ein Nachzügler. Als er seine »Effi Briest« veröffentlichte, da schien die Zeit der einsamen und unglücklichen Ehefrauen, die sich von ihren allzu trockenen oder engstirnigen Gatten wegsehnten, schon vorbei zu sein, da wurden andere Typen modern, Vamps und Femmes fatales, raffinierte Genießerinnen und teuflische Verführerinnen, jedenfalls Frauen, für die wichtiger als die Erotik die Sexualität war – von Strindbergs Fräulein Julie über Oscar Wildes Prinzessin Salome bis zu Wedekinds kreatürlicher Lulu. Es waren herzlose Frauen oder doch zumindest solche, die als herzlos gelten wollten.
Das Herz hatte sich, so absonderlich dies klingen mag, ganz einfach überlebt. Die Psychoanalyse ignorierte es konsequent und später auch der Existentialismus. Wenn es in der deutschen Lyrik unseres Jahrhunderts noch eine große Rolle spielte, dann in den Versen der Expressionisten. So ist denn auch einer der Teile der »Menschheitsdämmerung«, der immer noch grandiosen expressionistischen Anthologie aus dem Jahre 1919, »Erweckung des Herzens« betitelt.
Das Herz besingen vor allem jene Expressionisten, die keine Angst vor dem Pathos haben und sich von der Sprache der Bibel anregen lassen – Ivan Goll etwa oder Franz Werfel. Am häufigsten hören wir vom Herzen im Werk einer skurrilen und exzentrischen Frau, die sich genötigt sieht, im Mystischen und in der Ekstase Zuflucht zu suchen – im Werk der Else Lasker-Schüler. Sie dichtet »Dein Herz ist ein Wirbelwind.« Und: »Kinder sind unsere Herzen, /Die möchten ruhen müdesüß.« Das Herz – das ist gleichsam der rote Faden ihrer Poesie und zugleich deren blaue Blume. Sogar die autobiographischen Aufzeichnungen der Else Lasker-Schüler tragen den ebenso schlichten wie anspruchsvollen Titel »Mein Herz«.
Gewiss taucht das Herz auch in den Versen anderer bedeutender Lyriker unseres Jahrhunderts auf, bisweilen in einem überraschenden, in einem wunderlichen Zusammenhang, so bei Rilke, der von den »Bergen des Herzens« spricht. Aber ein Dichter, der unserem Zeitgefühl näher steht als die Lasker-Schüler, als Rilke oder Werfel, ein Dichter wie Gottfried Benn ließ das Herz, wenn man so sagen darf, links liegen. Obwohl Benn Arzt war? Nein, vielleicht gerade deshalb, weil er Arzt war und sich daher am wenigsten Illusionen bezüglich des Herzens machen konnte.
Brecht wiederum benennt und beschreibt die Körperteile seiner Geliebten gern. Doch sind es meist solche unterhalb der Gürtellinie. Wo er die Vokabel »Herz« verwendet, was selten geschieht, geniert er sich des ältesten Reimes der deutschen Sprache nicht, nur klingt er bei ihm recht schnoddrig: »Ich kann dies feile Fleisch noch nicht verschmerzen: /So tief sitzt die Kanallje mir im Herzen.« Und wenn Brecht sagen will, warum ihn seine Geliebte He. enttäuscht hat, dann greift er doch auf die sonst verpönte Herz-Metapher zurück und konstatiert unmissverständlich: »Ihr Herz war ohne Gedanken.«
Hat also das Herz in unserem Jahrhundert seine Bedeutung für die Literatur eingebüßt? Und hängt das etwa mit der Entwicklung der Medizin und ihrer technischen Hilfsmittel zusammen? Das Gegenteil trifft zu. Im »Zauberberg« wird Joachim Ziemßens Oberkörper durchleuchtet. Hans Castorp darf zuschauen: Seine »Aufmerksamkeit war in Anspruch genommen von etwas Sackartigem, ungestalt Tierischem, dunkel hinter dem Mittelstamme Sichtbarem, und zwar größtenteils zur Rechten, vom Beschauer aus gesehen – das sich gleichmäßig ausdehnte und wieder zusammenzog, ein wenig nach Art einer rudernden Qualle … Großer Gott, es war das Herz, Joachims ehrliebendes Herz, was Hans Castorp sah!«
Auch die modernen Lyriker sehen dank der Röntgenstrahlen das Herz anders als bisher. Einige Jahre nach dem »Zauberberg« publiziert Erich Kästner das Gedicht »Das Herz im Spiegel«. Hier wird weder verklärt noch poetisiert, hier herrscht vielmehr der kühle und nüchterne, doch keineswegs gefühllose Ton der Neuen Sachlichkeit. Ein Mann wird durchleuchtet, er erblickt auf dem Bildschirm ein »schattenhaftes Gewächs«: »Das war mein Herz! Es glich aufs Haar /einem zuckenden Tintenklecks.« Der Mann erlebt einen Schock: »Das war mein Herz, das dir gehört, /geliebte Hildegard!« Und das Fazit des Kästner-Gedichts:
Kind, das Vernünftigste wird sein,daß du mich rasch vergißt.Weil so ein Herz wie meines keinGeschenkartikel ist.
Die Röntgendurchleuchtungen und die Elektrokardiogramme, die Herzoperationen und die Herzverpflanzungen haben der Symbolik des Herzens nichts anhaben können, ja sie haben der Literatur neue Motive und Themen geliefert. Schon vor einem halben Jahrhundert hat der Romancier Ernst Weiß, der von Beruf Arzt war, in seiner Erzählung »Die Herznaht« meisterhaft eine Herzoperation geschildert.
Immer noch glauben die Menschen an die geheimen Kräfte des Herzens. Auch die Dichter unserer Zeit brauchen das Herzsymbol, das uralte Zeichen der Liebe. Die ominöse und sentimentale und eben doch nicht ersetzbare Vokabel taucht nach wie vor in den Titeln zahlloser Lyriksammlungen, Romane und Erzählungen auf. Von den vielen Beispielen, die man hier anführen könnte, sei nur eines genannt: Der erfolgreichste Gedichtband der letzten Jahre variiert im Titel die traditionsreiche Alternative. Ich meine Ulla Hahns Debüt »Herz über Kopf«. Nach 1945 zeigte sich auch, dass man mit dem Herzen sogar das politische Bekenntnis wirkungsvoll andeuten kann. »Links, wo das Herz ist«, der Titel der 1952 erschienenen Autobiographie von Leonhard Frank, wird bis heute gern und oft nachgeahmt.
Nein, es ist nicht schlecht um das Herz bestellt. Schlimm ist es erst dann, wenn man von ihm nicht mehr in Bildern und Metaphern spricht, wenn es nur noch auf seine mechanischen Bewegungen ankommt, auf seinen bloßen Rhythmus. »In solcher Stunde« – schrieb Alfred Polgar – »ist wenig Poesie mehr um das arme Ding, da wird furchtbar gleichgültig, wofür es schlägt, wenn es nur schlägt …« Ja, in solcher Stunde haben die Dichter zu schweigen. Das Wort haben dann nur noch die Mediziner.
Die verkehrte Krone oderJuden in der deutschen Literatur
Der Geschichte der Juden in der deutschen Literatur mangelt es nicht an Siegen, an wahren Triumphen. Ein Jude aus Düsseldorf ist der erfolgreichste deutsche Lyriker nach Goethe. Ein Jude aus Prag hat die moderne Literatur geprägt – die der Deutschen und die der ganzen Welt. Und unter den populärsten Erzählern des 19. wie des 20. Jahrhunderts gibt es nicht wenige Juden.
Doch allen Erfolgen zum Trotz ist dieses Kapitel der Literaturgeschichte so dunkel wie deprimierend: Wir haben es mit einer Leidensgeschichte ohnegleichen zu tun. Dabei geht es nicht um Fehlschläge und Niederlagen – sie gehören immer und überall zur Biographie derer, die öffentlich wirken. Ich meine vielmehr die fortwährenden Erniedrigungen, die grausamen Demütigungen, die keinem deutschen Juden, welchen Beruf er auch ausübte, erspart geblieben sind; nur empfindet sie ein Schriftsteller stets doppelt und dreifach.
Am Anfang dieser jüdischen Passionsgeschichte sehen wir zwei in jeder Hinsicht ungewöhnliche Menschen, einen Mann und eine Frau. Er sehr klein und verwachsen, ja bucklig, sie ebenfalls klein und nicht gerade schön. Beide standen im Mittelpunkt des geistigen Lebens von Berlin und von Preußen, beide sind Jahrhundertfiguren der deutschen Kultur geworden und geblieben. Beide verkörpern wie niemand vor ihnen und wie kaum jemand nach ihnen den Glanz und zugleich das Elend des jüdischen Daseins in Deutschland.
Im Oktober 1743 meldete sich am Rosenthaler Tor der Stadt Berlin ein vierzehnjähriger Knabe, der Sohn des Dessauer Synagogendieners und Thoraschreibers. Aus seiner Geburtsstadt Dessau zu Fuß gekommen, bat er um Einlass nach Berlin, der ihm auch bewilligt wurde. So findet sich im Journal für diesen Oktobertag 1743 die knappe Eintragung: »Heute passierten das Rosenthaler Tor sechs Ochsen, sieben Schweine, ein Jude.«
Warum hat ihn der Wachtposten damals nicht abgewiesen? Vielleicht deshalb, weil ihn der ärmliche und jugendliche Neuankömmling mit einer denkwürdigen Antwort verblüffte. Denn befragt, was er in Berlin wolle, sagte der Knabe, jedenfalls der Legende zufolge, nur ein einziges Wort: »Lernen«. Er hat dann in Berlin in kurzer Zeit tatsächlich viel gelernt und sehr bald andere gelehrt.
Die Zeitgenossen haben ihn, Moses Mendelssohn, als Autorität höchsten Ranges anerkannt: Er wurde einer der bedeutendsten Denker jener Epoche, in der Kant und Lessing wirkten. Und er wurde es, ohne je, wie er mit leisem Stolz betonte, auf einer Universität gewesen zu sein oder ein Collegium gehört zu haben. Erstaunlich ist es also nicht, dass der Autodidakt gerne Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften geworden wäre. Das wäre ihm auch beinahe geglückt, nur erhob der König, Friedrich II., Einspruch.
Wichtiger noch: Mendelssohn hoffte, er könne ein gleichberechtigter Bürger des preußischen Staates werden. Aber er schätzte die Situation allzu optimistisch ein: So überwältigend seine wissenschaftlichen Leistungen auch waren – der jüdische Philosoph wurde nach wie vor als wunderlicher Fremdling empfunden, als sonderbares Wesen angestaunt. Von Gleichberechtigung konnte keine Rede sein: Man hat ihn gerühmt und zugleich geschmäht, gepriesen und gequält.
Auch die andere kleine Person, die das Kapitel der Juden in der Geschichte der deutschen Literatur eröffnet, Rahel Levin, die spätere Rahel Varnhagen, kam, wie Mendelssohn, aus der Judengasse und aus einer orthodoxen Familie, auch sie sprach in ihrer Jugend das noch im 18. Jahrhundert gebräuchliche Judendeutsch, das mit hebräischen Lettern geschrieben wurde. Sie indes war doppelt benachteiligt, doppelt geschlagen – als Frau und als Jüdin.
Mit den Grenzen, die dem weiblichen Dasein gesteckt waren, wollte sie sich auf keinen Fall abfinden. Und mit dem Judentum? Mit aller Kraft, über die sie verfügte, hat sie sich gegen ihre Abstammung empört und aufgelehnt: Diese Rebellion bildet, auch wenn Rahel es nicht selten für richtig hielt, sich mit Winken und mit Andeutungen zu begnügen, das zentrale Thema, das Leitmotiv ihrer Schriften.
Sie war eine selbstbewusste, eine hochintelligente und überaus geistreiche Frau. Aber eine Schriftstellerin war sie nicht, sie wollte es auch nie sein. Sie hat Tagebuchaufzeichnungen hinterlassen und Hunderte, Tausende von Briefen. Es sind kulturgeschichtliche Dokumente von großem Wert. Doch beweisen sie, dass Rahels Deutsch auch noch in ihren späten Tagen nicht makellos war und dass ihr enormer Ehrgeiz, vielleicht eben deshalb, nicht auf geistige und literarische Leistungen gerichtet war, sondern vor allem auf gesellschaftliche Erfolge. Denn sie wollte ihre Herkunft um jeden Preis abstreifen – wie man ein überflüssiges Kleidungsstück wegwirft. In einem Brief spricht sie von dem »sich fort und neu entwickelnden Unglück« ihrer »falschen Geburt«, aus dem sie sich »nicht hervorzuwälzen vermag«.
1795 gibt sie einem jungen Juden, David Veit, einen Ratschlag: »Kenntnisse sind die einzige Macht, die man sich verschaffen kann, wenn man sie nicht hat, Macht ist Kraft, und Kraft ist alles.« An nichts anderes denkt sie als an eine Möglichkeit, die »falsche Geburt« zu überwinden und sich von dem uralten Fluch zu befreien. Sie ist es satt, unentwegt gekränkt und beleidigt zu werden. Die Gleichberechtigung will sie – wie Moses Mendelssohn. Was sie David Veit empfohlen hat, das soll auch sie selber retten: Sie brennt darauf, sich Kenntnisse zu erwerben, sich Wissen anzueignen. Nur so lasse sich – davon ist sie überzeugt – die zwischen den Juden und den Nichtjuden bestehende Kluft zumindest verringern.
Mit ihrem Salon in der guten Stube protestierte sie gegen die überlieferten Schranken. Denn dort, in der Jägerstraße, trafen sich Männer und Frauen, adlige Offiziere und bürgerliche Intellektuelle, Philosophen und Schauspieler und schließlich und vor allem: Christen und Juden. Oft nennt man die Namen jener, die in diesem Salon verkehrten – es sind die besten der Epoche: von Jean Paul und Friedrich Schlegel bis zu Chamisso und Brentano. Und in ihrer Mitte die umsichtige, die imponierende Gastgeberin.
Die Berühmtheiten – sie folgten den Einladungen offenbar immer und sehr gern. Doch ist nicht bekannt, dass einer von ihnen je Rahel Levin zu sich eingeladen hätte. Diese oft attraktiv geschilderten Berliner Salons – es waren in der Tat wichtige Zentren des geistigen Lebens. Aber nicht von der Gleichberechtigung der Juden zeugten sie, sondern bloß von ihrem dringenden Wunsch, mit gebildeten Nichtjuden zusammenzukommen und von ihnen tatsächlich anerkannt zu werden.
Für die christlichen Freunde war Rahel letztlich eine Ausnahmejüdin, vielleicht eine nichtjüdische Jüdin, auf jeden Fall eine Fremde. Dass sie als emanzipierte Mitbürgerin leben wollte, konnte man schon begreifen. Absonderlich blieb es dennoch: Ähnlich wie Moses Mendelssohn wurde auch sie natürlich nicht geliebt, wohl aber angestaunt; ähnlich wie ihn empfand man auch sie als ein reizvolles, ein durchaus originelles, jedoch exotisches Wesen.
Einige Jahre lang war die ehrgeizige Rahel eine zentrale und gefeierte, eine kleine und doch beinahe majestätische Figur, eine orientalische Königin mitten im preußischen Berlin. Ja, eine Herrscherin war sie, aufrichtig bewundert, aber insgeheim spöttisch belächelt, bestenfalls bemitleidet. Als sie älter geworden und ihr Ruhm längst verblasst war, bildete sie sich ein, sie würde immer noch jung aussehen, ihre weiße Haartracht täusche nur die Menschen, sie schien ihr bloß eine »verkehrte Krone auf meinem Schicksal«. Aber auch zu Zeiten, als der Erfolg sie berauschte, war ihre Situation schon paradox. Der unsichtbare Kopfschmuck, den sie stolz trug, glich einer falschen, eben einer »verkehrten Krone«. Alle waren sich dessen bewusst – ihre Gäste und Freunde, ihre Neider und Nebenbuhler und letztlich auch sie selber.
So blieb ihre Suche nach einer Heimat vergeblich, das »natürlichste Dasein«, dessen sich, wie sie notierte, jede Bäuerin, ja jede Bettlerin erfreuen könne, war ihr versagt. Sie müsse »sich immer erst legitimieren«, gerade deshalb sei es »so widerwärtig, eine Jüdin zu sein«. Wiederholt erklärte sie in ihren Briefen, zumal in jenen an die Geschwister, man könne als Jude überhaupt nicht existieren. Nur zwei Möglichkeiten gebe es: die Taufe und die Ehe mit einem Nichtjuden. 1814 tritt sie zum Christentum über und heiratet Karl August Varnhagen von Ense.
Doch neunzehn Jahre später, wenige Tage vor ihrem Tod, diktiert sie ihrem Mann: »Was so lange Zeit meines Lebens mir die größte Schmach, das herbste Leid und Unglück war, eine Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möcht’ ich das jetzt missen.« War das Einsicht oder Resignation oder vielleicht Trotz? Sicher ist: Wenn wir uns heute, obwohl ihre Schriften fast nur noch von Fachgelehrten gelesen werden, mit Rahel Varnhagen beschäftigen, wenn uns ihre Persönlichkeit immer noch fasziniert, und dies in höherem Maße als ihr Werk, so vor allem deshalb, weil ihr Leben mehr als aufschlussreich, weil es exemplarisch ist. Aber es fragt sich: exemplarisch wofür? Ich meine: Für die Wege und Irrwege der Juden in der deutschen Literatur im 19. und letztlich auch im 20. Jahrhundert.
Beinahe jeder dieser Schriftsteller musste früher oder später durchmachen, was Rahel erfahren und erlitten hatte. Beinahe jeder wusste, dass er sich immer erst zu legitimieren hatte. Beinahe jeder lebte im Zeichen jener schrecklichen Angst, die sich zeitweise verdrängen, doch nie ganz abschütteln ließ – der Angst vor dem Judenhass, genauer: der Angst vor Deutschland, vor den Deutschen. Die meisten Schriftsteller sahen nur einen einzigen Ausweg: Ähnlich wie Rahel Varnhagen wandten sie sich vom mosaischen Glauben ab, um sich einer der herrschenden Religionen anzuschließen. Indes: Was sie sich davon versprachen, ging so gut wie nie in Erfüllung.
Heine sah schon als Student, dass ihm »Torheit und Arglist ein Vaterland verweigern«. Aber er dachte nicht daran zu kapitulieren. Verurteilt zur Heimatlosigkeit, versuchte er, sich zunächst dort einen Platz zu sichern, wo er glaubte, eine Ersatzheimat, eine Art Vaterland finden zu können: in der deutschen Sprache, in der deutschen Literatur.
Dieses Ziel vor Augen, debütierte er in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit Versen, die sofort eine ungewöhnliche Situation erzeugten. Plötzlich war ein Jude ein deutscher Dichter. Das hatte es bisher nicht gegeben. Zwar kannte man schon deutsch schreibende Juden, nur spielten sie keine Rolle. Oder es war ein Ludwig Börne aus Frankfurt, der aber Prosa publizierte, Kritiken und Reiseberichte. Das schien der Öffentlichkeit erträglicher als der unerwartete Einbruch eines Juden in die urdeutsche Domäne der holden Poesie. Erschwerend kam hinzu, dass sich Heine nicht ignorieren ließ: Seine Verse waren gut, so gut, dass sie ihn in kurzer Zeit berühmt machten. Das kam einer enormen, einer ungeheuerlichen Provokation gleich.
Gewiss, man war durchaus bereit, sich diese Gedichte anzueignen und sie auch ausgiebig zu loben. Aber man war nicht bereit, den Autor als Person, als Bürger, als Deutschen anzunehmen. Gesellschaftliche und berufliche Gründe waren es, die Heine 1825 veranlassten, zur evangelischen Kirche überzutreten. Dass man diese Selbstverteidigung, diesen Kampf ums Dasein, gelegentlich als Opportunismus bezeichnet hat, will mir nicht recht einleuchten. Jedenfalls hat, was Heines Isolation ein Ende bereiten sollte, sie erst recht vertieft. Er blieb, was er bisher gewesen war: ein Jude unter Christen. Nur war er jetzt auch noch ein Getaufter unter den Juden.
Nicht der Taufzettel veränderte sein Leben, sondern erst die Auswanderung. Er war in Deutschland ein gescheiterter Jurist, dem es nirgends gelingen wollte, eine Stellung zu finden. In Frankreich lebte er als ein Poet, der geschätzt wurde. In Deutschland war er ein unbequemer Zeitgenosse, der vielen auf die Nerven ging und der überall Anstoß erregte. In Frankreich hat er die Einheimischen nicht besonders gestört, hier konnte er ohne weiteres zwar nicht integriert, doch immerhin akzeptiert werden – allerdings als einer, der selbstverständlich nicht dazugehörte. In beiden Ländern war und blieb der Düsseldorfer Heine ein kurioser Einzelgänger, ein bunter Vogel, kurz: hier wie dort ein Fremder. Aber unter den Deutschen ein Jude, unter den Franzosen ein Deutscher, in Deutschland ein Ausgestoßener, in Frankreich ein Ausländer.
Das zentrale Problem Heines war – in Deutschland ebenso wie in Frankreich – das Judentum, doch nicht etwa die mosaische Religion und nicht die jüdische Tradition. Freilich ist Heines Thema, zumal in dem internationalen Bestseller »Buch der Lieder«, meist zwischen und hinter seinen Versen verborgen. Er spricht in der Lyrik von den Leiden des deutschen Juden kurz nach der von den Behörden verordneten, aber von der Bevölkerung nicht gewollten, bestenfalls geduldeten Emanzipation, von den Leiden somit eines Menschen, der, hineingeboren in die deutsche Welt, integriert werden möchte. Der Schmerz dessen, den man nicht zulässt, der allein und einsam bleibt – das ist Heines Leitmotiv. Die aussichtslose Liebe, die er in seinen Liedern und Gedichten besingt, symbolisiert die Situation des Verstoßenen und Ausgeschlossenen.
Nicht die Heimatlosigkeit steht im Mittelpunkt dieser Dichtung, vielmehr die Nichtanerkennung, die Nichtzugehörigkeit des zwar ganz und gar assimilierten, aber in Wirklichkeit eben nicht emanzipierten Juden. So ist Heines Werk durch die spezifische Situation geprägt, in der er sich inmitten der christlichen Gesellschaft befunden hat. Dies jedoch gilt für nahezu alle Juden in der deutschen Literatur: Es sind nicht etwa stilistische oder formale Merkmale, die das Werk dieser Schriftsteller kennzeichnen, vielmehr sind es die Themen und die Motive, die sich aus ihren Erfahrungen und Leiden, aus ihren Komplexen und Ressentiments als Juden in der deutschen Welt ergeben.
Ob das Jüdische im Vordergrund ihres Lebens stand oder ob sie es zu verdrängen und zu ignorieren versuchten, ob sie sich dessen ganz oder nur teilweise bewusst waren – ihnen allen hat ihre Identität qualvolle Schwierigkeiten bereitet, keiner ist mit dieser Frage zu Rande gekommen. Der aus einem schwäbischen Dorf stammende Romancier und Geschichtenerzähler Berthold Auerbach glaubte, das Problem gelöst zu haben: Er sei, erklärte er 1847, ein Deutscher, ein Schwabe und ein Jude zugleich, nichts anderes könne und wolle er sein.