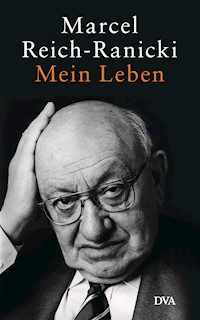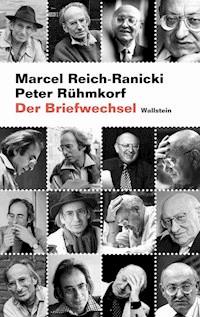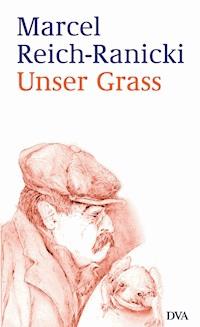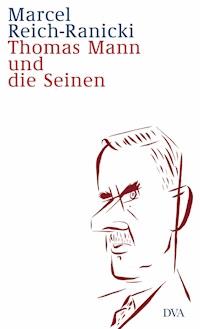
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Marcel Reich-Ranicki gehörte zu den besten Kennern der an herausragenden Begabungen und Persönlichkeiten reichen Familie Mann. "Thomas Mann und die Seinen" vereint Aufsätze und Beiträge aus fünf Jahrzehnten. In seinen essayistischen Porträts schildert Marcel Reich-Ranicki in gewohnt lebendiger Weise die Gegensätze und Abhängigkeiten, die Kämpfe und den Zusammenhalt innerhalb der Familie sowie ihr literarisches Schaffen.
„Ich weiß, daß er, Thomas Mann, mich beeindruckt und beeinflußt, vielleicht sogar geprägt hat wie kein anderer deutscher Schriftsteller unseres Jahrhunderts. Ich weiß, daß es seit Heine keinen Schriftsteller gegeben hat, dem ich in so hohem Maße und auf so tiefe Weise verbunden bin.“ MRR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Marcel Reich-Ranicki
Thomas Mann
und die Seinen
Deutsche Verlags-Anstalt
»Thomas Mann und die Seinen« erschien erstmals 1987. Die aktuelle Ausgabe wurde um acht Aufsätze erweitert. »Die Liebe ist nie unnatürlich«, »Wir verlorenen Kinder Deutschlands«, »Seine letzte Liebe«, »O sink hernieder, Nacht der Liebe«, »Bin ich am Ende?« und »Glück und Unglück der Alleinreisenden« wurden aus »Sieben Wegbereiter«, veröffentlicht im Jahr 2002, übernommen, eine überarbeitete Fassung von »Der Epiker als Kritiker« und »Der noble Enthusiast« aus »Die Anwälte der Literatur«, veröffentlicht 1994, und »Die Familie des Zauberers« wurde aus dem 1999 veröffentlichten »Mein Leben« übernommen.
© 2005 Deutsche Verlags-Anstalt, München
Alle Rechte vorbehalten
epub-Herstellung: Boer Verlagsservice, Grafrath
ISBN 978-3-641-13574-4
Für T. R.-R.
Was nicht originell ist, daran ist nichts gelegen, und was originell ist, trägt immer die Gebrechen des Individuums an sich.
Goethe
Thomas Mann
Die Geschäfte des Großschriftstellers
Ist es schon so weit, gibt es die von manchen seit Jahren gewünschte Thomas-Mann-Renaissance? Allerlei Zeichen, die darauf hinzudeuten scheinen – von Viscontis »Tod in Venedig«-Verfilmung bis zu Benjamin Brittens neuer Oper –, kommen freilich aus dem Ausland. Aber es wäre nicht das erste Mal, daß hierzulande das erneute Interesse für einen großen deutschen Schriftsteller oder gar seine Wiederentdeckung durch Impulse ausgelöst wird, die von Paris oder Rom, London oder New York ausgehen. So war es ja, um gleich das bekannteste Beispiel anzuführen, in den fünfziger Jahren mit Kafka, so in den Sechzigern, also in einer anderen literarischen Situation, mit Hermann Hesse.
Dabei sind die Ursachen der eher außerhalb des deutschen Sprachraums bemerkbaren Hinwendung zum Werk Thomas Manns schwer auszumachen: Sie mögen zu einem Teil mit jenem zwielichtigen Phänomen zusammenhängen, das sich nicht ganz ernst nehmen und gleichwohl nicht ignorieren läßt und das man mit dem Schlagwort »Nostalgiewelle« zu bezeichnen pflegt. Was sich dahinter verbirgt, ist vermutlich nichts anderes als, kurz gesagt, die Sehnsucht nach einer im Gegensatz zum Heutigen stehenden Welt, nach dem verlorenen Paradies, das allerdings nie ein Paradies war. Ein vollkommenes, in sich geschlossenes episches Universum, das, mit größter Liebe gezeichnet und mit schärfstem Kritizismus beglaubigt, als eine derartige Kontrastwelt aufgefaßt werden kann, haben wohl nur zwei Romanciers unseres Jahrhunderts zu bieten: Marcel Proust und eben er, Thomas Mann.
Indes kommt es weniger auf die Umstände an, die diesen Rezeptionsprozeß ausgelöst haben, als vor allem auf die Resultate, zu denen er führen kann und führen sollte. Mit anderen Worten: Es ist nicht sehr wichtig, warum Thomas Mann neuerdings wieder Mode wird – auch Zufälle können hier im Spiel sein –, wenn sich daraus nur eine intensivere Beschäftigung mit seinem Werk ergibt und dies zur Revision mancher Urteile und Vorurteile beiträgt.
Von dem Schriftsteller Gustav Aschenbach im »Tod in Venedig« (1912) heißt es, er habe »gelernt, von seinem Schreibtisch aus zu repräsentieren, seinen Ruhm zu verwalten, in einem Briefsatz, der kurz sein mußte (denn viele Ansprüche dringen auf den Erfolgreichen, den Vertrauenswürdigen ein), gütig und bedeutend zu sein«. Wenige Jahre später, 1916, schreibt Thomas Mann an Ernst Bertram, daß er das Verhängnis Deutschlands »längst in meinem Bruder und mir symbolisiert und personifiziert sehe«.1 Was sich damals schon unmißverständlich ankündigte, kam in der Zeit der Weimarer Republik – es ließe sich mit vielen Zitaten belegen – vollends zum Vorschein: Thomas Mann war überzeugt, den deutschen Geist im umfassendsten Sinne zu personifizieren und zusammen mit seinem eigenen Ruhm auch jenen der Nation zu verwalten.
Dieses Bewußtsein der von ihm konsequent angestrebten, bisweilen gewiß als Last empfundenen, doch viel häufiger als grandiose Auszeichnung und stolze Lebensaufgabe verstandenen Repräsentanz hat einen großen Teil seiner bisher publizierten Briefe aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und erst recht nach 1933 geprägt. Ja, sogar in seiner Korrespondenz mit den nächsten Angehörigen, etwa mit dem Bruder Heinrich oder mit der Tochter Erika, scheint er die nationale und epochale Rolle, die er so virtuos zu spielen wußte, nie ganz vergessen zu können.
So fühlte sich Thomas Mann, wie er es seinem Geschöpf Gustav Aschenbach mit leiser Ironie nachgesagt hatte, verpflichtet, womöglich immer »gütig und bedeutend zu sein«. Es liegt nahe, sich darüber lustig zu machen. Aber ihm dies verübeln hieße bedauern, daß er Hunderte, wenn nicht vielleicht Tausende von Briefen verfaßt hat, die zum Besten gehören, was in deutscher Sprache, jedenfalls in unserem Jahrhundert, geschrieben wurde.
Doch hatte diese Korrespondenz gleichzeitig zur Folge, was sich wohl gar nicht verhindern ließ: Indem sie stets aufs neue den Klassiker und den Olympier, den genialen Zeitgenossen und den bürgerlichen Dichterfürsten, den souveränen Repräsentanten der deutschen Nation und der europäischen Kultur ins Blickfeld rückte, suggerierte sie der Leserschaft ein überaus feierliches, ein würdevollmächtiges Thomas-Mann-Bild, dessen Umrisse, befürchte ich, längst erstarrt sind. Während man aus Kafka ein Mysterium gemacht hat, wurde aus Thomas Mann ein Monument. Während jenen die Dunkelheit gefährdet, bedroht diesen das Museale – und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das dringlichste Gebot scheint daher in dem einen Fall die Entmystifizierung und in dem anderen die Entmonumentalisierung. Hierbei kann ein Buch behilflich sein, das gerade im rechten Augenblick erschienen ist: Thomas Manns Briefwechsel mit seinem Verleger Bermann Fischer.2
Der erste Eindruck mag etwas enttäuschend sein: Mit den Briefen Thomas Manns an Bertram oder an Heinrich Mann oder gar mit jenen, die zwischen 1961 und 1965 von Erika Mann in drei umfangreichen Bänden herausgegeben wurden, läßt sich dieses Buch kaum vergleichen. Gewiß, das vollendete stilistische Raffinement, das die früher veröffentlichte Korrespondenz in geradezu verschwenderischer Fülle offerierte, ist auch hier bemerkbar, aber doch nur gelegentlich. An Äußerungen und Reflexionen über literarische, zeitgeschichtliche und sonstige allgemeinere Fragen mangelt es nicht, nur sind sie auffallend knapp und wiederholen oft, was man schon in den Schriften Thomas Manns und auch in seinen Briefen an andere Adressaten ausführlicher und genauer gelesen hatte.
Wer Meisterwerke der Epistolographie erwartet, wird nicht auf seine Rechnung kommen. Geniales läßt sich in dieser Sammlung nicht finden – und ebendeshalb ist sie, mag es auch paradox klingen, so aufschlußreich, so wertvoll. Denn im Unterschied zu sehr vielen Briefen Thomas Manns sind die hier gedruckten weder für die Mitwelt noch für die Nachwelt bestimmt, sondern tatsächlich nur für den Verleger Bermann Fischer. Es handelt sich um gewöhnliche Geschäftsbriefe, und sie bleiben es offensichtlich auch dann, wenn Mann (meist rasch und doch nur am Rande) Persönliches einbezieht oder beschreibt. Immer will er etwas Konkretes erledigen, auch die Verweise auf Privates sollen in der Regel nur die beruflichen Vorschläge oder Wünsche unterstützen.
Da also sachliche Mitteilungen und Fragen, nachdrückliche Beanstandungen und trockene Darlegungen dominieren, da Wiederholungen sich in einer derartigen Korrespondenz von selbst verstehen und überdies vieles besprochen wird, was uns heute beim besten Willen nicht interessieren kann, erfordert die Lektüre mancher Teile des Briefwechsels einige Geduld. Aber er dokumentiert gerade die Aspekte des Porträts und der Biographie Thomas Manns, die bisher zu kurz gekommen waren: Der Alltag des professionellen Schriftstellers wird sichtbar. Dank dieser, zugegeben, überaus profanen Dimension verliert das Bild des literarischen Würdenträgers viel von seiner Klassizität, von seinem Pathos, und es gewinnt zugleich an Wahrhaftigkeit und Anschaulichkeit, an barer Menschlichkeit: Die Einschüchterung läßt nach, die Annäherung wird möglich.
So zeigen die Briefe, daß derjenige, der von Robert Musil ein »Großschriftsteller« genannt wurde, zugleich eine Art Großkaufmann war, der seine mitunter komplizierten geschäftlichen Angelegenheiten nüchtern und umsichtig zu überwachen wußte: Streitbar pochte er auf sein Recht, hartnäckig überprüfte er die Abrechnungen, stets nach Fehlern und Irrtümern ausspähend. Auch die geringsten Unklarheiten riefen sein nicht immer unbegründetes Mißtrauen hervor.
Befürchtete etwa Thomas Mann, daß der Schwiegersohn und Nachfolger Samuel Fischers, der seit 1928 als Geschäftsführer des berühmten Verlages tätige Gottfried Bermann Fischer, ihn, den in den Jahren der Emigration (und natürlich auch später) prominentesten Autor des Hauses, schlechterdings übervorteilen wollte? Aber sicher. In einem 1954 an Bermann Fischer gerichteten Brief sagte er ohne Umschweife, daß er »die psychologische Mischung von wahrer Anhänglichkeit und der Neigung, mich übers Ohr zu hauen, bei einem Geschäftsmann jetzt wohl für möglich halte«. Damit aber hatte der Neunundsiebzigjährige nur ausgesprochen, was seiner Korrespondenz oft genug zu entnehmen war: »Von Geld ist allzu wenig zwischen uns die Rede …« – warnte er seinen Verleger 1938. Und: »Ich kann nur wiederholen, was ich schon in meinen Briefen aus Californien andeutete: daß es schön wäre, wenn Sie auch an meine geschäftlichen Interessen etwas dächten und auf diese Dinge von sich aus zu sprechen kämen, statt mir die Rolle des Fordernden und Drängenden zu überlassen.«
Unwillig und verärgert äußerte er sich 1946 »über die Unbegreiflichkeiten, die alles Vertrauen erschütternde Unordnung und Unstimmigkeit in unseren geschäftlichen Beziehungen«. Er habe »sich in guten, unbedingt zuverlässigen Händen« geglaubt und sehe nun, »daß dies nicht der Fall ist«. Als ihm die Herabsetzung des Honorars für eine Auslandsausgabe »eine einseitige Maßnahme Ihrerseits« schien, fragte er ganz ungeniert: »Haben Sie einen Zustimmungsbrief von mir bei Ihren Akten? Dann möchte ich ihn sehen, denn ich bin einfach mißtrauisch geworden gegen die geschäftliche Behandlung, die Sie mir angedeihen lassen.«
Mit zunehmendem Alter wurde Thomas Mann in seinen finanziellen Angelegenheiten weder nachlässiger noch nachsichtiger. 1950 teilte er Bermann Fischer sehr direkt mit, daß er ihm nicht mehr über den Weg traue: »Ich hatte noch keine Möglichkeit festzustellen, ob Ihre Angabe auf Wahrheit beruht, daß diese schweizerischen Lizenzausgaben den Transfer meiner deutschen Honorare gefährden würden.«
Die Ausführlichkeit vieler dieser Briefe macht zumindest wahrscheinlich, daß ihm die Kontrolle der Abrechnungen und die Erledigung anderer geschäftlicher Fragen auch Spaß bereitete und daß es ihm oft eine wahre Genugtuung war, dem Verlag Unregelmäßigkeiten und Fehler nachzuweisen. Freilich gab es überdies einen anderen Grund, der ihn offenbar zwang, sich darum zu kümmern: »In einem langen, arbeitsreichen und ja auch erfolgreichen Leben« – klagte er 1953 – »ist es mir kaum gelungen, finanzielle Reserven für mich und die Meinen anzulegen …«
Noch in seinem letzten Lebensjahr schrieb und diktierte Thomas Mann lange Briefe mit allerlei Vorwürfen und Beanstandungen, die sich nicht immer als berechtigt erwiesen. Im August 1954 beispielsweise mußte er zurückstecken: »Man ist heutzutage, bei diesem gequälten Leben zwischen den Stühlen, manchmal nicht recht Herr seiner Nerven.« Und: »Tragen Sie mir ein überschärftes Wort nicht nach! Meine polemische Ader spielt mir manchmal einen Streich.« Damit eben hängt zu einem nicht geringen Teil die Attraktivität der Korrespondenz mit Bermann Fischer zusammen: Weil Thomas Mann angesichts des Geschäftlichen seine Fassung nicht unbedingt bewahren wollte, weil ihm, dessen Selbstdisziplin schon fast unheimlich war, hier seine polemische Ader zuweilen einen Streich spielen durfte, läßt sich diesen Briefen nachrühmen, was bei ihm Seltenheitswert hat: Spontaneität.
Freilich mag die Gereiztheit, die sich im Verhältnis Thomas Manns zu seinem Verleger doch oft und heftig bemerkbar machte, besondere Gründe haben. Bermann Fischer war es ja, der im Juli 1933 den damals in der Schweiz lebenden Thomas Mann zur Rückkehr nach Deutschland aufgefordert hatte: »Da nichts gegen Sie vorliegt, … setzten Sie die Regierung gewissermaßen erst ins Recht, wenn Sie fernbleiben. Denn Sie bieten ihr durch Ihr Fernbleiben die Handhabe zu Maßnahmen gegen Sie, da man hier daraus schließen wird, daß Sie sich endgültig gegen Deutschland entschieden haben … Aus der Emigrantenatmosphäre lassen sich die Dinge nicht richtig beurteilen … Wir stehen Ihnen ganz zur Verfügung, würden Sie gern an der Grenze erwarten … Überlegen Sie nicht lange. Man steht allen diesen Dingen hier viel ruhiger gegenüber, als man es je im Ausland kann.«
Zwar wies Thomas Mann diese Aufforderung entrüstet zurück, doch zeigte er sich in einer anderen Angelegenheit weniger entschieden. Im August 1933 hielt er es für richtig, den ersten Band seiner »Joseph«-Tetralogie nicht in Deutschland zu veröffentlichen, sondern »draußen«, in Amsterdam, »wo er zwar nur auf eine beschränkte Publizität, dafür aber auf Wohlwollen, freie Empfänglichkeit rechnen kann … Mit einem Wort: überlassen Sie das Buch Querido …« Bermann Fischer wollte davon nichts wissen und warnte vor einem »endgültigen Schritt, der Ihnen nicht verziehen wird … Denken Sie doch an Ihre deutschen Leser hier«. Thomas Mann gab nach, das Buch erschien in Berlin, und wenige Wochen später distanzierte er sich (abermals einem dringenden Wunsch seines Verlegers folgend) von der in Amsterdam von seinem Sohn Klaus herausgegebenen antifaschistischen Zeitschrift »Die Sammlung«. Seine Position dem »Dritten Reich« gegenüber geriet vorübergehend in ein fatales Zwielicht. Es scheint, als habe er das Bermann Fischer nie ganz verziehen.
Sicher ist, daß erst vor diesem Hintergrund zwei Briefe Thomas Manns vom April 1938 verständlich werden. Von Beverly Hills aus fragte er den unmittelbar nach dem Anschluß aus Österreich geflohenen Bermann Fischer, ob er etwa beabsichtige, seine verlegerische Tätigkeit in den USA fortzusetzen, denn: »Ihre durch alle diese Jahre verfolgte Politik, Ihr bis zum erzwungenen Bruch aufrechterhaltenes Verhältnis zu Deutschland und selbst noch der Charakter Ihres Wiener Unternehmens, das ja immer noch auf den deutschen Markt abgestellt war, (hat) Ihnen hier auf sehr negative Weise den Boden bereitet.« Bermann Fischer habe das moralische Recht verscherzt, »jetzt, wo es gar nicht mehr anders geht, den deutschen Emigrationsverlag in Amerika aufzutun«. Er möge sich doch seinem ursprünglichen Beruf zuwenden, also wieder als Arzt praktizieren, er jedenfalls, Thomas Mann, müsse sich von ihm trennen.
Da Bermann Fischer zwischen 1933 und 1938 den S. Fischer Verlag in Berlin und Wien mit Thomas Manns Billigung (und zum Teil in seinem Interesse) geführt hatte, zeigen solche Briefe den würdigsten Repräsentanten der deutschen Literatur unseres Jahrhunderts nicht gerade – um es gelinde auszudrücken – von der schönsten Seite. Aber es ist gut, daß auch sie deutlich sichtbar wird. Im übrigen änderte sich nichts: Bermann Fischer blieb Verleger (jetzt in Stockholm) und Thomas Mann sein Autor. Nur bekam Bermann Fischer gelegentlich zu hören, daß er den falschen Beruf ausübe, so noch 1950: »Sie kämpfen allein auf einem Posten, für den Sie nicht geboren sind, der Ihnen vom Schicksal nie zugedacht schien und der mir oft schon ganz verloren vorkommt.«
Warum hatte Thomas Mann, trotz aller Unzufriedenheit und trotz vieler Versuchungen, Bermann Fischer und seinen Verlag doch nie verlassen? Anhänglichkeit? Treue? Tradition? Oder gar Sentimentalität? Es gab, will mir scheinen, einen anderen und einfacheren Grund: Er mochte schimpfen und nörgeln, protestieren und rebellieren, er mochte Bermann Fischer Dilettantismus und Schlimmeres vorwerfen, aber letztlich scheint er überzeugt gewesen zu sein, daß sein Werk bei ihm und in seinem Verlag gar nicht schlecht aufgehoben war.
Daß sich Bermann Fischer um seinen Autor unaufhörlich bemühte, versteht sich von selbst. So spendete er ihm in vielen Briefen – oft die Hilfe der Verlegergattin in Anspruch nehmend –, wovon Thomas Mann nie genug bekommen konnte: Lob. »Wir alle tragen Wunden«, heißt es in der »Entstehung des Doktor Faustus«, »und Lob ist, wenn nicht heilender, so doch lindernder Balsam für sie.«
Von der »bestallten Kritik« hielt er nicht viel, dennoch erkundigte er sich bei Bermann Fischer häufig nach Rezensionen seines jeweils neuesten Buches. Er las sie aufmerksam, bisweilen, wie er ironisch vermerkte, »mit heißen Backen«, und wertete sie ernsthaft als Echo auf seine Produktion, obwohl er genau wußte, daß ihm der rücksichtsvolle Verleger »nur die gut gemeinten« zu zeigen pflegte, ja, er verlangte von Bermann Fischer, ihm bloß das zu schicken, »wovon Sie denken, daß es mir nicht auf die Magennerven geht«. Die Qualität einer Kritik entging ihm nicht, doch wichtiger war ihm der Tenor. Zu einer Rezension Eduard Korrodis in der »Neuen Zürcher Zeitung« meinte er: »Sie ist unglaublich schlecht geschrieben und zeugt auch von ungenauem Lesen, hat mir aber doch Freude gemacht durch ihre Beherztheit und Wärme …« Blieben Zeitungsausschnitte aus, so hielt sich Thomas Mann, in dieser Hinsicht den meisten Schriftstellern auf Erden auffallend ähnlich, an freundliche Zuschriften von unbekannten Lesern. Wenn nichts anderes da war, wurde dankbar registriert, daß jemand aus Afghanistan »sehr nett geschrieben« habe.
Eigenlob war Thomas Mann ebenfalls nicht unbekannt und galt sowohl entstehenden Arbeiten als auch früheren, die aus diesem oder jenem Grunde ins Gespräch kamen. Regungen des Selbstzweifels erlaubte er sich seinem Verleger gegenüber erst in den letzten Lebensjahren. Bei der Durchsicht seiner politischen Schriften, deren Neuausgabe 1950 geplant war, sei ihm »gar nicht wohl«, er bitte, »die Veröffentlichung zu unterlassen«, denn »manches darin ist veraltet, liest sich nicht mehr richtig …« 1952 teilte er Bermann Fischer mit: »Eigentlich gefällt mir nur wenig noch von den alten Dingen aus den drei verschollenen Bänden.« Es handelte sich um seine Bücher »Rede und Antwort«, »Bemühungen« und »Die Forderung des Tages«.
Am Vortag seines neunundsiebzigsten Geburtstags bekannte er, daß er der Veröffentlichung des »Felix Krull« nicht »besonders freudig entgegensehe«: »Und das Schlimmste ist, daß mir das Ganze jetzt im Licht des Unfughaften und Unwürdigen erscheint, wenig geeignet, eine öffentliche Stimmung der Ehrerbietung für das Leben des Achtzigjährigen vorzubereiten. Oft denke ich, es wäre mir besser gewesen, wenn ich nach dem ›Faustus‹ das Zeitliche gesegnet hätte. Das war doch ein Buch von Ernst und Gewalt und hätte ein Lebenswerk gerundet, dessen lose Nachspiele mir oft peinlich überflüssig erscheinen.«
Der strenge Ausspruch zeigt noch einmal, wie er gesehen werden wollte, er, der von sich selber glaubte sagen zu können, er sei »zum Repräsentieren geboren«. Aber sein wirkliches Bild ergibt sich nicht nur aus der Summe seines Werks, sondern auch aus jenen nüchternen Dokumenten, die etwas Licht auf sein alltägliches Leben werfen und die beweisen, daß es sogar ihm widerfahren konnte, aus der Rolle zu fallen. Nichts, was Thomas Mann geschrieben hat, darf uns gleichgültig sein.
(1973)
Das Genie und seine Helfer
Empfindlich war er wie eine Primadonna und eitel wie ein Tenor. Er war ichbezogen und selbstgefällig, kalt, rücksichtslos und bisweilen sogar grausam. Tausende haben ihn im Laufe seines Lebens mit Briefen belästigt. Keines dieser Schreiben blieb unbeantwortet. Gewiß, er hat vielen Menschen, zumal in der Zeit des Exils, geholfen. Aber hat er je einen Freund gehabt? Zu jenen Beziehungen, die man gemeinhin als Freundschaft bezeichnet, war er wohl fähig, indes kaum bereit. Hat er je eine Frau geliebt? Wohl nur Katia. Doch die Liebesbriefe, die er ihr schrieb, hat er sich bald zurückerbeten, um sie in einem Roman (»Königliche Hoheit«, 1909) zu verwenden.
Sein Tonio Kröger klagt, er sei oft sterbensmüde, das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben. Für ihn, Thomas Mann, war die Darstellung des Menschlichen stets ungleich wichtiger als die Teilnahme am Menschlichen. Zwischen beidem besteht ein kaum faßbares, ein in der Geschichte der Weltliteratur beispielloses Mißverhältnis. Um es überspitzt auszudrücken: Er hat fast nichts erlebt und fast alles beschrieben. Einem Minimum an tatsächlicher, an persönlicher Erfahrung wußte er ein Maximum an Literatur abzugewinnen. Und vielleicht war die Energie, die er ein Leben lang – und noch in den letzten Monaten – aufbrachte, um mit seinem Pfunde zu wuchern, seine eigentliche Genialität.
Man wird sagen: kein sympathischer, eher schon ein abstoßender Mensch. Mag sein. Aber das gilt auch für Goethe, Heine und Richard Wagner, für Rilke, Musil und Brecht. Sympathisch können nur diejenigen Genies sein, über die wir fast nichts wissen – Wolfram von Eschenbach etwa oder Shakespeare.
Je mehr wir von Thomas Mann zu lesen bekommen, desto schwieriger wird es, diesen Leistungsethiker, diesen gigantischen Enzyklopädisten zu lieben – und desto leichter, ihn zu bewundern, ja zu verehren. Seine Briefe an zwei Menschen, die ihm fremd und gleichgültig waren und die er dennoch gebraucht hat – an Otto Grautoff und Ida Boy-Ed –, bestätigen dies erneut.1
Im März 1895 schrieb der neunzehnjährige Thomas Mann, der damals schon in München lebte, an seinen ehemaligen, etwas jüngeren Schulkameraden Otto Grautoff, der eine Buchhandelslehre in Brandenburg an der Havel absolvierte: »Wirklich befreundet, wirklich intim bin ich doch nur mit einem gewesen, und das warst Du. Zufällig vielleicht. Aber es ist auch Wahlverwandtschaft im Spiele.« Davon stimmt kein Wort. Weder war der junge Thomas Mann mit Grautoff »wirklich befreundet« oder gar »intim«, noch konnte hier von Wahlverwandtschaft die Rede sein. Doch »zufällig« war diese Beziehung eben auch nicht, sie hatte schon einen guten Grund. Im selben Brief heißt es: »Gegen keinen kann ich mich so aussprechen, wie ich es gegen Dich konnte …«
Grautoff war häßlich und unbegabt und überdies noch der Sohn eines Bankrotteurs. Die vornehmeren Kameraden »lachten über ihn, fanden ihn unmöglich und ließen ihn in ihrer Gesellschaft nicht zu« – so Peter de Mendelssohn in seinem informativen Vorwort zu der sorgfältig edierten Briefsammlung. Auch Thomas Mann habe sich »des schäbigen und unansehnlich-tölpelhaften Freundes« geschämt. Aber dieser unglückliche, an starken Minderwertigkeitskomplexen leidende Junge war ihm unbedingt und uneingeschränkt ergeben.
Wenn er gerade zu ihm reden konnte, wieviel und worüber er wollte, so hatte dies mit jenem Umstand zu tun, den Thomas Mann in einem Brief vom Juli 1897 offen aussprach: »Ich habe stets als Deinen großen Vorzug geschätzt, daß Du zuhören kannst …« Dies ist das entwaffnend simple Geheimnis der immerhin nicht kurzfristigen Beziehung zwischen den beiden ungleichen Partnern, und zwar ebenso in den Lübecker Schuljahren wie auch später, als sich der Kontakt auf den Briefwechsel beschränkte. Mit anderen Worten: Grautoff war weder ein Pylades noch ein Horatio, er war nur ein von dem monologisierenden Helden benötigter Zuhörer, also ein Statist.
Nicht einmal die Vermutung, der Anfänger Thomas Mann habe Grautoffs Bewunderung oder Hörigkeit als eine Art Selbstbestätigung empfunden, wäre zutreffend. Gewiß, der junge Meister, der allerdings seine Meisterschaft noch zu beweisen hatte, wollte anerkannt werden und Einfluß ausüben, er wollte eine Autorität sein. Aber es konnte ihm nicht entgehen, daß dies alles hier allzuleicht zu haben war. Er hatte nicht den geringsten Respekt vor dem Intellekt Grautoffs und teilte dies dem fast Zwanzigjährigen nicht ohne Sadismus mit: »Du weißt nicht recht, was Metaphysik ist, und Du weißt nicht recht, was Christentum ist, aber Du gebrauchst diese Wörter mit Zuversicht … Jetzt kannst Du über dergleichen Dinge nicht mitreden.«
Doch eben damit hängt auch zusammen, was die Briefe an Grautoff so aufschlußreich macht. Der dem Bedürfnis, über sich selber zu sprechen, immer wieder nachgab, kannte kaum Hemmungen: Vor dem einstigen Schulkameraden, der die Rolle des subalternen Faktotums auf Distanz offenbar gern akzeptierte, genierte er sich nicht. »Wenn ich in die akademische Lesehalle komme, wo ich Mitglied bin«, berichtet der neunzehnjährige Thomas Mann, »stößt sich alles vor Ehrfurcht in die Seite. Dann bin ich so recht in meinem Element. Du weißt ja, wie kindisch eitel ich bin!« Auch noch Ende 1901, nach der Veröffentlichung der »Buddenbrooks«, spricht er offen von seiner Ruhmsucht: »Bisweilen kehrt sich mir vor Ehrgeiz der Magen um.«
Von ähnlicher Direktheit sind die Äußerungen des jungen Thomas Mann über sein (uns bisher kaum bekanntes) Sexualleben: »Ich habe mich in letzter Zeit nahezu zum Asketen entwickelt … Ich sage, trennen wir den Unterleib von der Liebe!« – heißt es 1895. Und Ende 1896 meditierte er in Neapel: »Woran leide ich? An der Geschlechtlichkeit … wird sie mich denn zu Grunde richten? (...) Wie komme ich von der Geschlechtlichkeit los?«
Zugleich zeigen diese Briefe, daß Thomas Mann von Anfang an ein virtuoser Organisator seines literarischen Erfolgs war. Ende 1901 wurde Grautoff, der jetzt in der Feuilletonredaktion der »Münchner Neusten Nachrichten« arbeitete, ohne Umschweife unterwiesen, was er in einer Rezension der »Buddenbrooks« zu schreiben habe. Nicht nur, was er loben sollte, erfuhr Grautoff, sondern auch, was er beanstanden durfte: »Tadle ein wenig … die Hoffnungslosigkeit und Melancholie des Ausganges. Eine gewisse nihilistische Neigung sei bei dem Verf. manchmal zu spüren.« Die etwas später erschienene Besprechung, die jetzt im Anhang des Briefbands zu lesen ist, zeigt, daß Grautoff sich, wie nicht anders zu erwarten war, darauf beschränkt hat, die knappen, doch sehr entschiedenen Wünsche und Empfehlungen Thomas Manns gehorsam zu übernehmen und ein wenig zu ergänzen. Einen Dankbrief des Autors der »Buddenbrooks« hat es offenbar nicht gegeben.
In der Tat war diese Rezension der Endpunkt der Beziehung mit Grautoff. Der Freund hatte seine Schuldigkeit getan und wurde nun nicht mehr gebraucht. An seine Stelle traten andere: wiederum Statisten und Zuhörer, Gesprächs- und Korrespondenzpartner, die imstande und bereit waren, ihr Scherflein zum Ruhme Thomas Manns beizutragen. Sie erfüllten die gleiche Funktion, wenn auch auf zunehmend höherer Ebene. Es scheint, daß er in seiner unmittelbaren Umgebung (die wenigen Ausnahmen fallen kaum ins Gewicht) nur Menschen geduldet hat, die ihm und seinem Werk nützlich sein konnten. Es wäre unaufrichtig, wollte man dies verschweigen, es wäre absurd, wollte man es Thomas Mann vorwerfen.
Zu den vielen Nachfolgern Grautoffs gehörte die Lübecker Schriftstellerin Ida Boy-Ed. Sie war, wie eine von Peter de Mendelssohn liebevoll herausgegebene Auswahl aus ihrem Werk erkennen läßt2, weder unintelligent noch unbegabt. Die Briefe Thomas Manns an diese (übrigens dreiundzwanzig Jahre ältere) Dame reichen von 1903 bis 1928 und sind mit jenen an Grautoff kaum vergleichbar: Jetzt schrieb nicht mehr ein flotter Anfänger auf der Suche nach seiner Identität, sondern ein bereits anerkannter Autor, der noch für die nebensächlichste Mitteilung einen würdevollen und gelegentlich schon gravitätischen Ausdruck wählte.
Eines der Leitmotive der Briefe ist der Dank für das jeweils neue Buch der Korrespondenzpartnerin. So 1904: »Die kleine Schöpfung erscheint mir als das Muster einer realistischen Novelle. Ich habe sie in einem Zug durchgelesen, beständig in Athem gehalten durch die außerordentliche Kraft der Darstellung und im Banne einer Wirklichkeitsillusion von seltener Stärke.« Im Jahre 1910: »... bitte, Ihnen meine respektvollsten Glückwünsche vorbringen zu dürfen zu dieser imposanten Leistung, die zum allerbesten und stärksten gehört, was ich von Ihnen kenne.« Und 1911: »Es ist rührend schön, dies Lebensbuch mit seiner zarten und tiefen Erkenntnis einer Frauenseele und der Frauenseele überhaupt. Es ist vielleicht ihr schönster Roman.«
War auch nur ein einziges Wort des Briefschreibers aufrichtig? Jedenfalls hat er Ida Boy-Ed immer wieder gebraucht: Sie begleitete Thomas Manns Werk mit meist enthusiastischen Kritiken, zu denen er sie mit schöner Regelmäßigkeit ermunterte. Als 1909 »Königliche Hoheit« erschien, belehrte er die Lübecker Autorin, Napoleon habe sich nach jeder Schlacht gefragt, was das Faubourg St. Germain dazu sagen werde: »Lübeck ist mein Faubourg St. Germain. Immer denke ich: Was wird Lübeck dazu sagen?« Die erwünschte Rezension kam bald, sie scheine, schrieb Thomas Mann, der offenbar beschlossen hatte, in den Briefen an Ida Boy-Ed stets Superlative zu verwenden, »zum Allerbesten, Glänzendsten, Wärmsten, Feinsten zu gehören, was ich von Ihnen kenne …«
Die »Betrachtungen eines Unpolitischen« lobte Ida Boy-Ed nachdrücklich, doch deren mittlerweile verwöhnter Autor war noch nicht ganz zufrieden. In diesem Falle sei ja Gelegenheit gewesen, ließ er sie wissen, »auf das, was an Heimatlich-Überliefertem, Ahnenmäßigem in mir lebt und aus mir wirkt … besonders hinzuweisen, etwa an der Hand des Kapitels ›Bürgerlichkeit‹«. Der Wink wurde verstanden, zwei Wochen später konnte Thomas Mann für einen »Nachtrag« zu der Rezension der »Betrachtungen« danken.
Doch wenn sich Frau Boy-Ed ausnahmsweise erlaubte, Zweifel an einem Buch Thomas Manns anzumelden, war auch die Höflichkeit des sonst so Dankbaren plötzlich verschwunden. Gerade mit dem »Zauberberg« zeigte sich die Lübeckerin nicht ganz einverstanden, was sie aber vorerst nur in einem Brief an den Autor mitteilte. Die mittlerweile Zweiundsiebzigjährige erhielt eine harte und schroffe Zurechtweisung: Er habe zu arbeiten und verfüge nicht über die Kraft, »daneben auch noch für Verwirrte und Erzürnte die Apologie meines Lebens und Thuns zu liefern«.
Sehr bezeichnend, daß in der Korrespondenz mit Ida Boy-Ed das Verhältnis zu Heinrich Mann eine wichtige Rolle spielt: »Das Bruderproblem« – erklärte Thomas Mann 1917 – »ist das eigentliche, jedenfalls das schwerste Problem meines Lebens. So große Nähe und so heftige innere Abstoßung ist qualvoll. Alles zugleich Verwandtschaft und Affront …« Es wäre übertrieben, wollte man sagen, daß diese Briefe auf den jetzt schon klassischen Bruderzwist der deutschen Literaturgeschichte ein neues Licht werfen. Aber sie lassen deutlicher als bisher einen Aspekt wahrnehmen, von dem die Forschung vielleicht deshalb nicht viel wissen wollte, weil er allzu platt und allzu prosaisch anmutet. Denn neben weltanschaulichen, politischen und psychologischen Motiven hatte der langjährige Streit einen professionellen Hintergrund, der nebensächlich sein mochte, doch nicht ganz übersehen werden darf: Es war auch der Konkurrenzkampf zweier ehrgeiziger Schriftsteller um den größeren Erfolg.
Gerade in den Briefen an die in der Geburtsstadt beider Brüder wirkende Autorin ist das Element simpler Nebenbuhlerschaft unverkennbar. So plädiert Thomas Mann 1904: »Haben Sie geglaubt, daß ich ein Verhältnis zu seinen Sachen habe? … Dennoch ist die Empfindung, die seine künstlerische Persönlichkeit mir erweckt, von Geringschätzung am weitesten entfernt. Sie ist eher Haß. Seine Bücher sind schlecht, aber sie sind es in so außerordentlicher Weise, daß sie zu leidenschaftlichem Widerstande herausfordern. Ich rede nicht von der langweiligen Schamlosigkeit seiner Erotik, von der geistlosen und unseelischen Betastungssucht seiner Sinnlichkeit. Was mich empört, ist die ästhetisierende Grabeskälte, die mir aus seinen Büchern entgegenweht …«
Als 1917 Heinrich Manns Schauspiel »Madame Legros« in Lübeck uraufgeführt wird, hält es Thomas Mann für angebracht, die ortsansässige Kritikerin von der Minderwertigkeit des Stückes zu überzeugen: Er spricht von dem »durchaus anti-deutschen Sinn dieser Verherrlichung des französischen Revolutionsaktivismus« und meint, es handle sich hier »um eine Mischung oder Kreuzung aus Ästhetizismus und Politik, die mir, ich kann mir nicht helfen, auf die Nerven geht, wie nicht leicht etwas anderes …« Die Lübecker, denen das Stück offenbar gefallen hat, werden zur Ordnung gerufen: Sie hätten das »Intellektuell-Doktrinäre« nicht erfaßt, »eine Entsetzen erregende Rechthaberei, eine aggressive Selbstgerechtigkeit, eine jakobinische Humanitätsprinzipienreiterei, von deren verbohrter Unduldsamkeit man sich schwer eine Vorstellung macht«.
Heinrich Manns Roman »Die Armen« (1917), ein freilich auf peinliche Weise mißratenes Buch, wurde in den »Lübeckischen Blättern« ungünstig beurteilt. Thomas Mann konstatierte offenbar nicht ohne Genugtuung: »Ich glaube, er wird mehr dergleichen zu hören bekommen, aber ich kenne niemanden, der dem Tadel weniger zugänglich wäre. Das beruht auf Dummheit, ein für alle Mal.« Bemerkenswert, daß Thomas Mann, der angeblich »Unpolitische«, weit besser als der Bruder das politisch Bedenkliche des Romans »Die Armen« und ähnlicher damals moderner Literatur gesehen hat – nämlich die »Wirklichkeitsfeindschaft« des »aufs Sozialkritische angewandten Expressionismus«.
Allerdings war, wie schon erwähnt, auch Thomas Mann dem Tadel nicht gerade zugänglich. 1905 hatte er bekannt: »Ich hege eine Schwäche für alles, was Kritik heißt, – und diese Liebe möcht’ ich nie besiegen.« Gewiß, aber er hatte es nicht gern, wenn man seine Bücher kritisch betrachtete. 1918 schrieb er Ida Boy-Ed, er habe über sein »Lebenswerkchen« von der Kritik noch nie etwas Gescheites gehört, »was ich nicht schon selber gesagt hätte«. Ein provozierendes Wort. Aber ist es ganz falsch? Es läßt sich nicht verschweigen: Der das größte Romanwerk in deutscher Sprache geschaffen, war auch der beste Kenner dieses Werks.
Genug der Zitate. Es sind ohnehin sehr viele. Aber »belächeln Sie nicht meine Neigung zum Zitieren!« – sagte Thomas Mann in einem 1939 gehaltenen Vortrag. »Auch das Zitieren ist eine Form der Dankbarkeit.«3
(1976)
Die ungeschminkte Wahrheit
Sein Porträt, dessen Umrisse schon erstarrt und im Bewußtsein eines großen Teils der deutschen Leserschaft fest eingeprägt schienen, hat seine Deutlichkeit wieder eingebüßt: Die Linien verblassen und verschwimmen, die Legende kann ihre Fragwürdigkeit nicht mehr verbergen, das Denkmal schwankt und bröckelt ab. Und allmählich entsteht ein anderes Porträt, fast unmerklich bildet sich die nächste Legende, in weiter Ferne wird ein neues Denkmal sichtbar.
So war es schon einmal, um 1832 und später, als Grabbe, Börne und viele andere Vertreter der nachfolgenden literarischen Generation gegen Goethe Sturm liefen. Seine übermächtige Gestalt hatte den Protest der Jüngeren geradezu herausgefordert. Das Ergebnis kennt man: Der ehrgeizige Revisionsprozeß, mit Verve und Zorn geführt, vermochte gewiß einiges zur Klärung beizutragen, hat aber vor allem Ruf und Geltung dessen, den man unbedingt auf der Anklagebank sehen wollte, auf ungeahnte Weise gefestigt und gleichsam mit einem neuen und noch breiteren Fundament versehen. Denn dies ist sicher: Nicht die Attacken, mit denen ein genialer Dichter in den Jahrzehnten nach seinem Tod bedacht wird, gefährden seinen Nachruhm, sondern das Ausbleiben solcher Attacken. Es kann ja die Abwendung nur da mißlingen, wo man sich auch die Mühe macht, sie tatsächlich zu versuchen.
Er, Thomas Mann, hat in dieser Hinsicht keinen Anlaß zu Klagen. Schon zu Lebzeiten von vielen seiner schreibenden Zeitgenossen als ein Ärgernis und oft als eine kaum noch zu ertragende Provokation empfunden, wurde er 1975, als man seinen hundertsten Geburtstag beging, zum Gegenstand einer Generaloffensive, die in der Geschichte der deutschen Literatur ihresgleichen nicht kennt: Dutzende von Schriftstellern erklärten, niemand sei ihnen gleichgültiger als der Autor des »Zauberberg«. Aber sie beteuerten es mit vor Wut und wohl auch vor Neid bebender Stimme.
Der ebenso unvermeidliche wie notwendige Prozeß der Entmonumentalisierung ist also längst im Gange. Vorerst jedoch betrifft er weniger das Werk Thomas Manns als vor allem seine Person. Und anders als in vergleichbaren Fällen kommen die entscheidenden Anstöße zur Überprüfung der bisherigen Ansichten und Urteile nicht etwa von rebellischen Vatermördern oder meuternden Interpreten, sondern von ihm selber – von Dokumenten nämlich, die noch aus seiner Hand stammen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!