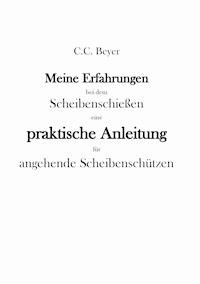
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Nachdruck des 1844 erschienenen Büchleins von C.C.Beyer über seine Erfahrungen beim Scheibenschießen ist der zweite Teil einer in loser Folge erscheinenden Edition historischer Texte zur Schießpraxis in deutschen Schützenvereinen der Zeit vor 1900. Den ersten Teil der Edition bildet der Nachdruck von Heinrich Kummer verfassten und des 1862 erschienenen Buches „Der praktischen Büchsenschütze“ (ISBN 978-384-826-429-2). Man findet hier eine ganze Reihe von Dingen, die auch heute noch für den Vorderlader-Schützen von Interesse und von Nutzen sind, zumindest dann, wenn er gepflasterte Rundkugeln verwendet. Nach Beyers Erfahrungen von 1844 waren Kugeln, von denen etwa 30 Kugeln und 45 Kugeln ein (bayerisches) Pfund wiegen würden, besonders geeignet für das Scheibenschießen. Umgerechnet entspricht das Kugeln mit Durchmessern zwischen 12,8mm (.504") und 14,6mm (.577"), was genau der Bereich ist, der heute von vielen Vorderlader-Schützen bei Entfernungen größer als 50m als optimal für die gepflasterte Rundkugel angesehen wird. Und viele Probleme, über die auch heute noch unter Schützen heiß und erbittert diskutiert werden, wurden schon vor 1844 genau so kontrovers diskutiert. Das fängt an mit der Qualität und Körnung des Pulvers und endet längst nicht bei der Frage, ob nach jedem Schuss gewischt werden soll oder nicht. Das Buch erlaubt auch interessante Einblicke in das Innenleben der damaligen Vereine. Und manches Problem von „Damals“ ist auch heute noch aktuell, so z.B. die Frage, wer für einen Posten im Vorstand geeignet ist und wie vorzugehen ist, um dauerhaft Nachwuchs für den Schießsport zu sichern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Neu gesetzt, mit einem Vorwort versehen und
herausgegeben von
Wolfgang Finze
Vorwort des Herausgebers
Der Nachdruck des 1844 erschienenen kleinen Büchleins von C.C.Beyer über seine Erfahrungen beim Scheibenschießen ist der zweite Teil einer in loser Folge erscheinenden Edition historischer Texte zur Schießpraxis in deutschen Schützenvereinen der Zeit vor 1900. Den ersten Teil der Edition bildet der Nachdruck von Heinrich Kummer verfassten und des 1862 erschienenen Buches „Der praktische Büchsenschütze“ (ISBN 978-384-826-429-2).
Zwischen den Erscheinungsdaten der beiden Werken liegen lediglich 18 Jahre. In dieser Zeit hatte sich die Waffentechnik mit einer vorher kaum für möglich gehaltenen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Schossen die Schützen vor 1844 ausschließlich mit gepflasterten Rundkugeln, war achtzehn Jahre später die Kugel fast völlig von den Ständen verschwunden und durch die von Beyer noch nicht einmal erwähnten Langgeschosse abgelöst worden. Dass Langgeschosse von Beyer nicht erwähnt werden, ist aber nicht auf Rückständigkeit der Schützen oder Unkenntnis des Autors zurückzuführen, sondern darauf, dass Langgeschosse in der Zeit vor 1844, als der Autor seine im Buch niedergelegten Erfahrungen sammelte, so gut wie unbekannt waren. Der Siegeszug der Langgeschosse begann erst nach 1844, als auf dem eidgenössischen Schützenfest in Basel gezogene Büchsen mit Kalibern zwischen 9mm und 10mm und Spitzgeschossen wegen ihrer Treffsicherheit weithin Aufsehen erregten.
Es gibt im Büchlein von Beyer aber eine ganze Reihe von Dingen, die auch heute noch für den Vorderlader-Schützen von Interesse sind, zumindest dann, wenn er gepflasterte Rundkugeln verwendet. Nach Beyers Erfahrungen waren Kugeln, von denen etwa 30 Kugeln und 45 Kugeln ein (bayerisches) Pfund wiegen würden, besonders geeignet für das Scheibenschießen. Umgerechnet entspricht das Kugeln mit Durchmessern zwischen 12,8mm (.504") und 14,6mm (.577"). Das ist genau der Bereich, der heute von vielen Vorderlader-Schützen bei Entfernungen größer als 50m als optimal für die gepflasterte Rundkugel angesehen wird.
Viele Probleme, über die auch heute noch unter Schützen heiß und erbittert diskutiert werden, wurden schon vor 1844 kontrovers diskutiert. Das fängt an mit der Qualität und Körnung des Pulvers (C.C.Beyer zog grobe Körnungen vor) und endet längst nicht bei der Frage, ob nach jedem Schuss gewischt werden soll oder nicht. Nach den Erfahrungen von Beyer schoss man allerdings gleichmäßiger, wenn man den Lauf nicht nach jedem Schuss auswischte.
Beyer beschreibt in seinem Büchlein viele schon vor 1844 gebräuchliche Hilfsmittel beim Scheibenschießen. So waren nicht nur Diopter sondern auch dafür bestimmte Farbfilter (farbig gefärbte Gläser) bekannt und üblich. Auch der Einfluss des Windes war bekannt, weshalb auf den Schießständen Windfahnen standen, die dem Schützen Stärke und Richtung des Windes anzeigten.
Interessant ist, dass schon vor 1844 deutlich zwischen Jagdwaffen (Pürschstutzen) und speziell für das Scheibenschießen gebauten Büchsen (Scheibenstutzen) unterschieden wird. Als Unterscheidungsmerkmale wurden die Masse der Büchse, die Visierung sowie die Gestaltung des Abzugsbügels angesehen. Auch wenn die Pürschstutzen primär für die Jagd bestimmt waren, wurden sie doch auch zum Scheibenschießen eingesetzt, allerdings auf geringere Entfernungen als die Scheibenstutzen. Mit den Pürschstutzen schoss man auf Entfernungen von 100 bis 120 Schritt (68m bis 82m), mit Scheibenstutzen dagegen meist auf eine Entfernung von 150 Schritt (ca. 102m). Geschossen wurde ausschließlich stehend freihändig, wobei es verboten war, einen Arm am Oberkörper abzustützen. Dieses Verbot entstammte der bayerischen Schützenordnung von 1796, in der im §24 festlegt war, dass der Arm frei schweben musste und der Ellenbogen „wenigst zwei Finger breit“ vom Körper entfernt sein musste.
Neben dem statischen Scheibenschießen war 1844 auch das Schießen auf laufende Wildscheiben üblich.
Beyers Büchlein erlaubt auch sehr interessante Einblicke in das Innenleben der damaligen Vereine. Und manches Problem von „Damals“ ist auch heute noch aktuell, so z.B. die Frage, wer für einen Posten im Vorstand geeignet ist und wie vorzugehen ist, um dauerhaft Nachwuchs für die Vereine und Gilden zu sichern.
Beim Lesen des Textes fällt auf, dass sich das Schießen im Jahre 1844 ganz wesentlich vom heutigen Sportschießen unterschied. Schießen war damals eine Art von Geschicklichkeitsspiel, bei dem es um teilweise hohe Geldbeträge ging. Deshalb nehmen Ausführungen, wie eingesetzte Beträge unter den Gewinnern gerecht aufzuteilen sind, einen breiten Raum ein.
Heute selbstverständliche Dinge wie sportliche Vergleiche und Meisterschaften fehlen dagegen. Man muss dazu wissen, dass der “Sport“ im heutigen Sinne 1844 noch nicht erfunden war und der Begriff selbst eine andere Bedeutung hatte. Sport war ein aus dem englischen kommender Begriff, war hauptsächlich etwas, das englische Gentlemen in ihrer Freizeit taten und hatte mit dem, was in den Schützengesellschaften vor sich ging, nichts zu tun. Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau, 1857, Band 5, S. 293, erklärt den Begriff „Sport“ so:
Sport, engl., Scherz, Spiel, dann Vergnügungen, zu denen Kraft u. Gewandtheit gehört, namentlich Reiten und Jagd; S.smen, Leute, welche s. s mitmachen
Und im Band 16, S. 587 des 1863 in Altenburg erschienenen „Pierer’s Universal-Lexikon“ wird der Begriff Sport so erklärt:
Sport (engl.), 1) Spiel, Lust, Scherz, Belustigung, ländliches Vergnügen; bes. 2) alle Vergnügungen, welche körperliche Gewandtheit u. Kraft, sowie persönlichen Muth erfordern, als Wettrennen zu Roß (Reitsport), Jagd etc. Bei der Vorliebe der Engländer für dergleichen Vergnügungen ist das Sportwesen namentlich in England unter allen Klassen der Gesellschaft am meisten ausgebildet u. zu einer Art Kunst u. Wissenschaft entwickelt, deren Kenntniß dem vollendeten Gentleman unentbehrlich ist. Der S. hat daher auch eine eigne Literatur hervorgerufen; unter den demselben gewidmeten Zeitschriften ist das Sporting Magazine das bedeutendste.
Neben dem Fehlen des heute üblichen „Sports“ fehlt aber auch jeder Hinweis darauf, dass Schießen im Verein eine Vorbereitung für die Verteidigung des Vaterlandes wäre. Zwar war im Vorspann der bayerischen Schützenordnung von 1796 festgelegt:
„Daß sich sämmtliche Unterthanen, wessen Standes sie immer seyn mögen, nicht allein zu einer edlen Belustigung im Schiessen üben, sondern vorzüglich, daß sie sich auch im nöthigen Falle zu eigner, so wie zu des Vaterlandes Vertheidigung fähig machen können.“
Allerdings verschoben sich im Laufe der Zeit die Aufgaben der Schützengesellschaften immer mehr zum „geselligen Verein“, die Vorbereitung auf die „ Verteidigung des Vaterlandes“ trat mehr und mehr in den Hintergrund. Die „Schützen-Ordnung für die bürgerliche Schützengesellschaft zu Schwabach“ aus dem Jahre 1842 führt unter „Zweck und Vortheile der Gesellschaft“ an:
„Ausser dem allgemeinen Zweck eines geselligen Vereins, welcher darin besteht, daß die Freunde der Schießübungen sich auch freundschaftlich annähern, angenehm unterhalten, und bei besondern Festlichkeiten zur Erhöhung derselben beitragen, überdieß die Pflichten der Wohlthätigkeit eben so wie die übrigen staatsbürgerlichen Tugenden üben, hat die Schützengesellschaft insbesondere den Hauptzweck, die Behandlung und den Gebrauch der Schießgewehre genau kennen zu lernen und erforderlichen Falls zur Vertheidigung des Vaterlandes auf gesetzliche Weise nach Kräften mitzuwirken. „
Allein schon die Reihenfolge der Aufgaben zeigt, welchen geringen Stellenwert die Vorbereitung auf die Vaterlandsverteidigung in den Vereinen tatsächlich hatte. Zumindest in den Gegenden, in denen der Autor C.C. Beyer seine hier niedergelegten Erfahrungen sammelte, war das „gesellige Vergnügen“ zum eigentlichen Zweck des Scheibenschießens und der Schützengesellschaften geworden.





























