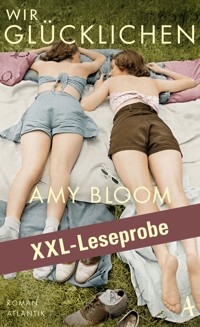9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
» Großartige Unterhaltung. « – Elle Washington, 1932: Die junge Reporterin Lorena Hickok reist in die Hauptstadt, um in der heißen Phase des Wahlkampfs um das Präsidentenamt regelmäßig Einblicke ins Leben des Kandidaten Franklin D. Roosevelt und seiner Frau Eleanor zu liefern. Als Roosevelt wenige Monate später das Rennen für sich entscheidet, zieht "Hick" ebenfalls ins Weiße Haus ein – und wird zur Geliebten der First Lady. Eine wahre Geschichte über zwei besondere Frauen mitten im Machtzentrum der USA.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Amy Bloom
Meine Zeit mit Eleanor
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Kathrin Razum
Atlantik
Für meine Eltern, Sydelle und Murray
Prolog
Freitag, 27. April 1945, am Nachmittag
29 Washington Square West
New York, New York
Alte Liebe rostet nicht.
Ich habe die Blumen so schön wie möglich arrangiert. Levkojen und Löwenmäulchen, rosa Rosen und Osterglocken, besorgt beim italienischen Floristen, in jedem Zimmer steht eine Vase davon. Ich habe die vier Zimmer, die bereits sauber und ordentlich waren, auf Vordermann gebracht. Das Radio funktioniert noch. Der Plattenspieler ebenso, irgendjemand hat Alben von Cole Porter und Gershwin dagelassen, und aus den Zeiten, als ich häufiger hier war, ist noch eine zerkratzte Schallplatte von La Bohème mit Lisa Perli da. Ich war zweimal beim Lebensmittelladen an der Ecke (Eier, Milch, Brot, Meerrettichkäse, Sardinen, und dann musste ich noch mal los, weil ich in der Wohnung keinen Büchsenöffner fand) und habe uns ein paar Häuser weiter etwas zum Zwitschern besorgt. Ich hoffe, dass wir heute Nachmittag um fünf bereits unsere Sidecars trinken. Ich habe Zitronen gekauft. Alles, was wir brauchen, soll zur Hand sein. Ich hoffe, wir werden dieses Wochenende nicht einmal den Hausflur zu sehen kriegen.
Ich ziehe mich im Wohnzimmer um. Das Schlafzimmer sollte ich nicht betreten, finde ich, jedenfalls nicht unaufgefordert. Ich gehe davon aus, dass ich auf der Couch schlafen werde. Ich habe meinen marineblauen Sulka-Pyjama mitgebracht, um der alten Zeiten willen.
Der Radiosprecher erhebt die Stimme wie ein Trainer auf dem Spielfeld und meldet, achtzehn große deutsche Städte stünden in Flammen. Die deutsche Infanterie-Division Potsdam ermorde systematisch im Kampf verwundete Amerikaner. Mit munterer Stimme verkündet er, zweitausend amerikanische Flugzeuge bombardierten derzeit Eisenbahnknoten in der Nähe von Berlin sowie Nachschublinien in Süddeutschland. Er sagt: Gute Nacht, meine Damen und Herren, der Sieg ist in Sicht. Ich hoffe, er hat recht.
Ich bin froh, und ich bin müde. Ich werde das Ende des Kriegs auf Long Island feiern, mit ein paar anderen alten Schrullen und unseren Hunden, und wir werden alle auf Franklin Roosevelt anstoßen, der das Kriegsende nun also nicht mehr erleben darf. Meine Nachbarin Gloria und ich werden »Straighten Up and Fly Right« singen. Wir werden alle weinen.
Ich setze mich auf die Wohnzimmercouch und warte. Früher konnte ich, wenn ich Eleanors Gesicht sah, in ihrem Herzen lesen, und ich habe Angst, dass ich das vielleicht nicht mehr kann. Ich rechne damit, dass sie aschgrau vor Roosevelt-Leid sein wird, einem Leid, das nicht nur ertragen, sondern zugleich zur Schau getragen werden muss, und zwar elegant, sodass man ihr Bemühen erkennt, gegenüber der Trauer und demonstrativen Bedürftigkeit aller anderen Geduld zu zeigen. Darunter allerdings quält sie vermutlich, genau wie damals bei ihrem Bruder, ein Widerhaken zorniger Trauer, den sie herausziehen würde, wenn sie es nur könnte. Sie hat mir mal gesagt, nichts sei so schlimm für sie gewesen wie der Tod ihres Kleinen, des ersten Franklin Junior, aber ich war in den langen Tagen, als ihr Bruder Hall starb, bei ihr, und sie hat jede Nacht um ihn geweint – als hätte er nicht allen das Herz gebrochen, als hätte er nicht eines seiner Kinder fast umgebracht und die anderen fünf ruiniert. Sie saß an Halls Bett und sah aus wie diese Grabskulptur, zu der sie mich so oft schleifte, jene Allegorie der Trauer, die Henry Adams anfertigen ließ, nachdem seine Frau sich mit Zyanid das Leben genommen hatte. Damit also rechne ich, aber ich hoffe, dass sich im Durcheinander ihrer Gefühle, der Trauer über Franklins Tod und der Sorge um ihre Kinder und das Land, auch ein bisschen Freude darüber findet, mich zu sehen. Ich möchte, dass sie sich bei mir zu Hause fühlt, so wie früher. Vor acht Jahren hat sie mich weggeschickt, und ich bin gegangen. Vor zwei Tagen hat sie mich gebeten, zu kommen, und ich bin gekommen.
Die Türglocke ertönt, was bedeutet, dass sie die Hände voll hat und nicht an ihren Schlüssel kommt.
Ich öffne, und Eleanor lehnt an der Wand, weiß wie ein Laken.
Ihre schönen blauen Augen sind rot umrändert, und sie sieht aus, als hätte sie noch nie im Leben gelächelt. Ihr staubiger schwarzer Mantel wirkt riesengroß, und ihre Baumwollstrümpfe sind ausgeleiert. Ich will sie küssen, weil ich sie zur Begrüßung immer küsse, wenn wir allein sind und uns gerade vertragen, und sie hält mir die Wange hin und schaut dann weg. Sie reicht mir Handtasche und Koffer. Ich stelle beides ab und lege ihr den Arm um die Taille. Ich versuche ihr Gesicht an meines zu ziehen, aber sie wendet sich ab und stützt sich mit einer Hand auf meine Schulter, um sich die Schuhe auszuziehen.
Sie legt Hut, Mantel und Schal auf den großen Brokatsessel. Sie knöpft ihre graue Bluse auf und lässt sie zu Boden fallen. Sie geht ins Schlafzimmer, öffnet den Reißverschluss ihres Rocks, und ich folge ihr und hebe alles auf. Sie setzt sich auf die Bettkante, in einem zerschlissenen alten Unterkleid, das sie schon vor dem Krieg hätte ausrangieren sollen.
Sie zieht die Haarnadeln aus ihrem grauen Haar und streift die schrecklichen Baumwollstrümpfe ab. Wegen dieser Strümpfe haben wir uns öfter gestritten. Ich sagte, nicht einmal im Krieg müsse die First Lady Mitglieder von Königshäusern in Strickstrümpfen aus weißer Baumwolle empfangen, und sie sagte, doch, genau das müsse die First Lady tun. Ich ziehe die Strümpfe über der Lehne des Klubsessels in Form, und sie zuckt mit den Achseln.
Sie legt sich aufs Bett, das Gesicht zur Wand, und hebt den rechten Arm in meine Richtung. Ohne sich zu mir umzudrehen, winkt sie mich zu sich.
»Na, Ihro Majestät«, sage ich.
Sie lässt den Arm sinken. Das ist nicht meine Eleanor. Ich habe früher oft geweint, wenn sie streng und huldvoll zu mir war, mir meine Verfehlungen erläuterte, bis ich mich zusammenkrümmte wie eine Schnecke auf einem Salzbett. In tragischer Enttäuschung saß sie dann reglos da, eine Stunde und länger, bis ich um Vergebung flehte. So kenne ich mein Schätzchen. Diese wächserne Teilnahmslosigkeit ist neu.
Ich lege ihre Kleider auf den Holzstuhl. Ich stelle ihre schwarzen Schuhe vor das Kaminfeuer. Ich hänge ihren schwarzen Mantel in den Schrank, neben meinen marineblauen, und mein roter Schal fällt über beide. Ich bereue es, dass ich gekommen bin.
Oh, Hick, sagt sie, wenn du mich nicht hältst, sterbe ich.
Ich klettere hinter ihr ins Bett, und sie entkleidet mich mit einer langen weißen Hand, immer noch ohne mich anzusehen. Ich schaue über ihre Schulter nach draußen und sehe zu, wie die Leute ihre Lichter anmachen.
Vor zwölf Jahren hatten wir unsere glücklichste Zeit und unseren ersten gemeinsamen Urlaub. Maine und danach, das waren unsere glücklichsten Tage. Hoover war weg vom Fenster. Franklin übernahm. Wir zogen alle ins Weiße Haus, Freunde, Verwandte und ich.
Eleanor und ich hatten uns zu unserem ersten privaten Mittagessen im Weißen Haus getroffen, wo wir wie Teenager grinsend vor den Porträts posierten. Zieh doch auch hier ein, sagte sie. Wir haben so viel Platz.
Ich fragte sie, wie sie das meinte, und sie sagte noch einmal: Wir haben so viel Platz. Ich beugte mich vor, um sie zu küssen, und sie schob mich sachte von sich weg. Wenn du kommen willst, muss ich ein bisschen was organisieren, sagte sie. Hol du doch in der Zwischenzeit deine Sachen.
Ich fuhr zurück nach Brooklyn und gab den Scheck mit der Miete in die Post; es war fast der volle Betrag. Am nächsten Tag transportierte ich meinen blauen Koffer, meine Schreibmaschine – eine Underwood Portable – und eine Kiste mit Büchern nach D.C. Eine der Haushälterinnen führte mich im Weißen Haus die Treppe hinauf zu Eleanors Suite, höflich und mit ausdrucksloser Miene, als hätte sie mich noch nie gesehen, als hätte sie noch nie meine Wäsche gewaschen oder meinen Rock gesäumt, wenn ich übers Wochenende da war, doch als sie die Tür zu meinem Zimmer öffnete, lächelte sie und stellte meine Schreibmaschine auf den Tisch. Mein neues Zimmer lag direkt neben dem von Eleanor, es war ihr bisheriges Wohnzimmer.
Ich hatte einen großen Schreibtisch, ein Bücherregal und einen alten Windsor-Stuhl. Zwei Tischlampen und eine Stehlampe. Ich hatte ein Bett, eine dunkle Samtcouch, die schon bessere Zeiten gesehen hatte und die ich in die Ecke schob, und einen riesigen Kleiderschrank, in dem ich mich hätte verstecken können. Das Einzige, was uns voneinander trennte, war eine von Fotografien bedeckte Wand und eine alte Holztür.
Ich saß ungefähr eine Stunde lang aufrecht auf meinem schmalen Bett, noch mit Hut und Mantel, starrte auf diese Holztür und versuchte durch schiere Willenskraft zu bewirken, dass sie sich öffnete und mich einließ, damit ich in den Rosengarten hinunterschauen und das Fenster zu der großen Magnolie öffnen konnte.
Schließlich kam Eleanor herein und setzte sich neben mich.
»Ich überschütte andere Menschen mit Liebe, weil mir das Freude macht«, sagte sie. »Ich finde es schön, Menschen mit Liebe zu überschütten. Du hast mich ja schon mit meinen Freunden erlebt.«
Das hatte ich. Es machte mich schier verrückt, schon jetzt.
Sie sagte: »Ich möchte, dass du weißt, dass ich neben meinen Freunden auch immer mal wieder einen Schwarm habe. Ich treffe auf irgendjemanden, oft sind es wundervolle Menschen, aber das muss gar nicht unbedingt sein, und bin hingerissen, ob ich will oder nicht. Doktor Freud würde sagen, das liegt an meiner Mutter, wieder einmal. Oder meinem Vater.«
Sie nahm mir lachend den Hut ab. Mir fiel nichts Geistreiches oder Charmantes zu tun oder sagen ein, aber auch gar nichts. Ich rieb mir die Fingerknöchel.
»Ich bin fest entschlossen, dir zu sagen, was ich dir sagen will«, fuhr sie fort. »Über diese Schwärmereien. Denn möglicherweise wirst du zu hören bekommen, dass ich zu so etwas neige. Und dass auch du so ein Schwarm bist. Die Leute schauen mir in die Augen und sehen die unbändige Liebe, die ich für sie empfinde. Das genießen sie, und sie lieben mich dafür, dass ich sie so liebe. Sie schauen mir in die Augen und sehen sich selbst als Mittelpunkt der Welt. Und das gefällt jedem.«
Sie ging zu der Holztür und drehte den Knauf ein paarmal hin und her.
»Dieses Ding klemmt immer.«
»Komm zu mir«, sagte ich.
Sie setzte sich wieder aufs Bett und nahm meine Hand, hielt den Blick nach vorn gerichtet.
»Aber du siehst mich. Du siehst mich ganz, und ich glaube nicht, dass dir alles gefällt, was du siehst. Ich wünsche es mir, aber ich bezweifle es. Du siehst mich. Die ganze Person. Nicht nur dein Spiegelbild in meinen Augen. Nicht nur den Menschen, der dich liebt. Sondern mich.«
Meine Ohren glühten wie nach drei Gläsern Scotch.
Jetzt wandte sie sich mir zu.
»Lorena Alice Hickok, du bist die Überraschung meines Lebens. Ich liebe dich. Ich liebe deine Unerschrockenheit. Ich liebe dein Lachen. Ich liebe es, wie du mit Sprache umgehst. Ich liebe deine schönen Augen und deine schöne Haut, und ich werde dich immer lieben, bis zu meinem letzten Atemzug.«
Ich stieß die Worte hervor, bevor sie es sich noch anders überlegte.
»Anna Eleanor Roosevelt, du erstaunliche, vollkommene, unvollkommene Frau, du hast mich umgehauen. Ich liebe dich. Ich liebe deine Freundlichkeit und deinen funkelnden Geist und dein weiches Herz. Ich liebe es, wie du tanzt, und ich liebe deine schönen Hände, und ich werde dich immer lieben, bis zu meinem letzten Atemzug.«
Ich streifte meinen Saphirring ab und schob ihn auf ihren kleinen Finger. Sie löste die goldene Ansteckuhr von ihrem Revers und heftete sie an mein Hemd. Sie legte die Arme um meine Taille. Wir küssten uns, als stünden wir mitten in einer jubelnden Menge und Reis und Rosenblätter würden auf uns niederregnen.
Auf dem gesamten Weg zum Büro von Associated Press lag meine Hand auf der goldenen Uhr. Ich wusste, dass ich meinen Posten aufgeben musste. Ich hatte mir schon ein Dutzend preisverdächtiger Roosevelt-Stories verkniffen, um sie oder ihn oder die Kinder zu schützen. Ich musste das Ressort wechseln oder auf sie verzichten.
Ich gab meinen Posten auf. Und wurde zugleich gefeuert. Ich bot an, einen anderen Bereich zu übernehmen, die Wall Street oder Innerstädtische Kriminalität. Mein Chef schob seinen Stuhl zurück, faltete die Hände über seinem großen Bauch und sah mich an, als wäre ich die übelste Sorte Kakerlake. Sie sind Teil des Ganzen, Kleine, sagte er. Ich hatte nie einen besseren Draht ins Weiße Haus, warum sollte ich den aufgeben. Wenn das so ist, sagte ich, muss ich kündigen. Er zuckte mit den Achseln, als hätte er nichts anderes erwartet, und wir gaben uns die Hand.
Ein paar alte Kumpel sahen zu, wie ich meinen Schreibtisch ausräumte, aber niemand lud mich auf einen Drink ein. Die Frau, die für die Hochzeiten zuständig war, winkte mir fröhlich zu. Der Sportreporter schüttelte den Kopf. Der Mann für die Nachrufe lüpfte den Hut. (Wie nennt man einen jüdischen Gentleman, der das Zimmer verlässt?, hat Bernard Baruch mich mal gefragt. – Itzig.) Ich hatte fünfundzwanzig Dollar auf dem Konto und keine neue Arbeit in Aussicht.
Auf dem Weg zurück ins Weiße Haus hielt ich mir immer wieder vor Augen, wie redlich und ehrenhaft ich war, welche Schönheit und Tiefe dem Opfer eignete, das ich gebracht hatte, und wie wichtig Integrität war. Ich hoffte jedenfalls, dass sie Eleanor wichtig war, die niemals eine Arbeitsstelle hatte suchen oder aufgeben müssen, und tatsächlich war sie hocherfreut. Sie war überzeugt, dass ein lebenswertes Leben immer damit einherging, Opfer zu bringen, je mehr desto besser. Jetzt haben wir mehr Zeit füreinander, sagte sie. Jetzt haben wir unser Leben. Womit sie meinte, dass ich nicht länger befürchten musste, sie zu verraten, und sie nicht befürchten musste, von mir verraten zu werden, und dass ich meine Zeit nicht mehr mit verlotterten Männern vergeuden würde, die fluchten und schon vormittags Scotch tranken. Sie umarmte mich und sagte: Ich glaube, es ist besser so, Liebste. Wie aufs Stichwort rollte in diesem Moment Franklin herbei und verkündete: Wir haben eine Stelle für Sie, Hicky.
Ich weiß bis heute nicht, wer von ihnen als Erster auf die Idee kam, aber sie sagten mir beide, ich solle mit Harry Hopkins sprechen, der jemanden für Reportagen und Recherchen zur Unterstützung der Federal Emergency Relief Administration suche. (Sie berichten Harry einfach, wie schlimm die Lage ist, sagte Franklin. Verstehen Sie sich als Reporterin, nicht als Sozialarbeiterin.) Sie sagten mir beide, ich würde besser bezahlt werden als bei Associated Press. Hopkins stellte mich innerhalb von zehn Minuten ein, er hielt meinen Lebenslauf hinter dem Rücken und blickte aus dem Fenster, als läse er von einem Manuskript ab. Danke, Miss Hickok, ich werde mich auf Ihre Berichte verlassen, sagte er, den Blick immer noch abgewandt.
Ich eilte zu Eleanor zurück und sagte ihr, ich hätte die Stelle bekommen, und sie lächelte.
Um fünf kam eine der Hausangestellten und sagte mir, ich solle auf einen Drink nach unten kommen. Franklin und Eleanor brachten einen Toast auf mich aus: Besser, Sie sitzen hier bei uns im Zelt und pinkeln nach draußen, Hick.
Wir planten einen Urlaub. (Ich will alles mit dir zusammen erleben, sagte Eleanor.) Wir konnten Franklin ausreden, jemanden vom Geheimdienst mitzuschicken, beluden das Auto und winkten ihm von der Auffahrt aus zu. Er winkte von der Veranda zurück. Benehmt euch, rief er. Wir winkten ein weiteres Mal.
Wir dachten, wir wüssten alles Entscheidende übereinander, und nichts von dem, was einmal entscheidend werden sollte, zeigte sich auch nur als Staubkörnchen im goldenen Licht. Wir hatten unsere junge Liebe und dieses wunderbare Land, Sorglosigkeit und Weite. Wir hatten Eleanors Sportwagen, einen hellblauen Buick Roadster, und genug Geld für alles, was wir brauchten oder wonach uns gelüstete. Eleanor wickelte sich ein Tuch ums Haar und ließ den einen Arm aus dem Wagen baumeln, wie ein Filmstar. Wir schwebten von Ort zu Ort, verliebt, verzückt, genossen jeden Tag, jede Sekunde, fuhren weiter, um weiter zu genießen.
Wir machten Rast und unterhielten uns. Ich sang für Eleanor jedes Kirchenlied, das mir nur einfiel, und zotige Lieder, bei denen sie sich die Ohren zuhielt. (Auf Hick reimt sich ziemlich viel.) Im Wagen türmten sich Tüten mit Salzbrezeln, nagelneue Sonnenbrillen, ein Haufen Landkarten, ein Beutel mit Eleanors Strickzeug, worüber ich lachen musste, ein Kartenspiel für alle Fälle und etliche Gedichtbände. (»›Sturmnächte‹« rezitierte ich, während sie fuhr. »›Ein Boot in Eden – Ach – das Meer! Verankert sein – heut nacht – In dir!‹ Verankert«, rief ich noch einmal, und Eleanor errötete. Ich liebe Emily Dickinson, sagte sie.)
Ich hatte meinen marineblauen Pyjama eingepackt und sie ihr rosa Nachthemd, und eines Abends, in einem fast leeren Hotel in Vermont, zog sie meinen Pyjama und ich ihr Nachthemd an, und das Bett brach fast unter uns zusammen. Sie schrieb Franklin regelmäßig. Einfach damit er sich keine Sorgen macht, sagte sie. Grüß ihn von mir, sagte ich. Manchmal wurde sie von Leuten erkannt, dann blieben wir stehen, und ich zog mich zurück, ging zum Auto oder in einen Laden, damit sie die Limonade oder den Apfelwein probieren, die Kinder oder Ziegen oder Patchworkdecken bewundern oder für jemanden mit Kamera posieren konnte, was aber selten der Fall war, weil wir da oben so fern von der modernen Welt waren. Sie war ursprünglich keine gute Rednerin gewesen, hatte sich aber zu einer entwickelt. Witze erzählen konnte sie nicht ums Verrecken. Aber Eleanor konnte zuhören. Jeder Mensch, mit dem sie sprach, war ihr Held. Zorniger Holzfäller, blinde Witwe mit Scharonsblumen-Quilt, hoffnungsvoller Musiker, dankbare Krankenschwester am Ende der Nachtschicht, Mutter von sechs Kindern, deren Hand in der Fabrik zerquetscht worden war. Sie trat nah heran. Sie neigte den Kopf, hielt inne und hörte zu. Hatte sie eine gute Stellung gefunden, rührte sie sich nicht mehr. Keine Sekunde lang erweckte sie den Eindruck, an irgendetwas anderes zu denken als an die Geschichte, die man ihr gerade erzählte. Stockte man, weil man erschöpft oder verlegen war, beugte sie sich weiter vor, als könnte sie es nicht ertragen, wenn man sich jetzt, in diesem innigen Moment, von ihr abwendete.
Wir genießen es, wenn uns mächtige Menschen ihre Aufmerksamkeit schenken, fühlen uns geschmeichelt von der unerwarteten Gunst, aber Eleanor war kein strahlendes Licht, dessen Glanz diese kleinen Leute nur kurz streifte. Sie wollte die Seele der Menschen erreichen, die mit ihr sprachen, jeden Tag aufs Neue. Sie neigte einem den Kopf zu, als gäbe es für sie in diesem Moment einzig und allein die Zeit und den Raum, die nötig waren, damit zwei Menschen sich einen Augenblick lang lieben konnten.
Wir begegneten hauptsächlich Farmern und älteren Republikanern, Leuten, die nicht in die Zeitung schauten, wenn sie es irgend vermeiden konnten, die Lokalnachrichten, den Sportteil und die Futterpreise ausgenommen. Meistens waren wir einfach Jane und Janet Unbekannt, wir gingen untergehakt und flüsterten einander ins Ohr. Frauen mittleren Alters, die einander mochten: Schwestern, Cousinen, beste Freundinnen. Wir blieben für uns, wenn man von Eleanors ausgeprägtem Wunsch absah, zu allen Menschen nett zu sein, und die meiste Zeit dachten die Leute von uns, was man eben so von Frauen mittleren Alters denkt, und mehr auch nicht.
Wir genehmigten uns eine Pause von den Ziegen und Patchworkdecken, und Eleanor fuhr uns nach Quebec, ins Château Frontenac; schon am Stadtrand sagte sie: Mach die Augen zu. Ich glaube, wenn ich mal eine alte Frau bin und man schreien muss, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, wird es reichen, wenn jemand leise »Château Frontenac« murmelt, und schon werde ich lächeln wie eine Katze, die bis zu den Knien in Sahne steht. Eleanor tat für uns, was sie für sich allein nie getan hätte, und sie tat es im großen Stil, mit Goldrand. Für ein paar Tage schwelgten wir in verschwenderischstem französisch-kanadischem Luxus. Wir erhielten Massagen von zwei starken Frauen, die mit zwei Massagebänken und Picknickkörben voll warmer Handtücher und Rosen- und Orangenöl in unsere Suite kamen. Ich tat so, als wäre ich gerade zufällig vom Schlafsofa im Wohnzimmer herübergekommen. Sie stellten die Massagebänke auf und gaben uns zu verstehen, dass wir uns ausziehen und in Laken hüllen sollten. Wir taten wie geheißen und tapsten zu den Bänken hinüber, um uns von diesen finster dreinblickenden Frauen, die unsere Sprache nicht sprachen, einreiben und kneten zu lassen. Unsere Gesichter waren nur einen halben Meter voneinander entfernt, unsere Körper glänzten vom duftenden Rosenöl.
Ich sagte: »Das ist zu schön, um wahr sein.«
»Ich weiß«, sagte Eleanor. »Nach dem Mittagessen kommt die Maniküre.«
Ich sagte zu Eleanor, das ist unsere Fahrt ins Land Erewhon, und sie stimmte mir zu. Unser persönliches Nowhere, sagte sie, liegt nördlich von Maine. Hol schon mal deinen Pullover heraus. In der Abenddämmerung erreichten wir eine Hütte mit Blick aufs Meer, und wir luden das Auto aus, ehe es ganz dunkel wurde. Wir teilten uns einen Brandy und die restlichen Salzbrezeln und standen in unserer Nachtwäsche auf der kleinen Veranda, die große Steppdecke um unsere Schultern gelegt. Der gescheckte, strahlend helle Mond zog die Flut wie einen silbernen Teppich auf den dunklen Kiesstrand. Der Himmel hätte von Sternen übersät sein müssen, aber er war einfach nur tiefblau, wie das Meer darunter, bloß der Abendstern war zu sehen.
»Ich wünsche mir jetzt etwas«, sagte ich.
Wir aßen Kartoffelpfannkuchen zum Frühstück. (In jedem Café und jedem Diner standen Kartoffeln auf der Karte. Wir aßen sie gerieben mit Butter und Käse aus der Kartoffelschale, was köstlich war, und gestampft als Beigabe zu Schokoladenkuchen, was nicht köstlich war.) Wir gingen spazieren und entwarfen unser Traum-Cottage. Manchmal war es eine Variante von Val-Kill, Eleanors geliebtem Cottage in Hyde Park, einem regelrechten Labyrinth von Zimmern, mit viel Platz, einer Bibliothek und einem großen Speisezimmer. Manchmal war es ein Cottage auf Long Island – wo ich jetzt lebe –, von Rosen umrankt und mit Blick auf den Sound. An einem Abend machte ich Schattenspiele, zeigte alles, was wir von unserer Traumveranda aus sehen würden. Ich ließ einen Fuchs, einen Reiher, ein Eichhörnchen und ein sich küssendes Paar an der Wand erscheinen, mehr Figuren konnte ich nicht. Wir aßen ein Thunfischsandwich am steinigen, windigen Strand und richteten unsere Traumwohnung in Greenwich Village ein. Wir malten uns Reisen an Orte aus, an denen wir beide noch nie gewesen waren. Wie wär’s mit der Gaspé Bay, sagte ich. Da waren wir noch nie. Baie de Gaspé, sagte sie. Also gut, sagte ich. Nehmen wir noch Upper Gaspé, Land’s End und die Chaleur Bay dazu. Nicht zu vergessen Armonk und Massapequa. Hauptsache das Nachtleben tobt.
Ich stellte mir vor, wie Eleanor ihren Kindern von uns erzählen würde. Wären sie tatsächlich noch Kinder gewesen, hätte ich wohl bessere Karten gehabt. Wären sie noch Kinder gewesen, hätte ich ihnen selbst von uns erzählt. Kinder mochten mich. Ich verteilte großzügig Süßigkeiten und schimpfte wenig. Ich konnte einen Angelhaken beködern, Kartenhäuser bauen und Erdbeerkuchen backen. Ich zwinkerte ihnen hinter dem Rücken ihrer Mutter zu, wenn sie nach dem letzten Plätzchen griffen, und fand es schön, wenn ein kleines Kind auf meinen Schultern saß. Ich hatte ein Händchen für Kinder, aber die Roosevelt-Söhne waren verzogen und hohl und unendlich fordernd, und Anna war hübsch und durchtrieben. Hätte sie eine ausgeprägtere Arbeitsmoral gehabt, hätte sie bei L’Étoile du Nord Burlesque-Tänzerin werden können. Ich empfand ihnen allen gegenüber, was hart arbeitende arme Leute gegenüber den Reichen empfinden (nicht unbedingt Bewunderung und Zuneigung), und sie empfanden mir gegenüber, was Kinder für die Person empfinden, die das Herz ihrer Mutter gewonnen hat. Anna könnte ich vielleicht auf meine Seite ziehen, aber allein die Vorstellung, Eleanors Söhnen irgendetwas zu erzählen, lähmte mir die Zunge.
Eleanor sagte, wir müssten doch keine offizielle Erklärung abgeben.
»Wir bestellen sie ja nicht ins Oval Office ein. Es gibt keinen Grund, das an die große Glocke zu hängen.«
Sie saß so da, wie wenn sie ihren Kindern eine Strafpredigt hielt, mit straffem Rücken und gefalteten Händen. Ich warf ein Kissen nach ihr, und sie duckte sich.
»Es ist das Ende seiner Amtszeit –«
»Er wird eine zweite haben«, sagte ich.
Sie runzelte die Stirn.
»Ich habe nichts gesagt. Sprich weiter.«
»Wir sagen ihnen: ›Ihr Lieben, jetzt wo Vater nicht mehr Präsident ist, haben er und ich die Gelegenheit, weiter im Staatsdienst zu arbeiten und unsere Ehe fortzuführen. Aber zugleich werden wir auch getrennte Wege gehen.‹«
»Was nichts Neues ist«, sagte ich.
»Stimmt. Ich sage natürlich auch, dass Franklin und ich immer ein Team bleiben werden.«
»Natürlich«, sagte ich. »Boola boola.«
»Wir sind nicht in Yale«, sagte sie kopfschüttelnd.
»Und anschließend bricht Junior zusammen, als hätte ihn eine Kugel getroffen, Jimmy betrinkt sich, John fordert eine Taschengelderhöhung, und Elliott kreischt: ›Und wer kümmert sich um unseren armen Herrn Papa?‹«
»So viel trinkt Jimmy gar nicht. Ich sage ihnen: ›Euer Vater und ich lieben uns, und unsere Ehe wird fortbestehen.‹ Und dann: ›Ihr könnt ihn auf Campobello besuchen, und uns könnt ihr in …‹«
Sie wischte sich die Augen.
»Das ist ein dummes Spiel«, sagte sie. »Wenn es so weit ist, werden wir einfach ins Val-Kill-Cottage ziehen, du und ich, und damit hat sich die Sache.«
»Das ist mehr als genug«, sagte ich.
Wir glauben immer, wir würden alles in Erinnerung behalten, und am Ende erinnern wir uns an fast nichts. Selbst wenn das Auto nur vierzig fährt, ist es immer noch zu schnell. Die Bäume sind verwischte grüngraue Flecken, das Restaurant, wo wir uns über die Schreibfehler auf der Speisekarte halbtot lachten, ist längst von der Bildfläche verschwunden. Neongrüne Streifen und flamingorosa Blitze erleuchten den Himmel in einer Winternacht in Maine, und wir denken, oh, dieses Nordlicht, das werden wir nie vergessen, und dann vergessen wir es doch. Was wir in Erinnerung haben, ist dieses wellig gewordene Bild in der linken Schublade (Presque Isle, Maine, 1934) oder ein hinreißendes halbseitiges Foto aus einem alten Reisemagazin, aber das, was wir sahen, als wir Händchen haltend das Kinn in den Himmel reckten, wie um in dieses zuckende, funkelnde Leuchten einzutauchen, das sahen wir nur für zehn Sekunden und dann nie wieder.
Sie liebte das Theater. Sie war verrückt nach Cole Porter, und es gab keinen Song von ihm, den sie nicht gekannt hätte. Sie nickte allen zu. Sie drückte jede Hand. Die Beleuchtung im Zuschauerraum wurde gedämpft, und Eleanor küsste mich auf die Handfläche und flüsterte mit der Musik: You’re the top. You’re Mahatma Gandhi. You’re the top. You’re Napoleon Brandy. Ich dachte: Das vergesse ich nie. Und ich habe es nicht vergessen.
Wir waren im Rosengarten und duckten uns hinter eine blassrosa Rosensäule, um uns zu küssen. Wir gingen an dem Mann vom Geheimdienst vorbei nach oben, und Eleanor sagte: Guten Abend, Wyatt. Ich muss etwas an meiner Kleidung richten, und er sagte sehr herzlich: Ja, Ma’am. Sie fragte: Die Party dauert doch sicher noch zwei Stunden, oder was meinen Sie?, und er schaute auf seine Uhr. So wurde es uns gesagt, Ma’am. Wir liefen im Sturmschritt zu ihrem Schlafzimmer, als wären wir wild entschlossen, so schnell wie möglich eine Sicherheitsnadel zu finden. Ihr mit Pailletten besetztes Jäckchen glitt zu Boden und mit ihm das kunstvolle Ansteckbukett aus drei weißen Orchideen, das in ungefähr einer Stunde wieder am Platz sein musste. Sie sagte: Fass das Ding nicht an. Sie zog mich aufs Bett. Ich dachte nicht: Hoffentlich vergesse ich das nie. Trotzdem habe ich es nicht vergessen.
Erster Teil
Glück ist nicht Zufall
1932 war mein Vater tot, und mein Stern war im Aufgehen. Ich konnte schreiben. Man hielt nach meinem Namen Ausschau. Ich hatte einen Riesensprung vom Milwaukee Sentinel nach New York gemacht, weil ich die einzige Frau war, die sowohl über die Entscheidungsspiele im Football der Big Ten als auch über den großartigen Smith-Skandal schrieb (schwachköpfiger Miederwarenvertreter und seine dralle Mätresse schneiden deren Gatten den Kopf ab und verstecken ihn in der Badewanne). Ich hatte erst beim Daily Mirror in Brooklyn ordentlich geklotzt und war dann zu Associated Press gewechselt. Ich hatte eine kleine Wohnung mit handtellergroßem Fenster und Etagenklo. Ich besaß eine Bratpfanne, zwei Teller und zwei Kaffeebecher. Meine Freunde waren Zeitungsleute, meine Freundinnen oft Korrektorinnen (scharfer Verstand, sanftes Wesen), und ich war, was man eine Reporterin nannte. Meine Artikel erschienen unter meinem Namen, und alle wussten, dass ich nicht über Hochzeiten berichtete. Es lief gut.
Die Männer spendierten mir Drinks, und ich gab jeden Abend eine Runde aus, bevor ich nach Hause ging. Sie redeten vor mir über ihre Frauen und ihre Geliebten, und ich zuckte nicht mit der Wimper. Rümpfte nicht die Nase. Ich nahm Anteil. Egal ob die Frau ihre Tage hatte oder die Geliebte einen Braten in der Röhre oder ob einer von ihnen vor verschlossener Tür gestanden hatte, ich sagte immer, das sei wirklich hart. Ich nippte an meinem Scotch. Ich blieb souverän und schaute freundlich. Ich sagte den Kerls nicht, dass ich genauso war wie sie, dass ich eher ein Dutzend Mädels von der falschen Sorte beschlafen und in einem Dutzend Stundenhotels ohne mein Portemonnaie, aber mit ein paar neuen Kratzern aufwachen würde, als mich an eine Frau und ein paar Bälger zu binden. Ich gab vor, zwar noch nicht den richtigen Mann gefunden zu haben, aber sehr wohl einen zu wollen. Ich gab vor, ihre Frauen zu beneiden, und das kostete mich einige Mühe.
(Ich war nie auf eine Ehefrau oder einen Ehemann neidisch gewesen – bis ich Eleanor kennenlernte. Dann allerdings hätte ich alles, was ich je an Gutem erlebt hatte, jede Limousinenfahrt, jedes Nacktbaden, jeden namentlich gekennzeichneten Artikel und jeden entspannten Spaziergang gegen das eingetauscht, was Franklin hatte, inklusive Polio und allem Drum und Dran.)
Es war der perfekte Abend, um in einer Bar in Brooklyn zu sitzen und darauf zu warten, dass es anfing zu schneien. Ich winkte nach einem weiteren Bier, und ein junger Mann von den Lokalnachrichten, stämmig und rotgesichtig wie ich, brachte es mir herüber und fragte dann: »Hick, heißt dein Vater zufällig Addison Hickok? Du kommst doch aus South Dakota?«
Ich sagte, ja, das stimme, und ja, das sei mein alter Herr.
Tut mir leid, sagte er, anscheinend hat er sich umgebracht. Es ist gerade über den Ticker gekommen, eine Welle von Selbstmorden in der Dust Bowl. Er war Handelsvertreter, oder? Tut mir leid.
Schon gut, sagte ich. Ich konnte ja schlecht sagen, ich gebe eine Lokalrunde aus, weil man Vater tot ist und ich nicht nur froh darüber bin, sondern verdammt froh. Kein Mann trinkt einer Frau zu, die so etwas sagt. Ich legte fünfzig Cent unter mein Glas und machte mich auf den Weg nach Hause, und dort empfing mich ein Brief von Miz Min, der zweiten Frau meines Vaters, in dem sie fragte, ob ich ihr Geld für die Beerdigung schicken könnte. Ich zündete den Umschlag an der Glut meiner Zigarette an und fuhr nach New Jersey.
Ich war bei Associated Press die Nummer eins in Sachen Entführung des Lindbergh-Babys. Es gab einen Wettlauf darum, wer die Story als Erstes bringen würde, und die Daily News gewann, mit einem riesigen, grobkörnigen Foto des Babys und der Schlagzeile »Lindys Baby entführt« – kurz und prägnant; die Schlagzeile der Times: »Lindbergh-Baby aus Elternhaus auf Farm nahe Princeton entführt«, war präziser, aber eben nicht die erste. Bei der Times verzichtete man auf plumpe Vertraulichkeit, aber mal ehrlich, wen kümmert es schon, ob das Baby von einer Farm oder einer Ranch oder aus einem Kleefeld geraubt wird.
Das berühmteste Baby der Welt, Charles A. Lindbergh Jr., wurde gestern Abend zwischen 19.30 und 22.30 Uhr aus seinem Kinderbettchen im Erdgeschoss seines Elternhauses in Hopewell, N.J., geraubt.
Anne Morrow Lindbergh, die Frau des auch als Lone Eagle (Einsamer Adler) bekannten Piloten, entdeckte um 22.30 Uhr, dass ihr 20 Monate alter Sohn nicht mehr da war. Ihre Mutter, Mrs Dwight W. Morrow, die bei dieser Gelegenheit bekannt gab, dass Mrs Lindbergh ihr zweites Kind erwartet, befürchtet, der Schock könnte ernste Folgen haben.
Anne rief sofort Col. Lindbergh herbei, der im Wohnzimmer saß. Da er dachte, das Kindermädchen habe das Kind vielleicht aus dem Bett genommen, stellte der berühmte Pilot zunächst selber Nachforschungen an, ehe er die Polizei benachrichtigte.
So schnell über Radio, Telefon und Telegraf Alarm geschlagen werden konnte, begann die größte polizeiliche Suchaktion aller Zeiten.
Siebzig Polizisten aus Morristown, Trenton, Somerville und Lambertsville sprangen auf ihre Motorräder und in ihre Autos und rasten los, um in einem Umkreis von hundert Meilen rund um Princeton, das zehn Meilen westlich des Lindberghschen Wohnsitzes liegt, das Land zu durchkämmen.
Bis Mitternacht war die Suchmeldung per Fernschreiber in insgesamt fünf Staaten verbreitet worden. Der New Yorker Polizeichef Edward P. Mulrooney, der von der Nachricht aus dem Schlaf gerissen wurde, übernahm höchstpersönlich die Leitung der Suchaktion in New York City, die sich auch auf Fähren, Tunnel und Brücken erstreckte. In Pennsylvania, Delaware und Connecticut warf die Polizei ebenfalls ihre Netze aus.
Das Baby der Lindberghs, das von seinem Kindermädchen für die Nacht umgezogen und zu Bett gebracht worden war, lag schlafend in seinem Kinderzimmer im Erdgeschoss des Landhauses, als es geraubt wurde. Der oder die Entführer stiegen offenbar durch ein Fenster ein und brachten das Kind auf diesem Weg auch aus dem Haus.
Im ersten Stock des Hauses wurde eine Nachricht unbekannten Inhalts gefunden. Ob es sich um eine Lösegeldforderung handelt, war nicht zu erfahren – allerdings gibt es einige Stimmen, die das für wahrscheinlich halten.
So ging es noch über mehrere Spalten weiter, der Nachbar mit dem grünen Auto (der absolut nichts mit der Sache zu tun hatte) wurde ebenso erwähnt wie die liebevolle und spielerische Meinungsverschiedenheit, die es anscheinend zwischen den Lindberghs gegeben hatte, als es darum gegangen war, wie das Baby heißen soll, und durch deren rührselige Darstellung (Wie wollen wir den kleinen Adler nennen?) das Ausmaß der so wahrscheinlichen wie unwiderstehlichen Tragödie noch besonders hervorgehoben wurde.
Ich rutschte im schmutzigen Schnee von New Jersey herum, hielt nach Fußspuren Ausschau und war zufrieden wie eine Rose in der Sonne. Tag für Tag erschienen Artikel unter meinem Namen. Morgen für Morgen kroch ich aus meinem armseligen Motelbett und sang, während ich mich anzog. Wo immer ich hinging, hatte ich Doughnuts, Zigaretten und dreckige Witze im Gepäck, und als man in Hopewell, New Jersey, Reportern den Zugang verwehrte, war ich nicht unter ihnen. Ich saß in einem eiskalten Zimmer mit Mantel und Hut an der Schreibmaschine, schrieb einen Artikel nach dem anderen herunter, folgte einem Hinweis nach dem anderen. Es war besser als jede Radioserie. Dreizehn Erpresserbriefe und eine Reihe verrückter Charaktere, darunter John Condon, Direktor einer Highschool, der aus dem Nichts auftauchte und sich als Vermittler zwischen Lindbergh und den Entführern anbot. John Condon wirkte seriös, bescheiden, tief bekümmert und war, würde ich sagen, der beste Hochstapler, den ich je erlebt habe. Niemand von uns fand heraus, was er letztlich im Sinn hatte. Wäre der arme Richard Hauptmann, der Entführer, so clever gewesen wie John Condon, wäre er nicht auf dem elektrischen Stuhl gelandet. Und wäre der arme Richard Hauptmann kein Deutscher gewesen, hätte ihm die Presse nicht den Spitznamen »Bruno« verpasst und wir hätten nicht so tun müssen, als wären die beiden Augenzeugen, die gegen ihn aussagten, irgendetwas anderes als blind und pleite. Ich konnte schreiben, was ich wollte, konnte jeden noch so abwegigen Hinweis aufgreifen (ein Fetzen blauen Stoffs in Maryland, ein geheimnisvoller Mann in Rhode Island), solange der Kern der Geschichte unangetastet blieb: Amerikanischer Held und seine Frau suchen vermisstes Baby.
Insofern wir die Polizei, J. Edgar Hoover und das FBI der Korruption und schlichten Verzweiflung verdächtigten, behielten wir das für uns. Lindbergh war unberührbar. (Wen kümmerten schon seine »America First«-Reden, in denen er den Juden die Schuld am Antisemitismus gab. Wen kümmerte es, dass sein berühmtes jungenhaftes Lächeln aufstrahlte, als er 1938 in Berlin von Göring den Verdienstorden vom Deutschen Adler verliehen bekam, mit den besten Wünschen von Hitler. Wen vor allem kümmerte es, dass Lucky Lindy sein Baby ganze vier Monate vor der Entführung selbst in einem Wäscheschrank versteckt hatte, während Anne Morrow Lindbergh, seine Frau, hysterisch weinend das ganze Haus absuchte. Bis er ihr das Baby überreichte. Was für ein Spaßvogel.)
Ich war überzeugt, dass Lindbergh John Condon angeheuert hatte. Ich glaubte, Lindbergh habe das Baby aus Versehen umgebracht und versuche das nun mit der Verwegenheit und Präzision, für die er bekannt war, zu vertuschen. Und als das arme Kind, bereits am Verwesen, schließlich vier Meilen vom Haus entfernt mit eingeschlagenem Schädel gefunden wurde, hatte der arme Deutsche Richard Hauptmann keine Chance.
Ich schrieb nicht die Story, die ich eigentlich schreiben wollte, und alle wussten es. Steck’s auf, sagte mein Chef zu mir. Berichte zur Abwechslung mal über Eleanor Roosevelt, ihr Alter ist auf dem Weg ins Weiße Haus. Ich sagte nicht nein. Albany war ein Kaff und Eleanor Roosevelt womöglich nett und langweilig, so erzählte man sich jedenfalls, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie nicht ihr eigenes Kind umgebracht und einen Unschuldigen dafür auf den elektrischen Stuhl befördert hatte.
Nett und langweilig war sie in den ersten fünf Minuten. Ich saß direkt neben ihr in einem verblichenen Samtsessel im altmodischen Salon der Gouverneursvilla in der Eagle Street, betrachtete ihr billiges, zweckmäßiges Sergekleid und ihre flachen Schuhe und dachte: Wer um alles in der Welt hat dir die Kleider ausgesucht? Ich schaute genau hin, um mir Notizen machen zu können, und dann schaute ich weg, um höflich zu sein. Sie schenkte uns Tee ein, und ich nahm sehr wohl ihre schönen Hände wahr und den sehr schlichten Ehering, der etwas locker am Finger saß. Wir plauderten. Wir nippten. Ich machte ein paar Bemerkungen über die Republikaner, und sie lachte, und zwar nicht nur aus Höflichkeit.
Sie fragte mich nach dem Fall Lindbergh, ich schilderte ihr meine Einschätzung, und sie schüttelte den Kopf über Lindbergh. Ich ziehe Amelia Earhart vor, sagte sie. Sie war Sozialarbeiterin, bevor sie Pilotin wurde, wissen Sie? Nicht nur das, dachte ich, aß dann aber doch lieber ein Plätzchen.
Wir unterhielten uns über den großartigen Staat New York und darüber, was seine Einwohner brauchten, und dann war es Zeit fürs Abendessen, und es gab eine mit Sherry verfeinerte Pilzsuppe, die ich heute noch schmecke. Wir aßen und unterhielten uns bis spät abends. Sie erzählte mir, ihr Mann sei der Ansicht, dass es die Aufgabe der Regierung sei, den