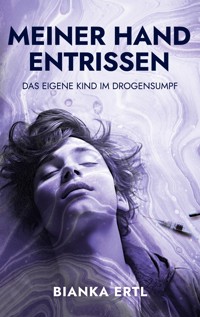
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ben verfällt im jugendlichen Alter erst den leichten dann den harten Drogen. Wie quälend und schmerzhaft das Leben dann für die Mutter, die ganze Familie ist, ist kaum zu erahnen. Wie geht man mit der Situation um? Ein langer Weg inmitten eines Drogenalltags werden für alle zur Belastungsprobe und rauben die letzten Kräfte. Der lange Kampf gegen die Sucht beinhaltet kaum lösbare Probleme und nicht endende und immer wiederkehrende Hürden die man bewälltigen muss oder man zieht die Reißleine für sich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vier Kinder habe ich mit viel Liebe großgezogen. Nun ist das erste Kind erwachsen, sollte man meinen, da schlägt das Schicksal böse zu. Ich muss mir eingestehen, dass mein Sohn schwerstabhängig ist und an der Nadel hängt. Ich sehe zu, wie er jeden Tag ein bisschen mehr stirbt. Für eine Mutter ist das nicht zu ertragen.
Wie hält man es aus – seelisch und körperlich? Einfach gar nicht. Es gibt viele Ratgeber dafür, wie Eltern mit der Situation umgehen können, wenn ihr Kind drogensüchtig ist. Aber jeder fühlt individuell und handelt dementsprechend. Wir lernen, mit dem Gefühl der Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, mit Stimmungsschwankungen und Trauer umzugehen. Auch Todesängste kommen hinzu. Es ist unbeschreiblich, was man als Mutter aushalten muss, sich jeden Tag zu fragen: Lebt das eigene Kind noch? Liegt es vielleicht irgendwo draußen im Dreck zwischen Drogenabhängigen an irgendeinem Drogenumschlagplatz? Diese Angst im Nacken, dass der nächste Schuss mein Kind umbringt! Jede Mutter geht mit diesem Schicksalsschlag anders um. Letztlich handeln wir in erster Linie aus dem Bauch heraus. Eben weil wir unser Kind lieben. Dabei macht man viele Dinge falsch. Im Moment meint man aber, es wäre das Richtige. Dieser Zustand kann viele Jahre andauern. Es kommt darauf an, wie stark, wie konsequent man dem Kind gegenüber ist. Versteht man als Mutter erst einmal, dass die einzige Hilfe für abhängige Kinder die Hilfe zur Selbsthilfe ist, dann hat man schon einiges verstanden.
Wenn man erfährt, dass das Kind Drogen konsumiert, überschlagen sich die Gedanken. Der erste klare Gedanke ist, dass das Kind abstürzen kann. Der Verlauf ist meist so, dass man als Mutter versucht, das Kind zu überzeugen, wie falsch der Weg ist, den es geht, die Gefahren aufzählt und den Weg zur Drogenberatung wählt. Wenn man dann merkt, dass die Sucht schon vom Kind Besitz ergriffen hat, tut man alles, was in seiner Macht steht, um den Verfall aufzuhalten, offene Rechnungen, Strafen oder einfach das Chaos im Leben des Süchtigen zu verringern. Diese Dinge wiederholen sich kontinuierlich. Irgendwann kommt man an seine Grenzen. Man selbst ist nicht direkt betroffen und rutscht trotzdem mit in den Sumpf. Das nennt man Co-Abhängigkeit. Das Kind ist von der Mutter abhängig, weil es es vermeintlich nicht mehr schafft, einfache Dinge zu bewältigen. Als Mutter übernimmt man die Aufgaben des Kindes, weil man nicht möchte, dass es noch weiter bergab geht. Somit verlieren die Suchtkranken Eigenverantwortung.
Das Handeln der Mutter ist nachzuvollziehen, weil sie sich Selbstvorwürfe macht und versucht, die Sache auf diesem Wege gutzumachen. Auch erhofft man sich vom Kind eine Art Dankbarkeit und somit auch, dass der Süchtige selbst wünscht, clean zu werden. Man versteht noch nicht, dass man das Suchtverhalten verstärkt. Warum soll man was ändern? Läuft doch alles gut! Irgendwann – womöglich nach Jahren – wird die Kraft deutlich weniger, der eigene Körper streikt. Es gibt starke Anzeichen, dass man mehr auf sich achten sollte. Dann ist es so weit, für sich selbst die Reißleine zu ziehen. Das macht man aus Selbstschutz, weil man einfach nicht mehr kann. Der Sumpf aus Abhängigkeit, Chaos, Vorwürfen sowie psychischen Erkrankungen und Begleiterscheinungen, die eine Sucht mit sich trägt, ist für eine Mutter unzumutbar. Das letzte Mittel ist dann oft eine Kontaktsperre.
Im Mai 1993 war ich 24 Jahre alt und erfuhr von meiner Schwangerschaft. Mein Leben lief bis dahin zwar turbulent, aber ich freute mich wahnsinnig über die Nachricht, dass ich ein Baby bekam. Die damalige Beziehung war nicht harmonisch und ich merkte während der Schwangerschaft, dass mein Partner eine psychische Erkrankung hatte. Er log mich ständig an. Auch über banale Dinge log er. Viele Sachen konnte ich nicht nachvollziehen.
Es gab immer häufiger Streit. Eines Tages fand ich beim Ordnen der Papiere einen Krankenhausbericht der Landesklinik, dass er unter einer Schizophrenie litt. Er versicherte mir, dass er als Maler arbeitete, aber er verbrachte die Tage bei seinen Kumpels. Er lieh sich ständig von Leuten Geld, um zusammen mit seinem Arbeitslosengeld über die Runden zu kommen. Das alles erfuhr ich durch Zufall. Während ich den ganzen Tag arbeitete, war ich im Glauben, dass er das Gleiche tat.
Zum Ende meiner Schwangerschaft war mir klar: Es musste etwas passieren, damit das Baby ein vernünftiges Zuhause bekam! Nach einem großen Streit trennte sich mein damaliger Freund von mir. Das war fünf Wochen vor der Geburt des Kindes. Die Trennung war unsauber, da wir erst kurz zuvor eine neue Wohnung bezogen hatten. Aus Wut auf mich und das Baby schloss er alle Sachen, die ich gekauft hatte, in ein Zimmer und nahm den Schlüssel mit. In dem Raum befand sich auch ein Kinderwagen und das komplette Babyzimmer, das ich mir von meinem Lohn als Zahnarzthelferin erspart hatte. Er trug nichts dazu bei, für das Baby vorzusorgen. Nach Absprache kam meine Schwester Barbara mich besuchen. Wir öffneten mit Gewalt die Tür, schleppten die komplette Ausstattung ins Auto und fuhren zu meiner Mutter. Emotional ging es mir ab da sehr schlecht und die Seifenblase Mutter/Vater/Kind zerplatzte.
Ich stand lange vor meinen Wunschkinderwagen, der sich bei meiner Mutter in meinem alten Kinderzimmer befand. Ich stellte mir vor, dass in wenigen Wochen mein geliebtes Baby in diesem Wagen lag. Der Kinderwagen war besonders – dunkelblau mit vielen kleinen weißen Streublümchen und weißer Spitze. Er kostete ein Vermögen, aber er musste es einfach sein. Die Zeit bis zur Geburt und danach wohnte ich wieder zuhause bei Mama. Wohnungslos, ohne Geld und ohne Möbel. Einzig für das Baby war alles da. Meine Mutter an meiner Seite wirkte sehr beruhigend für mich, denn sie versuchte, mir Mut zu machen. Trotzdem verfiel ich in tiefe Depressionen. Ich saß den ganzen Tag auf der Couch und löste Kreuzworträtsel. Gesprochen habe ich fast gar nicht mehr. Tief in Gedanken versunken dachte ich mit Angst an meine Zukunft. Wie sollte es weitergehen? Nun begann der Kampf, ein Zimmer für mich und mein Baby zu suchen. Meine starken Wehen vor der Geburt meisterte ich zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester Barbara. Sie war es auch, die mir die Hand hielt, während ich mein erstes Kind zur Welt brachte. Gesund strahlte mich mein Sohn an. Von da an war er mein Lebensinhalt.
Während der Geburt bekam ich eine starke Erkältung mit Kehlkopfentzündung. Ich konnte nicht mehr sprechen und musste alles aufschreiben. Die Ärzte versicherten mir, dass ich trotzdem stillen konnte, da das Baby noch die Abwehrkräfte von mir in sich trug. Leider erkrankte Ben mit zwei Wochen so stark an einer Bronchitis, dass wir stationär ins Krankenhaus mussten und er mit Cortison behandelt wurde. Ihm ging es Tag für Tag etwas besser. Meine Mutter hatte ihn zuvor vor dem Ersticken gerettet. Sie ging zufällig zu seinem Stubenwagen und sah, dass Ben dunkelblau war und heftig nach Luft schnappte. Geistesgegenwärtig hob sie ihn kopfüber an den Beinen hoch und klopfte seinen Rücken. Das war das Beste, was sie tun konnte, denn er bekam wieder Farbe und atmete wieder. Ben war generell ein ausgesprochen unruhiges Baby. Er schreckte im Schlaf sehr oft auf. Ich weiß nicht, wie oft ich an seinem Bettchen stand und ihn beruhigte.
Heute glaube ich, dass die Unruhe meines Babys, die er im Laufe der Zeit immer mehr an den Tag legte, Auswirkungen meiner psychischen Verfassung während meiner Schwangerschaft war.
Mein Sohn war fünf Wochen alt, als ich eine kleine Wohnung fand. Meine Depressionen bekam ich etwas in den Griff und richtete mit Hilfe meiner Familie die Wohnung ein. Das erste Zuhause nach meinem Elternhaus! Ich fühlte mich sehr wohl dort. Wir hatten es gemütlich und aus heutiger Sicht war es schönste Zeit, die ich je hatte: die Zeit allein mit meinem Baby.
Ben war gesundheitlich immer wieder sehr anfällig und ich war immer an seiner Seite. Wir waren sehr oft bei Ärzten, die feststellten, dass Bens Schwachstelle seine Ohren waren. Wir hatten unzählige schlaflose Nächte mit Rotlicht und Medikamenten. Eines Tages bekam ich Post vom Gericht, worin ich aufgefordert wurde, Ben Blut abnehmen zu lassen. Der Kindsvater, der Ben nie kennengelernt hatte, zweifelte an der Vaterschaft. Somit folgten wir der Aufforderung des Gerichtes. Danach bestand kein Zweifel mehr an der Vaterschaft. Seine Familie und er hatten niemals Interesse, das Kind zu sehen. Auch Bens leibliche Oma interessierte sich nicht für ihren Enkel. Aber es war okay für mich, denn meine Mutter und mein Stiefvater waren die besten Großeltern, die ein Kind nur haben konnte. Oma und Opa unterstützten mich voll und ganz, sodass ich wieder arbeiten gehen konnte. Ich putzte in der Nacht Großraumbüros, putzte Altenheime, frisierte Freunde und arbeite dann langfristig im Autohandel. Ich tat, was möglich war, um ein normales Leben für uns beide zu finanzieren.
Mir war es wichtig, Mutter und Vater zugleich zu sein. Er wurde getauft und ich ermöglichte uns im Laufe der Zeit Ausflüge, Urlaube und gemeinsame Unternehmungen. Alles lief rund, wir genossen unsere gemeinsame Zeit. Es war eine wunderschöne Zeit ohne große Sorgen und mit viel Liebe.
Ben besuchte den Kindergarten und war ein liebes Kind, aber er hatte schon seine Eigenarten. Er putzte mit der Toilettenbürste die Fenster, spielte immer nur mit einer einzigen Sache und konzentrierte sich immer nur auf einen Freund. Es war ihm nicht möglich, sich auf mehrere Kinder einzulassen. Ich merkte sehr schnell, wie intelligent er war. Mit drei Jahren konnte er an Autofelgen erkennen, welches Auto dazugehörte. Er erkannte nicht die Automarke, sondern auch den jeweiligen Typ. Es war dann nicht nur der Honda, sondern auch der Civic. Das lernte er dann auch mit Autoschlüsseln. Es gab kaum ein Auto, das er nicht zuordnen konnte. Über alles, was ihn interessierte, wusste er die Details.
Die Schulzeit begann und damit kamen auch die Probleme. Ich habe noch Fotos, auf denen man sieht, wie traurig Ben damals schaute. Es gab kein einziges Foto, auf dem er lächelte. In seinem Blick sah man eine große Unsicherheit und Angst. Er ging nicht gern in die Schule. Am liebsten wäre er im Kindergarten geblieben, da war er glücklich. Ben kämpfte mit Wahrnehmungsstörungen und Sozialphobien. Er fand keine Freunde, lief sehr traurig durch die Welt. Dadurch war er auch im Unterricht geistig abwesend. In der Freizeit spielte für sich allein und mir brach das Herz. Zu Hause war sein Verhalten sehr auffällig geworden. Er lief über Tische und Bänke, an normales Familienleben war gar nicht zu denken. Ben hatte Interesse an Fußball und ich meldete ihn in einem Fußballverein an. Er ging regelmäßig hin. Ich hoffte, dass er endlich Freunde fand. Leider ergaben sich auch dort keine Freundschaften. Ich als Mutter versuchte, ihm in jeder Situation beizustehen, konnte aber die schulischen Probleme nicht mehr auffangen und suchte aufgrund der ganzen Schwierigkeiten einen versierten Schulpsychologen auf.
Ein halbes Jahr wurde er auf den Kopf gestellt. Unzählige Tests wurden durchgeführt und ausgewertet. Die Diagnose war ADHS. Es gab leider keine Zweifel. Das musste ich erst einmal sacken lassen und erkundigte mich ganz akribisch über diese Krankheit. Es folgten lange Gespräche mit dem Psychologen. Er sah in jedem Fall die Notwendigkeit zu einer Familientherapie und gleichzeitiger medikamentöser Behandlung. Große Sorgen standen im Raum. Ich bekam Druck von der Lehrerin. Es fiel mir so schwer, ihm seine erstes Ritalin zu geben. Ich stand mit meiner Mutter in der Küche und zögerte den Moment hinaus. Er war sieben Jahre alt. Mein Kind brauchte das Medikament, um in unserer »normalen« Struktur bestehen zu können. Das deutsche Schulsystem wollte Kinder, die funktionieren. Mein Sohn funktionierte nicht. Lehrerin und Arzt rieten mir dringend, ihn behandeln zu lassen, damit er eine Zukunft hatte. Auch für uns zuhause wäre es wichtig, um ein »normales« Familienleben führen zu können. Zum damaligen Zeitpunkt dachte ich, ich mache das Richtige, aber mit der Erfahrung von heute würde ich es nie wieder tun. Damals hatte ich keine Wahl. Der Doktor sagte, es gäbe keine andere Möglichkeit. Bei der Aufklärung berichtete er mir, dass Menschen, die in der Kindheit ADHS hatten und medikamentös behandelt wurden, im Jugendalter öfter zum Joint griffen. Im Alter von 14 bis 16 Jahren würde man das Medikament ausschleichen. Bekomme der Kranke keinen Wirkstoff mehr, versuche er, eine Alternative zum Beruhigen zu finden. Oft sei diese »Ersatzdroge« das Marihuana. Ich habe die Information gedanklich zwar aufgenommen, aber von mir weggeschoben. Es war ja bis dahin viel Zeit und es konnte auch noch viel passieren.
Zu Beginn der Medikation blühte Ben auf. Er hatte Freunde gefunden, war kein Außenseiter mehr in der Schule und der erste Elternsprechtag nach der Medikamenteneinnahme bestätigte mir, dass es das Richtige war, was ich tat. Ich ging vor Erleichterung weinend aus der Klasse. Zu Hause spielte sich allmählich auch etwas Normalität ein. Man konnte wieder vernünftig miteinander umgehen und anständige Gespräche führen. Als Ben fünf Jahre als war, lernte ich einen Mann kennen. Zum ersten Mal seit der Zeit vor meiner Schwangerschaft hatte ich wieder ein Partner. Da mein Sohn und ich ein eingespieltes Team waren, habe ich Ben meinem neuen Freund erst nach einem halben Jahr vorgestellt. Ich wollte erst schauen, ob es etwas Festes wurde. Ben war elf Jahre alt, als ich erneut schwanger wurde. Für mich war es ein Herzenswunsch. Ich wollte nie, dass Ben ein Einzelkind blieb. Ich liebte Kinder und wollte immer eine größere Familie. Für Ben war es ein sehr schwerer Abschnitt in seinem Leben. Er wehrte sich heftig gegen die Veränderung. Er wollte mich nicht teilen und hatte das Gefühl, durch meinen Partner nicht mehr ganz dazuzugehören. Er war eben nicht sein leiblicher Vater.





























