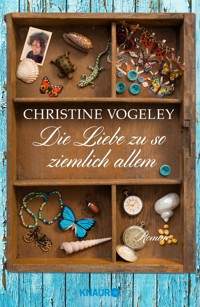6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kaum zu glauben, dass sie dieselbe Mutter haben: die übergewichtige Jeannette mit der wundervollen Stimme und die bildschöne, aber kaltherzige Susanna. Das Leben bietet beiden eine Chance zur Veränderung: Wer hätte je gedacht, dass Jeannette ausgerechnet in einem Melonenkostüm ein riesiges Publikum zu Standing Ovations hinreißen würde? Als sich Susanna in den attraktiven Italiener Dario verliebt, scheint das Glück perfekt. Doch die kriminelle Tat eines alten verwirrten Mannes gefährdet das neue Familienidyll…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christine Vogeley
Melonentango
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kaum zu glauben, dass sie dieselbe Mutter haben: die übergewichtige Jeannette mit der wundervollen Stimme und die bildschöne, aber kaltherzige Susanna. Das Leben bietet beiden eine Chance zur Veränderung: Wer hätte je gedacht, dass Jeannette ausgerechnet in einem Melonenkostüm ein riesiges Publikum zu Standing Ovations hinreißen würde? Als sich Susanna in den attraktiven Italiener Dario verliebt, scheint das Glück perfekt. Doch die kriminelle Tat eines alten verwirrten Mannes gefährdet das neue Familienidyll …
Inhaltsübersicht
Liebe Leserin, lieber Leser!
In Mechenbach und Perugia
Zu Hause
In Köln
Ungewöhnliches
Mitten ins Herz
Die neue Heulsuse
Jede Menge Aussichten
Theater, experimentell und traditionell
Spiegelspiele
Upper Shellsands
Na endlich
Köln–Yorkshire–Köln
Knochenbruch und Flitterwochen
Später Gast
Theaterluft
Noch mehr Theater
… aber nur beinahe
Beton
Drama
Drama zweiter Teil
Zerbrochener Teller
Einige Premieren
Liebe Leserin, lieber Leser!
Als mein Verlag sich netterweise dazu entschloss, meinen Roman »Leni, Susanna und Molly Melone« aus dem Jahr 2000 unter dem Titel »Melonentango« neu zu veröffentlichen, dachte ich, das sei doch eigentlich eine gute Gelegenheit, den Roman noch mal richtig zu lesen. Das tat ich dann auch. Dabei fiel mir eine Stelle auf.
An dieser Stelle sagt Dario, Italiener und wichtigster Mann in der Geschichte: »Wir Italiener haben zwar die dreiundfünfzigste Nachkriegsregierung, aber …«
Das konnte man nicht so stehen lassen, das musste aktualisiert werden. Auch deshalb, weil es Regierungen gibt, die Dario und ich erleichtert zur Vergangenheit zählen. Dann habe ich noch hier ein Stückchen rundgefeilt und da ein paar Ornamente begradigt, kurz und gut, aus der kleinen Laubsägearbeit wurde eine größere Baustelle, obwohl man in der Belletristik eigentlich eher selten überarbeitet.
Meine Sprache hat sich im Laufe der letzten Jahre ziemlich geändert. Ich auch übrigens, aber kein Wunder, wir leben ja schließlich zusammen. Die Geschichte an sich ist geblieben. Ich würde sie heute anders erzählen, aber sie ist eine Reise in die eigene Vergangenheit, und ich mag sie so gerne wie vorher.
Geändert habe ich vor allem Stilistisches. Zwischendurch habe ich mich mit den Romanfiguren zusammengesetzt und sie gefragt, ob sie noch etwas zu sagen hätten. Das hatten sie. Sie haben mir eine Menge Dinge erzählt, die ich beim ersten Mal nicht aufgeschrieben habe. Jetzt sind sie drin. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen,
Ihre Christine Vogeley
In Mechenbach und Perugia
Dario zündete sich eine Zigarette an und starrte zum Fenster hinaus. Er gehörte nicht zu den Menschen, die lange über einen Fehler nachdenken, aber das hier – mamma mia –, das war einer gewesen.
Zu Hause, in Perugia, blickte er von seiner Dachterrasse auf das mittelalterliche Gewimmel charaktervoller Häuser, auf filigrane Marmorsäulen, auf den heiteren Platz vor dem Palazzo dei Priori und auf den schönsten Brunnen der Welt.
Den Ausblick dieser Dachwohnung in der Via Calderini hatte er gegen die Ansicht des Bahnhofsvorplatzes von Mechenbach getauscht. Und nicht nur das. Wenn hier jemand hupte, meinte er es ernst. Alles war breiter, die Kaffeetassen, die Menschen, die Schuhe. Das Wetter und die Mädchen waren kühler. Niemand flanierte abends zur »Passeggiata« in seinen besten Kleidern über den Mechenbacher Marktplatz. Niemand umkreiste ihn lachend und kreischend auf seiner Vespa: »Ehi, Dario, come stai?« Und die holländischen Tomaten, die er hier in Mechenbach mit Basilikum und Mozzarella servierte, schmeckten vermutlich wie feuchtrosa Schwammtuch. Er rührte sie nicht an.
Unter seinen Kunden liebte er besonders einige deutsche Frohnaturen, die sich welterfahren und weitgereist gaben: »He, Sinjore, die Tackliatelle al dente un avanti, klar?«
Aber wie überall, es gab auch andere. Seine Nachbarin Frau Siegel, zum Beispiel. Und deren rechte Hand Leni Schmitz. Darios Onkel bestand auf frischen Blumen für sein Lokal, und deshalb hatte Dario die Aufgabe, alle paar Tage Tulpen, Chrysanthemen oder sonstige Saisonblüten in Frau Siegels Blumenladen abzuholen.
Dario lächelte sein spezielles Lächeln, mit dem sogar im verregneten Mechenbach unmittelbar die Sonne aufging. Er erkundigte sich nach dem Namen jeder einzelnen Schnittblume, lobte Adelheid Siegels Haarfarbe, befühlte mit Kennermiene Lenis indianische Türkisohrringe, von denen sie etwa siebzig Modelle besaß, und hatte bereits nach dem ersten Besuch Freundinnen fürs Leben gewonnen. Dario war jetzt seit acht Wochen hier, hatte einige ländliche Herzen gebrochen, seinen halben Lohn nach Italien vertelefoniert und konnte sich kaum verzeihen, dass er zu faul gewesen war nachzuschauen, wo Mechenbach eigentlich lag.
»Na gut, wenn du unbedingt ins Ausland willst … dann gehst du eben nach Köln zu Enzo und Gianna, mein Junge«, hatte der Vater gesagt. »Einmal ist das gut der Sprache wegen – ja, ich weiß, du sprichst gut deutsch, aber dann kannst du später noch besser mit den vielen germanischen Touristen umgehen – außerdem sollte ein junger Mann, der in der Hotelbranche arbeitet, unbedingt Auslandserfahrungen haben.« Er machte eine große Geste. »Du bist hier in ein paar Jahren der Chef, vergiss das nicht.«
»Das hast du mir vor ein paar Jahren auch schon gesagt, Papa. Wahrscheinlich wirst du es mir in ein paar Jahren wieder sagen.«
Ettore Mazzini hob beide Hände und sagte mit gespieltem Bedauern: »Mit neunundzwanzig Jahren kann man noch kein Hotel leiten. Das ist zu jung. Viel zu jung. Geh mal nach Deutschland und lerne noch etwas. Wenn du wieder hier bist, sehen wir weiter.«
»Hier«, das war sein Traditionshotel Stella di Perugia, etwas abseits des Touristenstromes am Hang gelegen, mit Blick auf die umbrische Weinlandschaft.
Das Hotel war für Darios Begriffe renovierungsbedürftig. Die Bausubstanz war solide und würde es auch noch weitere hundert Jahre sein, aber die Tapeten waren verblasst und die Wasserhähne vom vielen Polieren stumpf geworden. Die Kacheln in den Bädern gehörten zu der Sorte, die mit dem Alter nicht gewinnen, aber Küche und Atmosphäre konnten ihresgleichen immer noch suchen.
Es gab einige Engländer, die das Haus seit dreißig Jahren frequentierten. Sie liebten es, abends unter der Fächerpalme im Innenhof einen Limonenlikör zu trinken und sich an den asthmatischen Putten des Springbrunnens zu erfreuen, die sein Wasser unregelmäßig ausspuckten. So wie man in England sagt: »Eine Spinne ist ein Zeichen für ein trockenes Haus«, konnte man im Stella behaupten, dass die alten Engländer ein Zeichen für ein gemütliches Hotel waren.
Dario liebte das Hotel. Er hatte mit seinem Vater viele Konflikte ausgestanden, Mädchen, Alkohol, Haarschnitt und Politik, das ganze Repertoire also. Aber niemals zweifelte Dario daran, dass er das Hotel übernehmen würde. Es war für ihn ein lebendiger Organismus, zu dem er einfach gehörte.
Als er klein war, spielte er mit seinen Freunden im modrigen Weinkeller oder in der verwirrend organisierten Küche, klaute Süßigkeiten oder goldverpackte Hotelseife, um sie in der Schule gegen andere Schätze einzutauschen. Er kannte jeden Kellner, war mit der Lebensgeschichte der legendären Küchenchefin Bruna vertraut und ließ sich von den zwei hauptamtlichen Zimmermädchen Graziella und Alessia bemuttern.
Die rundlichen Damen versuchten, dem kleinen Dario die Mutter zu ersetzen. Die seltsam unbekannte Mutter, über die der Vater nie sprach, nach der man nie fragen durfte. Ihr Bild war sehr blass. Dario konnte sich eigentlich nur an helle Haare erinnern, an einen schwachen Duft. Auch Geschichten von Prinzen, Drachen, dem Teufel und der schönen Biancaneve, dem italienischen Schneewittchen, waren undeutlich mit ihrem Bild verwoben.
»Mit einem französischen Professor, ich bitte dich!« Die Zimmermädchen wechselten die Bettwäsche in der Suite, und der kleine Dario versteckte sich hinter einem Vorhang.
»Ach, Alessia, was willst du? Du hast sie doch auch gekannt. Sie war schön, weißt du, blond, aus Mailand.«
»Ha! Mailand! Die hab ich sowieso gefressen! Typisch ihr aus dem Norden.«
Alles, was oberhalb von Messina lag, war für Alessia »der Norden«. Alessia stammte aus Palermo. Sie schlug mit der Handkante wütend einen exakten Knick in die beiden steifen Kissen, die nun wie spitze Kirchtürme aus dem frisch bezogenen Ehebett ragten. »Keine Sizilianerin würde ihr Kind im Stich lassen, auch noch wegen einem Mann!«
»Also ich …«, Graziellas Stimme wurde leiser, »… ich möchte nicht mit dem Chef verheiratet sein. Dieser Diktator … ich kann sie verstehen, ein bisschen jedenfalls.«
Alessia schnaubte verächtlich, schloss mit einem Knall die Balkontür, zog die Vorhänge zu, entdeckte Dario, schimpfte ihn laut aus und stopfte ihm den Mund mit Schokolade voll.
Als er älter wurde, ließ er sich von den jüngeren Zimmermädchen anschwärmen. Sie lasen in ihren spärlichen Pausen hochromantische Fotoromane, in denen arme Mädchen immer reiche junge Männer heirateten, die auf charakterliche Qualitäten größten Wert legten. Leider legte Dario größten Wert auf lange Wimpern und lange Beine. Mit achtzehn waren charakterliche Vorzüge viel mühsamer zu entdecken als ein Reißverschluss. Trotzdem schaffte er es, dass ihm keine der hoteleigenen Verehrerinnen böse war. Er konnte, seine neueste Eroberung am Arm, an dem fetthaarigen Küchenmädchen vorbeiziehen und ihr eine Kusshand zuwerfen: »Ciao, Pina! Was für schöne Augen!« Und Pina schmolz dahin.
Nebenbei durchlief Dario eine harte Ausbildung. Er musste nach dem Willen des Vaters alles können: Kalkulation, Buchhaltung, Schuhe putzen und alles über Wein wissen. Armaturen schrubben, mit den Lieferanten um Prozente feilschen, mit dem Fremdenverkehrsverein zanken, aufgelöste Reisebegleiter beruhigen, dem Personal geschickt auf die Finger sehen, auf Englisch, Deutsch und Französisch telefonieren, perfekte Gnocchi zubereiten und einfach ständig und überall präsent sein. Nach einiger Zeit lernte Dario, sein berühmtes Lächeln hinter der Rezeption wie eine Tischlampe an- und auszuknipsen.
Natürlich war sein Vater ein Diktator. Aber Dario war gerissen. Er hatte seinem Vater in langen Auseinandersetzungen deutlich gemacht, dass er die Nachfolge nur antreten würde, wenn er eine eigene Wohnung bekäme. Dario wusste genau, dass er die Arbeit im Hotel unter der Fuchtel seines Vaters nur durchstand, wenn er sich in seiner freien Zeit vollkommen zurückziehen konnte. Der Vater war starrsinnig. Dario hatte seinen Dickschädel geerbt, nur war er eben jünger. Signor Mazzini konnte seinen Sohn anbrüllen: »Wenn ich nein sage, sage ich ›nein‹!« – und Dario schwebte eine Viertelstunde später im weißen Kellnerjackett am Büro vorbei, jonglierte ein Silbertablett mit Ramazottigläsern auf den Fingerspitzen und grinste durch den Türspalt. »Also abgemacht, Papa? Nächsten Monat ist sie frei, die Wohnung in der Via Calderini!«
»Raus!« Der bronzene Briefbeschwerer in Form einer Friedenstaube flog an Darios Kopf vorbei und hinterließ eine deutliche Kerbe in der Tür. Dario hielt dieses Spiel lange durch. Erstaunlicherweise gab Ettore Mazzini an irgendeinem kühlen Winterabend auf und kaufte die Wohnung. Wahrscheinlich war er einfach müde.
Dario verbrachte viele Stunden damit, die Wohnung so einzurichten, dass eine Frau beeindruckt war. Natürlich nicht eine Frau, sondern alle. Jedenfalls alle, die über die Schwelle traten. Eine Tür mit Drehkreuz und Zählwerk hätte sich hier gelohnt.
Nicht, dass Dario durch übertriebene Schönheit oder Muskulatur beeindruckt hätte. Wenn er jedoch mit seinen Freunden auf dem Corso Vanucci vor seinem Lieblingscafé saß, den Kopf mit den halblangen Haaren zurückwarf und lachte, war er vergleichsweise unwiderstehlich. Auf unerklärliche Art gab Dario jedem das Gefühl, der interessanteste Mensch unter Gottes Sonne zu sein. Derart aufgewertet, war ihm fast jeder freundlich gesonnen. Auf ältere Hotelgäste, namentlich Damen, wirkte er wie Fliegenleim.
»Was sagen Sie, die Glühbirne über dem Waschbecken ist kaputt? Madonna, unmöglich. Ich komme sofort. Es werde Licht«, sagte Dario, und schon konnte die Signora ihr Blondhaar wieder im Spiegel sehen. »Wieso haben Sie eigentlich eine so zarte Haut? Liegt das am englischen Regen?«
Und die hohlwangige Lady, die von ihrem Mann vor fünfzehn Jahren das letzte Kompliment gehört hatte, schwebte mit glänzenden Augen zum Fahrstuhl und betrachtete ihr Gesicht seit langer Zeit wieder freundlich im Spiegel.
Die Sache mit Mechenbach hatte sich Dario selbst eingebrockt, das musste er im Rückblick widerstrebend zugeben.
Nach seiner offiziellen Lehrzeit hatte er jahrelang den inoffiziellen Rang eines Geschäftsführers, durfte aber nicht dessen Kompetenzen ausüben. Sein Vater wollte das Heft einfach nicht aus der Hand geben. Er ahnte wohl, dass Dario ihn sonst in kürzester Zeit niederwalzen, seine Renovierungspläne und die Küchenmodernisierung realisieren und die Rezeption mit einer Staffel rotlackierter Starlets besetzen würde. Aber so weit war Mazzini senior noch nicht. Er beobachtete seinen Sohn, fand ihn oberflächlich, flatterhaft, leichtsinnig – es gab tausend Gründe, weshalb er Dario die Hotelleitung noch nicht überlassen wollte. Einen wichtigen Grund verschwieg er ihm allerdings. Er wusste, dass er auf taube Ohren gestoßen wäre. Dario, ständig ausgebremst, begann sich trotz der vielen Arbeit zu langweilen, war frustriert, unzufrieden und dachte zum ersten Mal in seinem Leben über die Tragik alternder Kronprinzen nach.
Hinter der Rezeption fühlte er sich noch am wohlsten, von dort aus konnte man wunderbar Menschen beobachten. Außerdem war der blankpolierte Mahagonitresen mit seinen venezianischen Spiegeln die ideale Kulisse für das Ein-Mann-Stück »Charming Dario«. Dario liebte Theater, als Zuschauer oder Akteur.
Irgendwann einmal hatte ihn eine Blondine über die Theke angelächelt. Sie war Reiseleiterin, großzügig und fröhlich und kam aus Colonia in Germania. Glücklicherweise hatten sie beide gleichzeitig einen ganzen Tag frei. Den verbrachten sie in seiner Dachwohnung, großzügig und fröhlich. Und leidenschaftlich. Als sie abends auf der Dachterrasse lagen und Weißwein tranken, sinnierte sie: »Wenn alle Männer in Perugia so sind wie du, will ich nicht mehr fort.«
Er drehte sich um, strich mit seiner Hand über ihren nackten Rücken und sagte: »Wenn alle Mädchen in Köln so sind wie du, will ich sofort dahin.«
Gesagt, getan. Ein Jahr Ausland konnte den Horizont nur erweitern. Wobei Dario und sein Vater dabei an sehr verschiedene Dinge dachten.
»Ich habe mit Enzo telefoniert, er freut sich.« Darios Vater klappte sein großes Telefonregister zusammen.
»Wohne ich bei ihm, oder muss ich mir eine Wohnung in Köln suchen?«
»Natürlich wohnst du bei ihm. Enzo und Gianna haben ein großes Haus und viel Platz. Es liegt nicht direkt im Zentrum, weißt du, eher so in der Nähe von Köln.«
Das war die Untertreibung des Jahrhunderts. Mit dem Auto fuhr man eine Stunde bis zum südwestlichen Kölner Zubringer, mit Bus und Bahn konnte man eigentlich nur fahren, wenn man viel Zeit sowie Schlafsack und Thermoskanne mitbrachte. Dafür war das Hotel-Ristorante Bellavista in Mechenbach konkurrenzlos. Enzo und Gianna hatten sich mit der heiligen Schnitzeldreifaltigkeit Wiener-Jäger-Zigeuner auf die ländlichen Wünsche eingestellt und buken eine sehr anständige Pizza, auf Wunsch auch zum Mitnehmen. Als Gäste des Hotels begrüßten sie vorwiegend Vertreter für Landmaschinen und Kunstdünger oder holländische Wochenendurlauber, die auf den Zimmern belegte Brote aßen und in der Mechenbacher Umgebung das nachholten, was in Utrecht oder Breda nicht möglich war, nämlich steile Waldhügel hinauf- und wieder herunterzulaufen.
Darios Tante Gianna hatte es als Doppelmutter auf dem Lande einfacher als ein fremder junger Mann, dessen Schuhwerk sich auf dem Mechenbacher Pflaster ausnahm wie ein elegantes Petit Four zwischen Schmalzbroten.
Die beiden Cousins, vierjährige Zwillinge, gingen in den Kindergarten und durchlebten ihre Analphase bereits in fließendem Deutsch mit Eifeler Akzent: »Kacke, Pisse, Hühnerklo, Dario hat ’nen Pickelpo.«
Das stimmte zwar nicht, aber die beiden Zwerge warfen sich vor Vergnügen auf den Teppich vor den stets laufenden Fernseher und lachten sich halb tot, wenn Dario sie fressen wollte. Er liebte Kinder, er respektierte seinen Onkel und fand seine Tante ganz erträglich.
Aber hier in Mechenbach kam er sich vor wie ein Silberbecher, den man aus Versehen auf eine Müllkippe geworfen hatte. Die männliche Kleinstadtjugend beachtete ihn nicht, denn er war in keinem Verein, teilte nicht ihre schlichten Freuden zwischen freiwilliger Feuerwehr und Fanfarencorps und machte sich nichts daraus, Bier aus einem Zweiliterstiefel zu trinken. In Mechenbach war er eben der Kellner aus dem Bellavista und nicht der zukünftige Chef des schönen alten Stella und eines Weingutes am Lago Trasimeno.
Und diese miefige, trübe Kleinstadt! Jetzt war noch Sommer. Was sollte werden, wenn im Winter die Tage kaum hell wurden, das Glatteis die Verbindungsstraßen zur Autobahn in gefährliche Eisschneisen verwandelte und die einzigen Farben von den bunten Glühbirnen des Friseurs gegenüber stammten? Dario hatte keine Vorstellung davon, wie eine Eifeler Kleinstadt im Winter aussah, aber Tante Gianna hatte es ihm in einem ihrer heftigen Anfälle von Heimweh nach ihrer Heimatinsel Elba erzählt.
Die großzügige Kölner Reiseleiterin war nie zu erreichen. Irgendwann hatte er eine Postkarte von ihr bekommen, mit einem Herzchen darauf und der Information, dass sie oft an ihn dächte, Gruß aus Santorini, unbekannterweise auch von Giorgios.
Eine stämmige Frau schob gerade einen Kinderwagen am Fenster des Ristorante vorbei. Eine andere junge Mutter kam ihr entgegen, beide blieben stehen, begrüßten sich, wischten ihren Bälgern die Laufnasen und begannen, Einkaufstüten auszupacken, um wechselseitig ihre Schnäppchen zu bewundern. Herrenunterhosen mit Eingriff, Damenslips mit ulkigem Aufdruck und ein Hochglanzkochbuch: »Schlemm dich schlank«.
Und das sollte jetzt noch mindestens ein Jahr lang so weitergehen.
Ob Vater gewusst hatte, wohin er ihn schickte? War es Absicht gewesen? Schliff und Weltgewandtheit, wichtige Eigenschaften zur Führung eines Hotels, bekam man hier nicht. Das stand fest. Allerdings waren das nicht unbedingt die Eigenschaften, die Dario an sich vermisste.
Aber vielleicht hatte Vater anderes im Sinn gehabt, als er ihn zu Enzo schickte? Enzo war Vaters viel jüngerer Bruder. Er baute sich mit seinem Erbteil und mit ungeheurem Fleiß ein Pizzaimperium auf. In Mechenbach gab es das Hotel-Ristorante Bellavista, in einem zwanzig Kilometer entfernten Dorf ein Eiscafé Bellavista, und jetzt bastelte Enzo jede verfügbare Minute an einer Baracke im Industriegebiet herum, dem zukünftigen Pizzataxiservice für Mechenbach und Umgebung. Vielleicht sollte Enzos Bienenfleiß auf ihn übergehen wie ein Virus?
Dario war nicht faul, nicht dumm. Aber sein Verschleiß an jungen Damen zog doch beträchtliche Energien von ihm ab, das war dem Erblasser des Hotels Stella di Perugia nicht entgangen. Es kam nicht selten vor, dass Dario eilig eine schluchzende junge Dame aus der Hotelhalle zog, um ihr im Hof zwischen den Gemüsekisten, belauscht von den Küchenmädchen, zu erklären, dass sie viel zu gut für ihn sei und er natürlich das größte Schwein auf Erden. Und deshalb sei es doch eigentlich ganz günstig, dass er jetzt leider, leider eine neue Freundin habe.
Dario stand ehrlich betrübt, aber auch verständnislos vor all den Tränenfluten, die er auslösen konnte. War ihr denn nicht bewusst, dass das alles nur eine wunderbare Kurzweil gewesen war? Wer konnte denn ernsthaft den Schwur »Ich werde dir immer treu sein« auf die nächste Woche ausdehnen? Immer treu, das hieß, immer gerade jetzt! Waren denn die schönen Tage und Nächte nicht wie eine halbe Ewigkeit gewesen? Was wollte sie denn mehr?
An die gebrochenen Herzen, die Darios Weg wie leere Bonbonhüllen säumten, verlor Vater Ettore Mazzini keinen Gedanken, welche Frage. Schließlich hatte eine Frau es gewagt, ihn zu verlassen. Einen schlagenderen Beweis für die Dummheit des Weibes an sich konnte es nicht mehr geben. Nein, es war das Geld – Dario war zu großzügig –, vor allem aber der Zeitaufwand. Und der Zeitpunkt. Ettore Mazzini wollte keinen flatterhaften Junggesellen als Hotelchef. Er sehnte sich nach Enkeln. Einer musste Ettore heißen, und die anderen kleinen Jungen würden ihm hoffentlich ähnlich sehen. Dass ab und an, durch eine üble Laune der Natur, auch kleine Mädchen zur Welt kamen, verdrängte er. Jedenfalls, vervielfältigt und familiengeschichtlich abgesichert, konnte sich Mazzini senior in Ruhe auf sein Weingut konzentrieren.
Dario sollte irgendeine nette, reiche Dame aus Perugia oder Umgebung heiraten und ihr ein paar Kinder machen. Das und die Arbeit im Hotel würden ihn zur Genüge absorbieren. Wenn er dann immer noch zu viel Energien hatte, konnte er sich ja eine Geliebte nehmen, das war schließlich das Übliche. Aber dieser Kraftaufwand, den er da trieb, der sollte lieber in die Familie fließen.
Dario sah durch die Küchenanrichte, wie Tante Giannas fleckige Schürze hektisch hin und her lief. Giannas Kopf und ihre Beine konnte man nicht sehen. Rot geschrubbte Hände stellten Salatteller auf die Anrichtefläche aus Edelstahl. Ein Klingelzeichen forderte ihn zum Servieren auf.
Plötzlich verstand Dario, warum sein Vater ihn widerstandslos nach Deutschland hatte gehen lassen. Er, Dario, sollte Enzos Familienleben als Muster verinnerlichen.
Ich danke, dachte Dario. Giannas Haare standen spätabends vom Küchendunst ab wie ein Plastikhandfeger, die Kinder lagen vor dem Fernseher, der in Endlosschleife grüne Drachen oder blaue Elefanten abspulte, und Enzo fing an zu schnarchen, kaum dass sein Hinterteil mit einem Stuhl oder Sessel in Berührung gekommen war. Immerhin perfektionierte Dario sein Deutsch. Und er gewann die Erkenntnis, dass er genau so niemals leben wollte.
Zu Hause
Und du, Jeannette Schmitz, wirst dick sein, wirre Haare haben und eine Kartoffelnase. Vielleicht wirst du eine Freundin finden, niemals aber einen Mann. Dafür wirst du gesegnet sein mit immerwährendem Hunger. Auf Dosenleberwurst und Liebe.« Die Fee nahm ihren Zauberstab und wandte sich dem anderen Kinderbett zu. »Du aber, Susanna Schmitz, wirst schön sein wie der junge Morgen, vom Schicksal bevorzugt, aber geschlagen mit einem Scheißcharakter. Und ihr werdet euch hassen und bekämpfen, und ihr werdet erst im Alter von achtzehn und zweiundzwanzig Jahren voneinander erlöst werden.«
Die Fee lachte noch einmal böse, dann schürzte sie ihr nachtblaues Gewand und flog zum Fenster hinaus. Im Kinderbett, unter dem gerahmten Druck der zum Gebet gefalteten Dürerhände, lag Susanna. Löckchen umringelten das zarte Kindergesicht, sie lächelte im Traum und ahnte nicht, dass aus ihr einmal so ein Kotzbrocken werden sollte.
»Nettchen! Jeannette! Komm essään!«
Jeannette überflog den Text noch einmal, speicherte ihn und fuhr den altersschwachen Computer herunter. Sie schnupperte wie ein Kaninchen. Es roch nach gebratenen Koteletts und frischem Blumenkohl. Sie erhob sich, stieß mit ihrem breiten Hinterteil beinahe die Vase mit den Teerosen vom Beistelltisch und blickte auf die grünen Hügel vor ihrem Fenster.
Oben am Himmel kreisten zwei Raubvögel. Das Fenster war offen, sie konnte die scharfen, klaren Laute der Tiere hören. Heute Nacht hatte sie wieder geträumt, sie könne fliegen. Sie brauchte nur heftig mit den Armen auf und nieder zu rudern, dann erhob sie sich in die Luft. Zuerst ging es etwas schwerfällig, dann aber immer leichter. Sie war durch eine gotische Kathedrale ohne Dach geflogen. Nur die Fensterbögen und die Rippen des Gewölbes hatten dagestanden. Nach Sigmund Freud sollte Fliegen unter anderem angeblich auch sexuelle Bedeutung haben, aber das konnte sie sich nicht vorstellen.
Quatsch. Enormen Hunger hatte sie im Traum bekommen, auf dunkel gebackenen Mandelkuchen. Sie stellte das Radio, das die ganze Zeit im Hintergrund gedudelt hatte, lauter. Da lief einer der Oldies, bei dem sie jedes Mal eine Gänsehaut bekam: »Thank you for the Music« von Abba.
Noch verhalten sang die Frauenstimme die einleitenden Verse:
… but I have a talent
a wonderful thing
cause everyone listens
when I start to sing …
Dann kam die Lieblingsstelle. Immer wenn die Sängerin langsam ausholend auf nur einem Ton So – I – saaaaay sang und sich dann wie eine Wellenreiterin vom Refrain … thank you for the music hochtragen ließ, überrieselte es Jeannette. Für die wilde Freude, die sie manchmal beim Singen verspürte, hatte hier jemand Töne gefunden. Sie sang laut mit:
… the songs I’m singing
thanks for all the joy they’re bringing
who can live without it?
I ask in all honesty
what would life be
without a song or a dance
what are we?
So I say thank you for the music …
»Jeannette! Alles wird kalt!«
… for giving it to meeeee! Dann atmete sie noch einmal tief durch, lauschte dem Nachklang ihrer eigenen Stimme und sprang die Treppe herunter, zwei Stufen auf einmal nehmend. Jesus, roch das gut!
Der Tisch war sonntäglich gedeckt. Mama hatte das geerbte Geschirr mit dem Goldrand hervorgeholt und die Servietten mit Großmutters Monogramm steif gebügelt und zu einer Bischofsmütze gefaltet. Um den mexikanischen Kerzenleuchter war eine Efeuranke gewunden, und in einer Schale duftete ein wunderliches Arrangement aus Gräsern und Lavendel. Jeannette musste lächeln. Jedes Wochenende war der Tisch gedeckt, als käme der Bundespräsident zu Besuch.
Sie ging in die Küche. Mama stand da, hatte die Hosenbeine etwas hochgekrempelt, trug ein T-Shirt mit einem arg gerupften Paillettentiger darauf und hatte die roten Haare mit einem Tuch zurückgebunden. Eine Eichelhäherfeder, deren Kiel in einer Silberperle steckte, schmückte Mamas rechtes Ohr. Ihre Füße steckten in Wollsocken. Sie streute gerade Petersilie auf die Suppe, hielt inne und betrachtete Jeannette.
»Kind, sollen wir dir nicht einmal eine bunte Hose und einen roten Pulli kaufen? Immer diese Tarnfarben!«
»Hör auf, Mama. Den Deckel einer Mülltonne poliert man nicht.«
Leni wollte widersprechen, aber Jeannette ließ sie nicht zu Wort kommen: »Aber wenn du ein paar Euro zu viel hast, könnte ich mir die Billie Holiday Gesamtausgabe kaufen, die gibt es in Köln jetzt gerade für nur …«
»Nein!« Leni warf das Küchenmesser energisch in das Spülbecken. »Entweder Kleidung oder gar nichts. Susannas Teller kannst du abräumen, sie kommt nicht. Sie hat eben angerufen, sie wird wohl mit Arnold und seiner Mutter essen.«
Das war eine gute Nachricht. Jeannette atmete auf. Susanna pflegte ihre jüngere Schwester nämlich spöttisch zu beäugen und zu fragen: »Na, wann kriegst du denn deinen Doktortitel? Gibt es eigentlich keinen Friseur in Köln, oder wieso läufst du so herum?«
Dabei wusste sie ganz genau, dass kein Friseur der Welt aus dieser rotbraunen Drahtbürste etwas herausholen konnte. Waren die Haare länger als drei Zentimeter, begab sich Jeannette sofort unter die Schere des mäßig begabten Coiffeurs neben den Mechenbacher Bahnhofstoiletten. Ihrer Ansicht nach passten zu einem dicken Gesicht nun mal keine dichten Locken, die unweigerlich wachsen würden, wenn sie ihren Haaren Kringelfreiheit gewährte. Und dass man im zweiten Semester Geographie und Anglistik keinen Doktortitel bekam, musste sogar bis zur Kreissparkasse Mechenbach durchgesickert sein. Dort saß Susanna tüchtig und dekorativ am Schreibtisch und beriet Kunden mit zu viel oder zu wenig Geld.
Letzten Sonntag, am Mittagstisch, hatte Susanna ihren Freund Arnold gefragt: »Möchtest du noch etwas Schweinefilet mit Champignons? Dann beeil dich, sonst schaufelt meine kleine Schwester das alles weg. Sie frisst, die Gute.« Dann erklärte sie ihrer Mutter: »Ich nehme heute Nachmittag das Auto. Arnolds Mercedes ist in der Werkstatt.«
Und Jeannette durfte mit der schweren Segeltuchtasche voller Wäsche und Dosenleberwurst die zwei Kilometer zur Bushaltestelle laufen, in der Kreisstadt noch einmal zehn Minuten zum Bahnhof keuchen, um dann den Bummelzug nach Bonn zu nehmen, wo sie endlich Anschluss nach Köln bekam. Sonst wurde sie von Mama nach Bonn gefahren. Zwar besaßen Mama und Susanna das Auto gemeinsam, aber irgendwie hatte Susanna immer Vorfahrt. Wenigstens die Ekelschwester und ihr madenbleicher Freund Arnold blieben ihr heute erspart.
»Schmeckt ganz, ganz lecker, Mama.«
Frau Schmitz blickte auf ihre alte Herrenarmbanduhr und rechnete aus, dass ihr noch drei Stunden mit Jeannette blieben. Sie betrachtete zwei helle Würfel mit Petersilientupfern auf ihrem Esslöffel, blickte dann Jeannette fest an und fragte: »Nettchen, weißt du eigentlich, wie man Eierstich macht?«
Jeannette zuckte zusammen. Das musste sie jetzt durchstehen. Jetzt kam die allwöchentliche Haushaltsstunde. Mutter würde ihr gleich alle Eierstichrezepte der letzten vierzehn Generationen vorbeten, um anschließend zu bemerken, wie wunderbar Susanna kochen konnte. Mama tendierte nicht dazu, die beiden Schwestern gegeneinander auszuspielen, aber manchmal tat sie es eben doch.
Seit über zehn Jahren versuchte Mutter, aus Jeannette eine gute Köchin zu machen. »Ich habe euch kein Tafelsilber zu vererben, keine Bildung und kein Vermögen. Aber meine Kochkunst!«, predigte sie ihren Töchtern.
Bei Jeannette stieß sie auf taube Ohren. Susanna dagegen ließ sich weniger von der sinnlichen Seite des guten Kochens fesseln als vielmehr vom sachlichen Kalkül. Als Ehefrau eines reichen Geschäftsmannes, der repräsentieren und einladen musste, konnte sie solche Kenntnisse gut brauchen. Susanna, in Jeannettes Augen so steril wie eine adelige, bügelfreie Rotkreuzschwester, würde in spätestens einem Jahr ihren bleichen Arnold heiraten, mit ihm eines seiner Grundstücke bebauen und hinter modischen Gardinen zwei vermutlich blonde Kinder zeugen. Arnolds Mutter besaß ein Betten- und Gardinengeschäft in der Kreisstadt, dazu Filialen in zwei weiteren Kleinstädten und drei Sechsfamilienhäuser mit pünktlich zahlenden Mietern. Sohn Arnold war bereits Prinzregent mit Befehlsgewalt über die Matratzenhalle in Mechenbach. Jeannette fand Arnold so spannend wie einen wurmstichigen Beichtstuhl.
Ein einziges Mal hatte Jeannette bei Arnolds Mutter Kaffee getrunken, nämlich vor etwa einem Jahr auf Susannas Verlobung. Jeannette hatte ein Likörglas umgestoßen und sich von der ersten bis zur letzten Sekunde unwohl gefühlt, unwohl in diesem teuer, aber nicht geschmackvoll eingerichteten Landhaus. Da war noch die Stimme von Arnolds Mutter in ihrem Ohr, die Betonung, die sie bei der Frage »Du bist also Susannas Schwester?« auf das Wort »Du« gelegt hatte. Unglücklich, dick und verlegen hatte Jeannette auf dem Sofa gesessen, die Kaffeetasse in den Händen hin- und hergedreht und schließlich, zu ihrem eigenen Entsetzen, laut gerülpst.
»… aber zu viel Muskat schmeckt auch nicht. Und wenn du die Tasse vorher nicht ausbutterst, klebt alles fest. Nettchen, hörst du mir zu?«
Jeannette schrak hoch. »Doch ja, Mama. Tasse ausbuttern!«
Die Mutter nickte befriedigt und stellte die Suppenteller zusammen. Jeannette erhob sich, trug die Terrine hinaus und wollte beim Auftragen des Essens helfen. Aber die Mutter winkte ab. Jeannette war in der Küche langsam und ungeschickt, und ihre Lektion hatte sie für heute ja gelernt. Diese kulinarischen Trockenübungen würde Mama wohl nie aufgeben, dachte Jeannette halb belustigt, halb genervt. Aber alles, was mit Mehlschwitzen, legierten Suppen oder Backhefe zusammenhing, interessierte Jeannette so brennend wie die genaue Stückzahl der Federkernmatratzen, über die Susanna einmal herrschen würde.
Jeannette wanderte durch das kleine Wohnzimmer. Der Blick durch das Fenster ging auf den Garten, bis zur Ligusterhecke. Dahinter sah man die sich bläulich überlagernden Eifelberge. Das Haus lag am Hang.
Leni, mit ihrem Geschick für alles Grüne, hatte im Laufe der Jahre einen überbordend wuchernden Garten angelegt. Altenglische Rosensorten blühten zwischen violettem Rittersporn. Stockrosen, Lavendel und Sonnenblumen leuchteten neben dunkel glänzendem Kirschlorbeer und Terrakottakübeln mit Oleander. Riesengräser wippten über blausilbernem Salbei und dunkelgrünen Funkien mit ihren herzförmigen Blättern, dazwischen blühten weiße Schleifenblumen und himmelblaue Campanula. Im Herbst erfreuten Cosmeen und Astern mit wundersamen Farbklängen, im Winter turnten alle Arten von Meisen über die Schneehäubchen, die auf den abgeblühten Margeriten lagen.
Die Gärten der anderen Dorffrauen waren Leni Schmitz ein Gräuel: Dort standen die Stiefmütterchen stramm Spalier, der Rasen sah aus wie waschbarer Kunststoff, und in alten Schubkarren blühten quietschrote Disneylandgeranien. Blumenbeete wurden stets an den Rand der Grundstücke gedrängt, um einen charakterlosen Zierrasen zu umrahmen, auf dem niemals jemand lag. Den größten Teil solcher Gärten konnte man zwar von der Terrasse aus betrachten, aber nicht nutzen.
Bei Mama konnte man das. Es gab einfach keinen Rasen, nur lauschige Winkel zwischen Stauden und Sträuchern, die gerade einen blau gestrichenen Gartenstuhl verbargen. Verstreute kleine Inseln aus einfachen Quadersteinen oder zurechtgesägten Eisenbahnschwellen boten für Tische und Stühle halbwegs ebene Standflächen.
Umgeben von wisperndem Bambus konnte Jeannette im Sommer auf einem Korbsessel sitzen und verborgen vor Susannas spöttischem Blick eine Tüte Krokantbonbons in sich hineingoscheln. Dieser Platz war der beliebteste im Garten und nannte sich »Wisperinsel«. Ein paar Meter weiter las Mama vielleicht in einem Buch über indianische Keramik. Niemand konnte sie sehen. Sie hatte, als sie den Garten anlegte, ein paar Hopfenstangen wie ein indianisches Tipi aufgestellt, oben mit Draht zusammengebunden und von Knöterich umranken lassen. Zwischendurch war schon einmal eine Stange morsch geworden und musste ersetzt werden, aber der Knöterich wuchs im Laufe der Zeit zu einer dichten und stabilen Hütte zusammen, die sorgfältig gepflegt wurde. In diese summende Laube verzog sich Mama immer, wenn sie allein sein wollte.
Jeannette betrachtete die Familienfotos, die wie auf einem Hausaltar rings um ein Arrangement aus trockenen Rosenblüten aufgebaut waren. Die Eltern, lachend auf einem Motorroller. Mama wirkte auf dem Sitz hinter Papa wie ein kleines Mädchen. Papa, mit Motorradhelm, war breit und groß, aber kaum zu erkennen. Im Hintergrund die Baustelle, ihr bescheidenes Haus auf Opas ehemaliger Obstwiese. Die Wände standen nur zur Hälfte auf dem Foto. Jetzt war es ihr Zuhause. Ein gutes Zuhause.
Der Vater, Großfoto im Silberrahmen. Er hatte ein breites Gesicht und lachte wie ein Faun. Kein schöner Mensch, aber voller Leben. Groß war er gewesen, hatte geräuschvoll Freude um sich verbreitet, viel gegessen und getrunken, schien unschlagbar zu sein. Trotzdem war ein winziges Blutgerinnsel die Ursache für seinen schnellen Tod gewesen.
Oh Papa. Der schwarze Tag vor sechs Jahren.
Bei dem Gedanken an die braune Holzkiste, die man aus dem Haus getragen hatte, weiteten sich Jeannettes Augen immer noch. Sie rief sich oft ihre Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis. Sie hatte ihr eigenes Gekreisch noch im Ohr, wenn sie an die schwindelerregenden Ritte auf seinen Schultern dachte oder an die Freiflüge. Er hatte sie in die Luft geworfen, immer noch einmal und noch einmal, und wieder sicher aufgefangen.
Sie saß auf seinen Knien, und er sang: Muss i denn, muss i denn zuhum Städtele hinaus …, er klopfte den Rhythmus mit dem rechten Fuß, so dass Jeannette auf ihrem Sitz im Takt wackelte und in angstvoller Freude darauf wartete herunterzufallen, was aber nie geschah.
Später brachte er ihr das Notenlesen bei, lange bevor sie es in der Schule lernen sollte. Jeannette und der Vater trällerten zusammen Volkslieder, pfiffen Operettenmelodien im Duett, lauschten von Schlagern die erste und zweite Stimme ab und sangen, wann immer er zu Hause war. Papa machte keinen Unterschied zwischen guter oder schlechter Musik. Was ihnen beiden gefiel, war gut.
Als das gebrauchte Klavier ins Haus kam, klimperte Jeannette stundenlang kleine Kompositionen zusammen und brachte es im Laufe der Zeit zu beachtlichen Leistungen. Für richtigen Klavierunterricht war kein Geld da. Manchmal legte Vater ein Stück von Mozart oder Mendelssohn Bartholdy auf und zog Jeannette und Susanna neben sich auf das Sofa. Dann saßen sie da, lehnten sich an Papas breiten Rücken und lauschten dieser fröhlichen oder ernsten Musik. Jeannette beobachtete die Hände des Vaters, die den Violinen oder Flöten ihren Einsatz gaben, und fühlte sich eins mit der Welt. Jeannette begriff nicht, dass Susanna bei dieser Musik entweder kribbelig wurde oder einschlief. Aber Vater lachte.
Anfangs hatte sie nicht verstanden, dass er auf einmal nicht mehr da war. Der Schmerz war so wütend gewesen.
Niemand sagte mehr: »Du hast eine Stimme wie eine Nachtigall, Jeannette!« Niemand schaute sie stolz und liebevoll an, wenn sie bei den Schulveranstaltungen ein Solo singen durfte. Doch, Mama schaute natürlich auch stolz und liebevoll, aber Papa schaute anders. Papa war eben Papa. Er hatte ihr das Gefühl gegeben, etwas Besonderes, etwas unverwechselbar Wundervolles zu sein.
Damals, mit dreizehn, kurz nach dem schwarzen Tag, hatte sie angefangen zu essen. Das, was ihr fehlte, fand sie zumindest vorübergehend zwischen knisterndem Stanniolpapier. Nach der Schokoladensucht kam die Dosenleberwurst vom Bauernhof nebenan, die sie vorzugsweise nachts um drei mit einer Tüte Zwieback in sich hineinfraß. Sie aß oft heimlich. Weil sie wegen Mamas knappem Budget keinen Kahlschlag im Kühlschrank anrichten konnte, erfand sie eine bizarre Nährlösung. Sie rührte Mehl, Zucker und Büchsenmilch an und schlotzte diesen süßen Klebstoff heimlich vom Zeigefinger, bis alle Bücher, die sie besaß, an den Umblätter-Ecken Spuren dieser Trostpampen aufwiesen.
Aus dem zarten kleinen Mädchen wurde im Laufe der Jahre ein dickes, trotziges Mädchen. Nicht gerade unförmig, aber innerlich und äußerlich sperrig. Nur die Liebe zur Musik hatte sich nicht verflüchtigt.
Jeannette stand vor Lenis großem Bücherregal und suchte mit schiefgelegtem Kopf nach neuen Büchern. Leni war eine Leseratte. Jeannette lächelte beim Anblick zweier schiefnasiger Männlein aus Ton, die sich im Regal beäugten. Sie hatte sie im Alter von fünf oder sechs Jahren geknetet und ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt. Leni hob alles auf.
Das ganze Haus war voller Spuren aus der Kindheit. Andere Familien aus dem Dorf trugen ihre unmodernen Möbel im Laufe der Jahre auf den Sperrmüll. Alle besaßen jetzt bunte Polsterelemente oder dunkle Ledersessel. Jedes Wohnzimmer hatte eine große, repräsentative Schrankwand, meist mit aufklappbarem Barfach, vorzugsweise innen beleuchtet. Die Sitzgruppen waren wie eine Arena um die Unterhaltungsquelle aufgebaut, nur dass statt des Gladiators der Tagesschausprecher Abendbrot und Spiele einläutete.
Leni und Josef Schmitz dagegen trugen das, was andere auf den Sperrmüll warfen, wieder hinein, schmirgelten es ab und lackierten es bunt. Fast sämtliches Mobiliar stammte vom Bürgersteig, und was die Fernseharena anbelangte: Es gab keine. Andere Frauen standen andächtig und mit gefalteten Händen vor dem lange ersehnten Perserteppich und erteilten haarenden Hunden und schlammverkrusteten Kleinkindern allerstrengstes Wohnverbot. Leni Schmitz schnitt unverdrossen alte Wäsche in Streifen und häkelte daraus runde Teppiche, die sie nach Belieben färbte und in den Waschbottich warf, wenn ein Kind sein Brot mit Rübensirup darauf fallen gelassen hatte.
Leni sehnte sich nie nach modernen Möbeln und teuren Teppichen. Es wäre sowieso kein Geld dafür da gewesen. Josef arbeitete als angestellter Steinmetz, das Grundstück hatte Leni geerbt, und Josef hatte das Haus Stein für Stein allein gebaut. Trotzdem verschlang das Baumaterial, gemessen an Josefs Gesellenlohn, Riesensummen. Und als die Kinder kamen, wollte Leni nicht mehr aushilfsweise im Büro arbeiten. Leni hätte gerne irgendetwas mit Kunst zu tun gehabt und Josef mit Musik. Aber Leni hatte im entscheidenden Alter das Durchhaltevermögen gefehlt, und Josefs Freude an der Musik war viel größer als sein Talent. Jedoch hatte er die glückliche Einsicht, beides nicht miteinander zu verwechseln.
So versuchten sie, in ihren Töchtern die Lust an hörbaren oder sichtbaren Tönen zu wecken: Leni malte und Josef musizierte mit ihnen. Außerdem bevölkerten sich durch Lenis Erzählkünste die Köpfe ihrer Kinder mit Dutzenden von Zwergen, Elfen und Prinzessinnen, Seeräubern und Amazonaskrokodilen. Susanna und Jeannette trugen die abenteuerlichsten Kleider, die ein Kind haben konnte: Wer besaß schon Knöpfe aus abgesägten Birkenscheibchen oder eine handgestrickte Ringelstrumpfhose, deren Beine aus zwei alten roten Pulloverärmeln bestanden?
Die kleinen Mädchen wussten, wie man in ein paar Minuten aus einem Stück Papier Schachteln faltete, oder einen Frosch, der hüpfen konnte. Leni brachte ihnen bei, dass Regen sich anders anhörte als das Wasser aus dem Gartenschlauch, dass Baumstämme kühl und rissig oder warm und glatt waren. Sie konnten Wiesenstorchenschnabel und Hirtentäschel erkennen und wussten einen Dompfaff von einem Rotschwänzchen zu unterscheiden.
Aber es gab auch Dinge, die Leni ihnen nicht vermittelte. Josef und Leni wollten keinen Fernseher. Nachrichten konnte man auch im Radio hören oder in der Zeitung lesen. »Fernsehen macht mich so leer«, sagte Leni, wenn man sie nach Gründen fragte. Natürlich galten Leni und Josef auch deshalb als Exoten. Man hatte einfach einen Fernseher zu haben. Zwar gab es kaum einen Vater, der so viel mit seinen Töchtern sang und spielte, kaum eine Mutter, die so intensiv die Phantasie ihrer Kinder anregte, aber Jeannette und Susanna konnten in der Schule nicht mitreden, wenn es um Serienhelden oder Barbiepuppen ging. Mama fand Barbiepuppen und Barbiekleider bescheuert, und deshalb gab es so etwas nicht.
Für Jeannette war das kein Problem, denn sie rannte lieber mit ihrem Hamster durch die Gegend. Sie machte sich auch nichts daraus, dass auf ihrer Blockflöte nicht so ein kleiner Goldstempel war, sondern nur Kratzer und ein handgemalter Stern, denn Mama hatte die Flöte geschenkt bekommen, mit Sandpapier bearbeitet und desinfiziert.
Aber Susanna litt. Sie erzählte ihren Schulfreundinnen, sie sei eigentlich nur das Pflegekind von Familie Schmitz. Ihre richtigen Eltern lebten dagegen in Amerika, mit Bergen von Barbiepuppen. Die amerikanischen Eltern konnten sie aus ganz geheimen Gründen nicht sofort abholen, aber sie würden bald kommen und sie mitnehmen.
»Meine echte Mutter ist Millionärin«, sagte Susanna, wenn Leni in ausgebeulten Trainingshosen im Vorgarten die Heckenrosen stutzte. »Mein echter Vater hat eine Yacht mit tausend Matrosen«, sagte sie leise zu ihren Schulfreundinnen, wenn Josef ihr über den Zaun des Steinmetzbetriebes zuwinkte, bevor er mit seinem Chef einen polierten Granitstein mit der Inschrift »Ruhe sanft« auf den klapprigen Transporter lud.
Später, auf dem evangelischen Gymnasium, konnte Susanna die rabiatesten Drohungen ausstoßen, und niemand zweifelte daran, dass sie sie wahr machen würde. »Mein echter Vater arbeitet für den Geheimdienst. Das sage ich nur dir. Wenn du ein Wort davon erzählst, passiert dir was ganz Schlimmes.« Susanna schaffte es, um sich herum eine Aura des Besonderen aufzubauen, die nicht durch spezielle Turnschuhe oder schillernde Etikettchen gestützt werden musste. Aber in ihr hatte sich unausrottbar der Wunsch nach Geld, viel Geld festgesetzt.
Als die Mädchen größer wurden, suchte Leni eine vernünftige Halbtagsarbeit. Die war aber in diesem Eifeldorf schwieriger zu finden als eine wilde Ananas. Also putzte Leni die Grundschule und einige gute Stuben.
Irgendwann, an einem Septembersonntag, spazierte eine ältere Dame aus der Kreisstadt Mechenbach durch die dörfliche Idylle von Untermechenbach und betrachtete die phantasievollen Kränze, die Leni Schmitz an Haus- und Hoftür gehängt hatte, mit Sympathie. Dann riskierte sie einen Blick über den Gartenzaun und freute sich an den bunten Rabatten und Töpfen voller Wildkräuter und Gräser, an den Tomatenstauden und gelben Kürbissen, die versteckt unter ihren dunklen Blättern leuchteten. Schließlich fasste sie sich ein Herz und klingelte. Leni öffnete erstaunt, denn spontanen Besuch bekam sie fast nie. Die unbekannte Frau bat um ein Glas Wasser und fragte, ob solch schöne Kränze denn käuflich seien. Leni bat sie auf die Terrasse und brachte ihr ein Glas Saft.
Die alte Dame erfasste mit einem Blick, dass sie an der richtigen Adresse war. Lenis Hände waren farbverschmiert, sie lackierte gerade einen Korbsessel, den sie zuvor mit Draht und Bast geflickt hatte. Das war etwas, das die alte Frau Siegel liebte. Frau Siegels Schwiegertochter warf sofort alles weg, wenn es nicht mehr modern war, einen Sprung oder ein Loch hatte. Undenkbar für Leni. Dann entdeckte Frau Siegel, dass die Tischdecke mit einem regelrechten Zierstich gestopft war, so wie sie es selbst noch gelernt hatte, und ihr Entschluss stand fest. »Wo arbeiten Sie?«, fragte sie Leni.
»Überall, wo es etwas zu putzen gibt.« Leni zupfte ein paar welke Blüten aus den Begonien.
»Ich habe den Blumenladen in Mechenbach am Bahnhof.« Frau Siegel nippte an ihrem Glas.
»Den mit den bunten Steinchen an der Fassade?«, fragte Leni. »Suchen Sie eine Putzhilfe? Das ist zwar ein bisschen weit mit dem Fahrrad, aber es müsste gehen. Montags und samstags habe ich noch Zeit.«
»Nein, ich suche keine Putzfrau, ich suche eine rechte Hand.« Die alte Dame lächelte. »Meine eigene ist nämlich schon etwas gichtig.«
Danach änderte sich vieles. Aus »Frau Schmitz« wurde sehr schnell »Leni« und aus Frau Siegel »Adelheid«. Für die Kinder »Tante Adelheid«. Zu Weihnachten bekam Susanna von Tante Adelheid die begehrte Plastikpuppe und gekaufte Barbiekleider.
»Ja, mecker du ruhig«, sagte Adelheid zu Leni. »Ich finde diese rosa Schmalpopos auch furchtbar, aber es gibt Sachen, die ein Kind braucht, auch wenn es dir nicht gefällt.«
Selbst der nun regelmäßige Lohn konnte Leni nicht von ihrer Lust an Kinderponchos aus alten Wolldecken oder Sommerhosen aus gestreiften Matratzenbezügen abbringen.
»Kannst du Susanna nicht mal etwas kaufen, was bei den Kindern in Mode ist? Ich glaube, dieses Jahr müssen es Jeans mit so einem roten Zeichen hintendrauf sein.«
»Diesen Markenunsinn mache ich nicht mit!«, erboste sich Leni.
»Ach Leni, du bist auf deine Art genauso orthodox wie die Kinder, die Susanna hänseln, weil sie niemals etwas bekommt, was man so trägt.«
»Sie soll keine eingebildete Pute werden!«
»Aber sie möchte dazugehören.«
»Wozu? Zu den Menschen, die ihre Phantasie nicht gebrauchen und sich zum Sklaven irgendwelcher Stoffetikettchen machen?«
Adelheid seufzte nur. Sosehr sie Leni schätzte, so sehr bedauerte sie, dass Lenis Lust an Gestaltung und Wiederverwertung in weitem Bogen an den Bedürfnissen ihrer ältesten Tochter vorbeilief.
Leni Schmitz machte in Frau Siegels Blumenladen so etwas wie Karriere. Sie führten zusammen die Bücher, Leni fuhr zum Großmarkt, ab und zu auf eine Floristenmesse und brachte viele Anregungen mit. Ihre kreative Phantasie kam bei den Kunden immer besser an. Was sie aus einem Philodendronblatt, einer Seerose und trockenen Reisern zauberte, sah für Mechenbacher Verhältnisse ungeheuer fortschrittlich aus. Jedenfalls wesentlich origineller als Adelheids ordentlich gemischte Sträuße aus beliebigen Buntblühern und der obligaten Manschette aus gerafftem Seidenpapier.
Die eher traditionell orientierte, aber für alles Neue aufgeschlossene Adelheid hatte einen guten Fang mit Leni gemacht. Leni kam in Mode. Ihre Herbstkranzwochenenden, bei denen sie mit den Mechenbacher Hausfrauen ungewöhnliche Adventskränze flocht, waren stets bis ins übernächste Jahr ausgebucht.
Adelheids Schwiegertochter hätte die museumsreife Innenausstattung des Ladens aus der Wirtschaftswunderzeit, die Blumenständer aus Resopal und Bambus, die Tütenlampen an den Wänden, am liebsten sofort in Brand gesetzt. Leni hielt alles in Ordnung, reparierte und erneuerte Schirmtütchen mit ihren altgewohnt improvisierten Mitteln. Adelheid mochte es, dass Leni Respekt vor den Dingen hatte.
Schon immer hatten Leni und Josef in ihrer freien Zeit viel und wahllos gelesen. Leni erzählte Adelheid, dass sich einige Naturvölker bei den Bäumen und Pflanzen entschuldigten, bevor sie sie umhackten oder ausrissen.
»Ich kann mich doch jetzt nicht bei jeder einzelnen Schnittblume entschuldigen.« Adelheid griff nach der Blumenschere: »Tach, Spargelkraut, tut mir leid, dass ich dich jetzt in den Kranz fürs Kriegerdenkmal wickeln muss!« Sie lachte. Aber irgendwie gefiel ihr das mit den Naturvölkern.
Adelheid wurde Lenis engste Freundin und ihr stärkster Halt in schlimmen Tagen. Umgekehrt fand Adelheid in Leni die junge Frau, die sie gerne als Tochter oder Schwiegertochter gehabt hätte. Die ältere Dame verteilte ihre Sympathien auf die beiden Kinder mit absoluter Gerechtigkeit. Jeannette war der Strahlematz, dem alle Herzen zuflogen, Susanna das ruhige, undurchsichtige Kind, das sich immer entzog. Adelheid bemühte sich ernsthaft um Susanna, trat ihr aber nie zu nahe. Susanna dankte es ihr, indem sie der Tante eines ihrer seltenen Lächeln schenkte. Und die erste Barbiepuppe bewahrte sie wie eine Ikone auf.
Als die Katastrophe über die Familie hereinbrach, ließ Adelheid Leni fast nie allein. Jeden Abend brachte sie ihre Angestellte nach Hause. Dann saßen die beiden Frauen noch lange im Garten oder Wohnzimmer, sprachen halblaut oder schwiegen.
Immer brachte Adelheid den Mädchen etwas mit, mal waren es bunte Zuckertütchen, die sie in einem Café in Köln oder Bad Neuenahr eingesteckt hatte, mal aber auch etwas Besonderes. Eine Haarklammer mit einer Stoffblüte, zum Beispiel. Jeannette bedankte sich artig, legte den Haarschmuck auf den Küchentisch und schrieb an ihren Hausaufgaben weiter, oder las immer wieder die Geschichte von »Pünktchen und Anton«, am liebsten die Stelle, an der Pünktchens netter Vater sagte: »Und in den großen Ferien fahren wir alle an die Ostsee!«
Susanna stahl sich vor den großen Spiegel in das Elternschlafzimmer, steckte sich die Blüte seitlich über das Ohr in ihre blonden Haare und wickelte sich in ein Feengewand, nämlich in die große Tischdecke mit den vielen Löchern aus Spitze. Sie drehte sich vor dem Spiegel hin und her, ging mit dem Gesicht ganz nah an das kühle Glas, schaute sich tief in die Augen und sagte: »Ich werde dich heiraten. Wir werden von hier fortgehen. Weit weg.« Dann küsste sie ihre Spiegellippen.
Jeannette wollte sich in der Küche noch ein Glas Saft einschenken, als sie Susanna durch die halb offene Tür vor dem Spiegel erblickte. Sie hielt den Atem an. Sie wusste, dass sie dieses Bild ihrer knapp vierzehnjährigen Schwester, die in ihrer Spitzenwolke von hier fortgehen wollte, nie vergessen würde.
Mama hatte Jeannettes alte Blockflöte an die Wand genagelt, neben eine bunte Collage aus Kinderbriefen und Schulfotos. Jeannette betrachtete ein Gruppenbild. Blaue Röckchen, weiße Blusen. Der Mechenbacher Schulchor auf dem Marktplatz bei der Einweihung des neuen Brunnens. Der Bildhauer hatte sich wirklich etwas einfallen lassen, für Mechenbach reichte es jedenfalls.
Jeannette stand ganz am Rand, zwischen einer Klassenkameradin und der schielenden Bronzegans, die sich nun schon seit sieben Jahren unter der Rute der starren Gänseliesel duckte. Die Aufnahme zeigte ein kleines schmales Mädchen mit Wuschelkopf, Brille und Zahnklammer. Es war Jeannettes letzter Auftritt im Schulchor gewesen. Jeannette würde sich immer daran erinnern.
Nach dem Festakt schraubte der Bürgermeister an einem versteckten Knöpfchen, und die Bronzegänse nahmen mit weit geöffneten Schnäbeln ihren eintönigen Wasserspeidienst auf. Zusätzlich begann es zu regnen, der Chor löste sich auf, und alle durften an diesem wichtigen Feiertag nach Hause fahren. Im Bus nach Untermechenbach drängten sich die Schulkinder. Die beiden Musiklehrerinnen, die ältere Frau Bodenheb und die junge Frau Körner, saßen auch im Bus, nahe der hinteren Tür.
»Sehr großes Lob, Frau Körner. Der Chor ist so gut geworden, seitdem Sie ihn übernommen haben. Ich bin zu alt dazu.« Frau Bodenheb zupfte resigniert an ihrem weiten Wollrock und räusperte sich. Frau Körner lächelte flüchtig, denn ein Lob von dieser Seite war ihr eigentlich nicht wichtig.
»Diese kleine Schmitz hat eine wundervolle Stimme, nicht? Man sollte so etwas fördern.« Frau Bodenheb schaute Frau Körner von der Seite an. Frau Körner reagierte nicht. Also hakte Frau Bodenheb nach. »Sie wissen doch, wen ich meine? Die beiden Schmitze-Mädchen, die vor einem halben Jahr den Papa verloren haben.«
»Ach, Sie meinen die kleine Unscheinbare, mit der Brille und der Zahnklammer? Die Schwester von der hübschen Blonden?«
»Ich meine … Jeannette heißt sie, glaube ich.«
»Ja, das ist schon eine Schande. Warum kann diese Stimme nicht in dem anderen Körper stecken, was? Das Leben ist ungerecht.«
Frau Körner lachte etwas zu laut, denn sie kannte die Ungerechtigkeit des Lebens. Sie musste sich in der Schule als Musiklehrerin verschleißen, statt im Rampenlicht am Konzertflügel zu sitzen. Sie musste ganz albern Geld für Miete, Brötchen und Leberwurst verdienen, und das auch noch auf einer langweiligen höheren Schule in Mechenbach. Frau Bodenheb gefiel die Wendung des Gespräches nicht. Sie schwieg und betrachtete eine kleine Schülerin vor sich, die sich an der feuchtkalten Metallstange des Busausganges festhielt. Das Kind war nicht zu erkennen, die Kapuze hing ihm tief ins Gesicht. Das Regencape erinnerte an eine Sommertischdecke. In dicken Tropfen perlte das Wasser vom Klatschmohn.
Jeannette klammerte sich an die Metallstange. Sie kroch mit der Nase noch tiefer in ihr Cape, das Mama aus einer bunten Wachstuchdecke genäht hatte. Es roch so gut nach zu Hause. Sie tastete mit der Zunge an den Drähten der Zahnklammer entlang. Die Gläser ihrer Brille waren beschlagen. Aber sie wollte sowieso niemanden ansehen. Sie würde nie mehr im Chor singen.
Mama trug die knusprigen Panadekoteletts herein. Jeannette vergaß das Foto des Schulchores sofort. Sie musste schlucken. Sie aß die ganze Woche in der Mensa oder löffelte den Inhalt irgendwelcher Konserven. Das hier grenzte ans Himmelreich, kulinarisch gesehen. »Oh Mama, das habe ich schon lange nicht mehr gegessen!«
Frau Schmitz lächelte und unterdrückte einen Tadel, als sich Jeannette viel zu viel zerlassene Butter über den Blumenkohl goss. Für Susanna zu kochen machte überhaupt keinen Spaß. Sie aß fast nichts und stocherte auch noch in den paar Bissen herum, die sie zu sich nahm. »Gestern war ich mit Arnold im ›Goldenen Kamin‹. Die machen da ein vorzügliches Lammfilet mit Sherrysauce.« Dabei wendete Susanna dann die restlichen Bissen des Kräuteromeletts hin und her und schob sie schließlich an den Tellerrand: »Omelett hatte ich gestern.«
Jeannette angelte das zweite Kotelett von der Warmhalteplatte, als das Telefon schrillte.
Die Mutter sprang auf und warf fast ihr Weinglas um. Das war ungewöhnlich.
Jeannette blickte ihr verwundert nach und schob sich dabei eine Ladung zerquetschter Salzkartoffeln mit braunen Butterbröseln in den Mund. Sie kaute nachdenklich. Dann, als Mama nicht gleich wiederkam, legte sie das Besteck zu Seite, nahm das Kotelett in die Hand und nagte es gierig und schnell ab. Sie liebte es, mit den Fingern zu essen. Das hatte so etwas Unmittelbares, aber Mutter bekam Zustände, wenn Jeannette ihr Verhältnis zu Nahrungsmitteln derart auslebte. Sie fuhr mit den Fingern auf der fettigen Fleischplatte herum, fischte nach einzelnen Placken würziger Panade und stopfte sie in den Mund. Dann griff sie in die Schüssel mit den Blumenkohlröschen, nahm ein Stück Gemüse heraus und hielt es so herum ans Licht, dass es aussah wie ein Bäumchen mit knollig verzweigter Krone. Sie roch daran, tauchte es in die Sauciere mit der flüssigen Butter und machte dabei einen Fettfleck auf die Richelieustickerei der Sonntagsdecke.
Mutter kam wieder herein, und Jeannette bemühte sich hastig, ihre Fettfinger zu verbergen. Sie schmierte sie an den geräumigen Cargohosen ab, die sie fast immer trug. Mutter hatte gerötete Wangen und schien in Gedanken woanders zu sein. Ihr Essen war während des Telefonates kalt geworden. Sie schob das halbe Kotelett von sich.
»Soll ich deinen Teller in den Ofen stellen?«, fragte Jeannette eilfertig.
»Nein, Kind, lass mal, ich bin satt. Wenn man kocht, hat man sowieso keinen großen Hunger mehr.«
Jeannette schielte auf das Kotelett. Die Mutter schob ihr den Teller hin. »Eigentlich hast du ja genug, Liebelein.«
Jeannette nahm sich das halbe Kotelett, biss hinein und sprach mit vollem Mund: »Hat dir der Schiefzahn also großzügigerweise das Auto überlassen. Wie außerordentlich nett.«
Der Schiefzahn, das war Susanna. Denn der einzige Makel an Susanna war ein schiefer Vorderzahn, der ihr aber nur noch einen ungeraden Zusatzreiz verlieh, leider.
»Warum redest du so über deine Schwester? Wieso könnt ihr euch nicht vertragen?«
»Susanna ist der Typ Mensch, der dich nach unterschriebenem Friedensvertrag mit der weißen Fahne erdrosselt«, erklärte Jeannette und spielte mit einer halben Kartoffel auf dem Teller herum.
Leni stand auf, stellte die Schüsseln ineinander. »Sei nicht unfair, Jeannette. Falsch ist sie nicht, das kannst du ihr nun absolut nicht nachsagen.«
»Was gibt es denn zum Nachtisch, Mama?«
Leni war mit dem Themenwechsel einverstanden. »Sahnegrießpudding mit Kirschkompott.«
Jeannette lächelte zufrieden. Die Mutter fuhrwerkte in der Küche herum, Jeannette nahm unbeobachtet den Weißwein und trank einen guten Schluck direkt aus der Flasche. Tupfte sich Susanna den Mund mit Leinenservietten ab, wischte sich Jeannette den Mund an der Tischdecke. Sagte Susanna: »Ach, wie unangenehm!«, brüllte Jeannette: »So ein bescheuerter Flachkack!« Stöckelte Susanna auf geebneten Spazierwegen, trampelte Jeannette in Schnürstiefeln durch Pfützen und Kuhfladen.
Es war fast wie ein Zwang, je mehr eine Schwester in die eine Richtung tendierte, desto stärker trieb es die andere zum Gegenpol. Aber das Gemeine war: Gleichzeitig konnte Susanna ungeheuer schnell und mutig zupacken und war dann überhaupt nicht etepetete. Sie hatte dem benachbarten Bauern geholfen, als seine Prachtkuh an einem Sonntagnachmittag zwei Kälbchen warf und niemand in der Nähe war, der ihm assistieren konnte. Sprang das Auto nicht an, legte sie sich unter den Wagen und fuhrwerkte am Anlasser herum, um anschließend auszusehen, als käme sie frisch aus der Badewanne. Und der Wagen lief wieder.
Nicht lange nach Vaters Tod hatte Susanna das Gymnasium verlassen. »Ich gehe zur Sparkasse. Ich will Geld verdienen, und zwar sofort.« Susanna entwickelte ein fast erotisches Verhältnis zu Geldgeschäften und Verwaltungsangelegenheiten. Sie gab Mama nach Abschluss der Lehre zwar einen erheblichen Teil ihres Gehalts, aber sie kaufte sich cremefarbene Seidenblusen, Perlenclips und ein dunkelgraues Kostüm. Sie entrümpelte ihr Zimmer vollkommen, warf Mamas bunte Häkeldecken und die himmelblau gestrichene Kommode hinaus und kaufte sich spinnenartige Halogenlampen, einen schwarzen Ledersessel und eine Liege auf Stahlrohrbeinen. Mama bekam Schüttelfrost. »Willst du da wohnen oder von dort aus die Frankfurter Börse regieren?«
»Ich teile eben nicht euren Kirmesgeschmack.«
Jeannette riskierte auch einen Blick auf die neue Pracht: »Sieht aus wie ein Eiswürfelfach!«
»Hau ab, du Trampel!«
Susanna blickte sich suchend nach einem Häkelkissen um, das sie ihrer Schwester nachwerfen konnte. Aber sie fand keines. Sie hatte sie alle auf den Speicher getragen.
Sie waren sich fremd, und sie wurden sich immer fremder. Susanna wirkte tatsächlich so, als lebten ihre echten Eltern in Amerika, als sei sie nur zu Besuch und warte auf die nächstgünstige Verbindung nach Übersee, in eine andere Welt.
Eines Tages tauchte der bleiche Arnold mit seinem Mercedes in Untermechenbach auf, Susanna führte ihn ins Esszimmer und sagte: »Das ist Arnold Reppelmann. Wir haben uns kennengelernt, als ich ihn über Investmentfonds beraten habe.«
»Wie romantisch!« Jeannette war sicher, Papa hätte diesen Reppelmann nicht gemocht. Arnold war zwar nicht wirklich unangenehm, aber so langweilig. Doch Papa war tot und konnte nicht mit ihr gemeinsam über Arnold lästern. Papa hatte auch nicht mehr erlebt, dass sie, Jeannette, das zweitbeste Abitur des Jahrgangs gemacht hatte.
Jeannette seufzte tief und blickte zum dritten Mal an diesem Tag das Bild des Vaters an. »Wer hat eigentlich angerufen, als du so eilig aufgesprungen bist?«, rief sie in Richtung Küche.
»Was? Ach, eine Bekannte.«
»Wer denn?« Jeannette kannte alle Bekannten ihrer Mutter.
Kleine Pause.
»Wer, Mama?«
Mutter klapperte mit den Tellern. Dann, nach ein paar Sekunden, erschien sie in der Küchentür und trocknete sich die Hände an einem Küchentuch ab. »Du kennst sie nicht.«
Wieder verschwand sie in der Küche und rief: »Kaffee?«