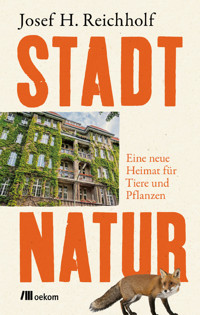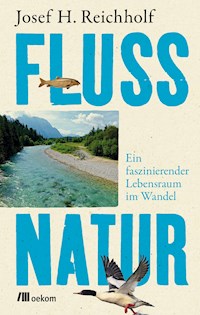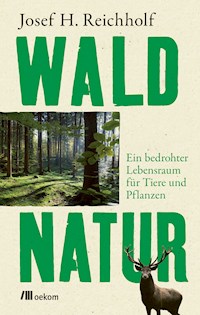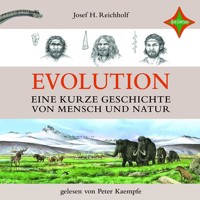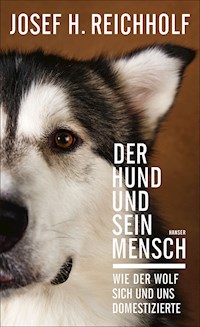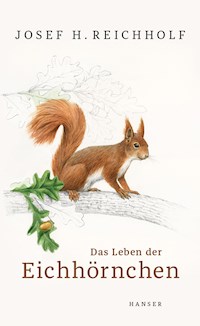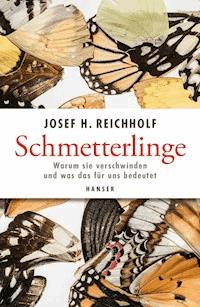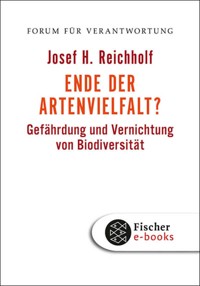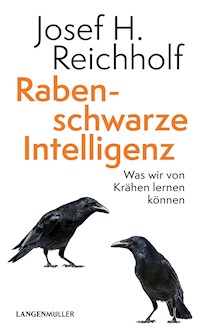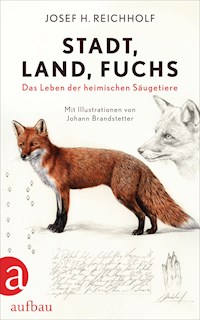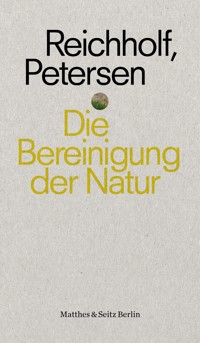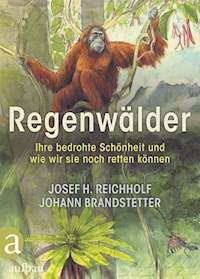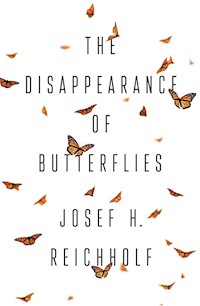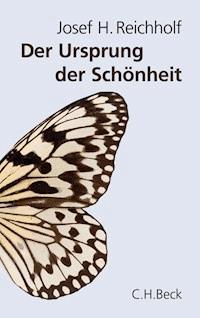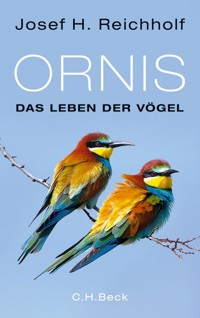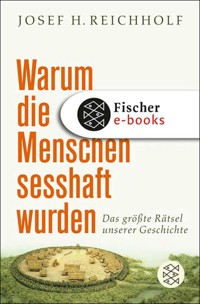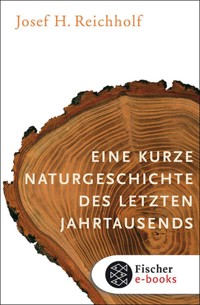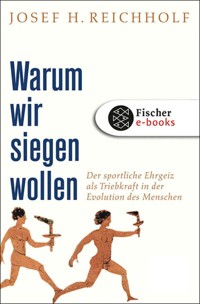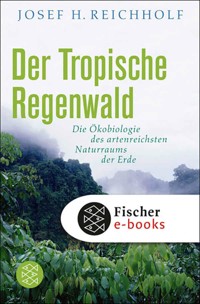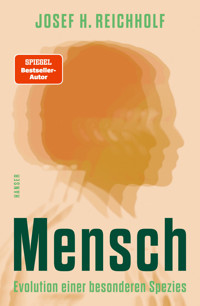
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Josef H. Reichholf erzählt die Evolution des Menschen neu und wagt einen Ausblick in unsere Zukunft. Der Mensch ist etwas Besonderes. Mit acht Milliarden über den ganzen Globus verteilten Individuen ist der Mensch so erfolgreich wie keine andere vergleichbare Art. Aber warum wir so sind, wie wir sind, daran scheiden sich die Geister. Josef H. Reichholf, vielfach ausgezeichneter Biologe und Bestsellerautor, stellt sich in seinem großen Buch der Frage nach dem Wesen des Menschen. Was sind wir? Welche Rolle spielen Natur und Kultur für Gewalt und Mitgefühl, für Konflikte und Fortschritt? Und warum gelingt es der Menschheit nicht, sich zukunftsfähig zu verhalten? Anschaulich und anhand neuester Forschungen zeichnet Reichholf den langen Weg von Homo sapiens nach – und greift zugleich weit über eine rein biologische Evolutionsgeschichte hinaus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Josef H. Reichholf erzählt die Evolution des Menschen neu und wagt einen Ausblick in unsere Zukunft.Der Mensch ist etwas Besonderes. Mit acht Milliarden über den ganzen Globus verteilten Individuen ist der Mensch so erfolgreich wie keine andere vergleichbare Art. Aber warum wir so sind, wie wir sind, daran scheiden sich die Geister. Josef H. Reichholf, vielfach ausgezeichneter Biologe und Bestsellerautor, stellt sich in seinem großen Buch der Frage nach dem Wesen des Menschen. Was sind wir? Welche Rolle spielen Natur und Kultur für Gewalt und Mitgefühl, für Konflikte und Fortschritt? Und warum gelingt es der Menschheit nicht, sich zukunftsfähig zu verhalten? Anschaulich und anhand neuester Forschungen zeichnet Reichholf den langen Weg von Homo sapiens nach — und greift zugleich weit über eine rein biologische Evolutionsgeschichte hinaus.
Josef H. Reichholf
Mensch
Evolution einer besonderen Spezies
Hanser
Eine Vorbemerkung über »uns«
Der Kalte Krieg ging zu Ende. Die Sowjetunion brach zusammen. Die von ihr besetzten Satellitenstaaten wurden frei. Der Wiedervereinigung Deutschlands stand nichts mehr im Wege. 1990 schien das neue Jahrtausend vorzeitig zu beginnen. Eine bessere, eine friedlichere Welt zeichnete sich ab. In jenem schicksalhaften Jahr der Großen Wende erschien mein Buch Das Rätsel der Menschwerdung. Darin ging es um die Evolution des Menschen, um seine fernen Ursprünge und die Ausbreitung über die Erde. Gemäß dem damaligen Kenntnisstand war es ein Blick zurück in die Tiefe der Vergangenheit.
Unberücksichtigt ließ ich darin aber jene Eigenheiten der Menschheit, die bis in die Gegenwart ihre Geschichte bestimmt hatten, die »dunklen Seiten«. Denn in der neuen Zeit wendete sich offenbar fast alles zum Guten, vom Wegfall der atomaren Bedrohung über Maßnahmen zum Schutz der Umwelt bis zur Verminderung des Hungers trotz weiteren starken Anwachsens der Menschheit. Der amerikanische Politikwissenschaftler Yoshihiro Francis Fukuyama veröffentlichte 1992 ein Buch mit dem Titel Das Ende der Geschichte. Zwar meinte er damit nicht, dass nun alles gut sei und es so bleiben würde, sondern dass die großen Konfrontationen »Geschichte sind«. Die Euphorie, die sich im »Westen« ausbreitete, war getragen von dieser Zuversicht. An ihr änderten die in dichter Folge kommenden Befunde zu immer stärkeren Belastungen der Umwelt, sogar der Erdatmosphäre, unserer Luft zum Atmen, kaum etwas, weil man 1992 auf dem »Erdgipfel von Rio« unter Führung des deutschen Umweltministers Klaus Töpfer in der Staatengemeinschaft der Erde übereingekommen war, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. In China hatte man zudem den harten Maoismus überwunden. Eine stürmische Entwicklung setzte ein. In wenigen Jahrzehnten wurde das neue China zur »Fabrik der Menschheit«. Sich als eine solche, als eine globale Gemeinschaft zu begreifen, das machte der Menschheit nun auch das Internet möglich. Liberale Haltungen und die Prinzipien der Menschenrechte sollten auf diesem neuartigen Weg in autoritäre politische Systeme eindringen und diese zu Fall bringen, so die Hoffnung. An Fake News und die Macht der Beeinflussung der Massen über die sozialen Medien dachte zunächst kaum jemand.
Das Erschrecken kam schnell. Mit der Auflösung des Ost-West-Konflikts drohte zwar nicht gleich wieder, wie gegenwärtig, ein neuer globaler Krieg, aber lokale und regionale Konflikte brachen aus, die man nicht mehr für möglich gehalten hatte. So beim Zerfall Jugoslawiens, im Irak-Krieg, in Afghanistan, jeweils mit zunehmenden Dimensionen. Die Kriege ließen sich nicht beschränken und auch nicht in einer Weise führen, die die Zivilbevölkerung hinreichend geschützt hätte. Nur drei Jahrzehnte nach der scheinbaren Wende zum Guten befinden wir uns jetzt an der Schwelle zu einem neuen ganz großen Konflikt. Sogar atomare Bewaffnung wird in Deutschland ernsthaft diskutiert. Zeitgleich schaukelten sich zwei andere große Gefahren auf, die die Menschheit bedrohen, Klimawandel und (zu) starkes Anwachsen der Weltbevölkerung. Migrationsströme gehen von dieser aus, die westliche Demokratien erschüttern, während fortschreitende Naturvernichtung und Klimawandel dazu zwingen, dass wir uns einstellen auf drastisch veränderte Lebensverhältnisse. Die Stabilität, die 1990 möglich schien, erwies sich als ein Wunschbild, das sich zum Trugbild verflüchtigte.
Dabei waren doch all die Vorstellungen von einer besseren Welt so gut, so erstrebenswert. Wie kann es sein, dass die Ziele nicht erreicht wurden und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht zu erreichen sein werden, obwohl sie für alle eine gesicherte Zukunft bringen würden? Unsere Vorstellungen davon scheitern gegenwärtig genauso wie Goethes so nobler Rat »Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!« und die bereits vor zweieinhalb Jahrtausenden zusammengestellten biblischen Gebote. Lagen die Verfasser der Bibel irgendwie richtig damit, dass der Mensch von der »Erbsünde« belastet sei? Jedenfalls konnten bislang weder Religionen und Philosophien noch politische Ideologien und Staatsformen am Verhalten der Menschen etwas grundlegend verändern.
Warum das so ist und was daraus folgt, dazu vermittelt uns die nähere Betrachtung der Natur der Menschen zumindest Hinweise. Viel zu idealisiert wurde bisher und wird nach wie vor »der Mensch« behandelt, zu standardisiert mit der noblen »conditio humana«. Menschen sind jedoch zuvörderst biologische Wesen, keine davon abgehobenen oder gar unabhängig von der Natur gewordenen »Geister«. Ihre Entstehungsgeschichte, die Millionen Jahre zurückreicht, hat sie, hat uns alle geformt. Die Gegenwart liegt lediglich als Tünche darüber, zudem als eine, die sich rasch wandeln kann, wie wir aus Erfahrung wissen.
In diesem Buch plädiere ich dafür, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollen. Dann macht man sich keine falschen Hoffnungen. Selbstverständlich gehe ich nicht davon aus, eine umfassende oder hinreichend zutreffende Analyse bieten zu können. Jede Betrachtungsweise hängt zu sehr ab von der Zeit, in der sie vorgenommen wird, und sie ist unweigerlich stark persönlich eingefärbt. Aber wie die im ersten Teil behandelte Entstehungsgeschichte der Menschen von neuen Fakten und Entdeckungen modifiziert werden kann, können auch die Betrachtungen im zweiten und dritten Teil des Buches widerlegt, korrigiert oder durch bessere Befunde ersetzt werden. Ein Nachdenken über manche der vielleicht provokant wirkenden Ausführungen läge schon im Sinn des Buches. Das gilt insbesondere für meine drei Kernthesen, nämlich (1.) dass es »den Menschen« nicht gibt, (2.) dass die Natur der Menschen wirkmächtiger ist als ihr »Geist« und (3.) dass die Gegenwart ohne die Vergangenheit nicht zu verstehen und daher die Zukunft auf längere Sicht nicht zu planen ist.
Diagnose »Mensch«
Menschen sind Zweibeiner mit aufrechtem Gang, ziemlich großem, rundlichem Kopf und weitgehend nackter Haut. Mit diesen drei Merkmalen ließe sich der Mensch von anderen Lebewesen, insbesondere von den Menschenaffen, unterscheiden. Grundsätzlich, aber nicht absolut. Denn es gibt Zwischenbereiche, in denen diese Merkmale nicht so klar in Erscheinung treten. Das Problem der Abgrenzung wird an anderer Stelle ausführlicher erörtert. Hier soll genügen, anzumerken, dass wir unsere Nacktheit, von wenigen Ausnahmen in der inneren Tropenzone abgesehen, mit Kleidung zu bedecken pflegen. Sie ist nötig, denn ganz nackt würden wir in außertropischen Klimazonen zeitweise arg frieren. Dem Zweck des Warmhaltens dient Kleidung allerdings nur bedingt. Zumeist drückt sie weit mehr den menschlichen Hang zur Selbstdarstellung als den notwendigen Schutz aus. Die Zweibeinigkeit erreichen wir auch nicht gleich nach der Geburt. Es dauert ein Jahr oder etwas länger, bis wir uns vom unbeholfen vierbeinigen Krabbeln aufrichten und nach wackeligem Anfang schließlich weitgehend zweibeinig fortbewegen. Dass dies nicht so sein müsste, sehen wir an der großen Gruppe ganz anderer Zweibeiner, den Vögeln. Aus dem Ei geschlüpft oder ausgeflogen nach Verlassen des Nestes, bewegen sie sich am Boden sofort zweibeinig. Sie brauchen gegen Ende ihres Lebens auch keine Stützen, wie Stöcke, mit denen Senioren quasi dreibeinig gehen, von Gehwägelchen ganz zu schweigen. Vögel bleiben Zweibeiner bis zu ihrem Lebensende, so sie dieses natürlicherweise erreichen. Die dritte Eigenschaft, der im Verhältnis zu unserer Körpergröße so große Kopf, bereitet insbesondere bei der Geburt enorme Schwierigkeiten — bis zum Kopfzerbrechen geradezu. Für die allermeisten Menschen beginnt der sogenannte Eintritt ins Leben mit einer (sehr) schweren Geburt. Gut, dass wir uns daran nicht erinnern, was die Schmerzen der Gebärenden nicht mindert.
Diese drei Eigenschaften stehen aus guten Gründen am Anfang der Behandlung, denn sie stellen die weitaus bedeutendsten Neuentwicklungen in der Evolution des Menschen dar. Sie reichen zurück in die ferne Vergangenheit unseres Entstehungsweges. Zahlreiche weitere, nachgeordnete Neuerungen kommen hinzu und müssen bei der Behandlung unserer Ursprungsgeschichte als Aspekte der Kultur berücksichtigt werden. Zum Teil ergibt sich bei der Rekonstruktion des langen Weges zum Menschen ihre Einbeziehung von selbst. So hat die Menschheit eine globale Verbreitung erreicht, wie keine andere vergleichbare Art von Lebewesen, von Bakterien und Viren abgesehen. Sie nimmt keine »ökologische Nische« ein, sondern hat sich von der natürlichen Umwelt verselbstständigt, emanzipiert und sich eine eigene geschaffen. Zahlreiche Besonderheiten treten in speziellen Verhaltensweisen zutage, oder sie stecken in verborgenen Vorgängen unserer Körper, die uns zu schaffen machen oder zugutekommen. So zum Beispiel unser außerordentlich langes Leben. Mag es vielen Menschen auch viel zu kurz vorkommen, zumal wenn das Ende absehbar wird, so führt uns der Blick auf uns vertraute Tiere diese unsere Besonderheit deutlich vor Augen. Wir Menschen überleben unter halbwegs normalen Umständen nicht nur den Hund, den viele so sehr ins Leben mit einbinden, sondern auch weitaus größere Tiere wie Pferde oder Rinder. Das ist sonderbar, denn es gilt die biologische Regel, dass große Tiere allgemein eine größere Lebenserwartung haben als kleine. Diese und andere Abweichungen von der Lebensweise vergleichbarer Säugetiere werden uns in diesem Buch ebenfalls beschäftigen.
Die Erkenntnisse hierzu erweisen sich als höchst wesentlich für unser Leben. Langes Leben bedeutet mehr Krankheiten und gesundheitliche Schwierigkeiten, denen wir umso mehr ausgesetzt sind, je älter wir dank guter Lebensbedingungen werden. Zudem kann die Menschenfrau nach der Menopause, dem Ende ihrer Fortpflanzungsfähigkeit, etwa ein weiteres Drittel ihrer gesamten Lebenszeit erwarten. Warum ist das so? Warum blieb die Fortpflanzungsfähigkeit ihr nicht genauso lang erhalten wie dem Mann? Schließlich kommen wir für einen vertieften Blick auf die Natur der Menschen nicht umhin, uns mit der so problematischen Tatsache auseinanderzusetzen, dass es erhebliche Unterschiede im Aussehen gibt, am augenfälligsten in der Hautfarbe. Menschen sind einander äußerlich fremdartig, obgleich wir biologisch alle zu einer Art — Homo sapiens — gehören. Wie kann es da sein, dass Menschen andere Menschen wegen geringfügig anderen Aussehens entmenschlichen? Der Rassismus, der dahintersteckt, ist keine Besonderheit der Europäer und auch nicht allein Erblast ihres Kolonialismus. Es gibt ihn überall und es gab ihn wahrscheinlich zu allen Zeiten. Sogenannte »Naturvölker« pflegten sich selbst (sinngemäß) »Menschen« zu nennen, aber oft schon die ihnen benachbarten Stämme vom Menschsein auszuschließen. Und trachteten sie zu versklaven. Die Tendenz zur Abgrenzung gegen »die Anderen« reicht von offenem Rassismus über Stammesscharmützel bis zur Sonderung von Dorfgemeinschaften oder Bildung von Stadtviertel-Gangs. Seit alten Zeiten gibt es allerdings auch die Besonderheit der mehr oder weniger kurzfristigen »Verbrüderung« bei Festen mit dem berauschenden Hilfsmittel Alkohol. Gegenwärtig fahren insbesondere jüngere Menschen von fernen Kontinenten zu großen Volksfesten. Höchst seltsam, nicht wahr!
Noch fehlt in diesem kursorischen Überblick eine Eigenschaft der Menschen, eine die uns im Selbstverständnis erst so richtig zum Menschen macht, gleichzeitig aber äußerst wirksam trennt: die Sprache. Sie wird sich bei näherer Behandlung als schwierigster Aspekt des Menschseins herausstellen, gibt es doch — zumindest seit sehr langer Zeit — »die« Sprache gar nicht (mehr), sondern Tausende verschiedener Sprachen und noch mehr Dialekte. Allenfalls die Fähigkeit, Sprache zu entwickeln bzw. zu erlernen, gilt in der Menschheit als universell. Die Sprache wäre großartig genug, um sie als das höchste und beste unter den Kennzeichen der Art Mensch zu werten, wenn sie nicht auch die verhängnisvolle Eigenschaft hätte, sich in unterschiedlichste Dialekte und Sprachen aufzuspalten. Bis hin zum »kannnitverstaan«, mit dem sich bekanntlich schon die Verfasser der Bibel auseinandersetzen mussten. Sie schufen den Strafmythos der »babylonischen Sprachverwirrung«. Bei all den Schwierigkeiten, die mit der Differenzierung in verschiedene, wechselseitig nicht mehr verständliche Sprachen entstanden sind, kann man nur fassungslos den Kopf schütteln. Hatten die zur Sprache befähigten Menschen nichts Besseres zu tun, als sich mit diesem einzigartigen Verständigungssystem für andere Menschen unverständlich zu machen?
Diese Hinweise zum Beginn mögen und müssen genügen. Sie verraten, dass der Weg der Menschwerdung ziemlich verschlungen und skurril gewesen ist. Und dass wir mit der biblischen Selbsteinschätzung, »Krone der Schöpfung« zu sein, vorsichtiger umgehen sollten. Drücken wir die Lage zurückhaltend aus: Wo viel Licht, da fällt viel Schatten! Eine realistische, auf nachprüfbare Befunde aufgebaute Betrachtung von Entstehung und Wirken des Menschen muss die Schattenseiten genauso mit einbeziehen wie die großartigen Leistungen, mit denen sich Homo sapiens zur zentralen Wirkgröße in der Natur aufgeschwungen hat. Da helfen keine philosophischen Idealisierungen oder religiösen Hilfskonstruktionen, wie der Teufel. Wir alle müssen als Teile davon mit dieser sonderbaren Spezies leben wie unsere Vorfahren schon und die Nachfahren zukünftig auch. Allzu viele Menschen hat im Lauf der Geschichte das Leben mit ihresgleichen das Leben gekostet. Die mit weitem Abstand schlimmsten Feinde der Menschen sind andere Menschen, nicht Gefahren der Natur! Die Atombomben mit der möglichen Selbstvernichtung der Menschheit mahnen ein realistischeres Menschenbild an. Philosophischer Idealismus bringt wenig und nicht wirklich weiter. An der Verbesserung der Menschen scheiterten bislang alle Religionen, ausnahmslos. Wählen wir daher den viel bescheideneren Weg und fragen nach den Gründen und Hintergründen für die Probleme, die wir uns selbst machen und künftigen Generationen aufbürden. Das liefert konkretere Ansätze als die Ideologien zur Weltverbesserung, denen es an verlässlichen Diagnosen des Zustandes der Menschheit mangelt. Sie bewirken nur Schlimmeres. Das haben uns im letzten Jahrhundert die fatalen Experimente des Sozialismus, national, wie international, mit Millionen Toten gelehrt. Und die insgesamt noch verlustreicheren »Heiligen Kriege« in den Jahrhunderten davor.
Ideologien fielen nicht plötzlich vom Himmel. Sie hatten Vorgeschichte. Alle entsprangen sie dem zutiefst in den Menschen verankerten Prinzip: »Wir gegen die Anderen«. Wir wurden in grauer Vorzeit nicht einfach und plötzlich »Mensch«; wir wurden zu Menschen im Verlauf einer langen, Jahrmillionen zurückreichenden Entwicklungsgeschichte. Um diese geht es im ersten Teil des Buches, um die Evolution der Gattung Mensch Homo und um die unserer Art, die der schwedische Naturforscher Carl von Linné vor zweieinhalb Jahrhunderten mit dem wissenschaftlichen Namen sapiens in das System der Natur (systema naturae) eingefügt hatte — platziert nächst den Menschenaffen! Das hatte der Pastorensohn Linné keineswegs abwertend gemeint, als er dem Menschen auch (s)einen Platz im großen Gefüge der Natur zuwies. Vielmehr entsprach er damit den Empfindungen vieler, wenn nicht der allermeisten Menschen seiner Zeit und früherer Zeiten. Für diese war die Menschennähe der Menschenaffen und der anderen Affen eine Selbstverständlichkeit. Sie geriet nicht in Konflikt zu den religiösen Lehren, weil gemäß der biblischen Schöpfungsgeschichte, der Genesis, Gott alle Lebewesen und überhaupt alles geschaffen hatte. Und er sah, wie es geschrieben steht, »dass es gut war«! Nächst den (Menschen-)Affen zu stehen stellte keine Beleidigung des Menschseins dar. Eher sollte sich der Mensch über seine Nachbarschaft besser selbst erkennen, stand er doch »über der Natur« als »Ebenbild Gottes«. Wie sehr, mag für die christlichen Dogmatiker Auslegungssache (gewesen) sein.
Aber Christen waren nie die Repräsentanten der ganzen Menschheit und sind es auch heute nicht. In anderen Religionen und Kulturen war der Mensch von jeher nicht von der Natur getrennt, sondern integrierter Bestandteil. Dies übersieht die »westliche Sicht« in ihrer Überheblichkeit allzu geflissentlich, um ihre Philosophie, was der Mensch »ist«, nicht relativieren zu müssen. Wir haben uns im zweiten Teil damit vertiefter zu beschäftigen, weil die westliche Ideologie Weltgeltung beansprucht. Und verbindlich vorgeben will, wie »die Menschheit« zu denken hat und sich verhalten soll. Begeben wir uns nun nach diesen einführenden Worten zunächst auf den Weg der naturwissenschaftlichen Suche nach Fakten zu unserer Herkunft. Sie sind spannend genug und aufschlussreich für die Betrachtung unserer Absonderlichkeiten.
Teil eins
Mensch werden
Verwandtschaft
Orang-Utan bedeutet in der Sprache der Malaien Waldmensch. Offenbar nicht irgendwie symbolisch, sondern ziemlich direkt. Der Orang-Utan ist der südostasiatische Vertreter der drei Gattungen von Menschenaffen, die es noch gibt. Seine Menschenähnlichkeit lässt sich nicht leugnen, insbesondere wenn Orangkinder betrachtet werden, die »so verdammt menschlich wirken«, wie es immer wieder ausgedrückt wurde. »Ergreifend menschlich« wäre besser, treffender! Wer einem Orang-Utan in die Augen schaut, und sei es durch die Glasscheibe eines Geheges, in dem viele Menschenaffen noch immer einsitzen müssen, als ob sie etwas verbrochen hätten, wird sich selbst gespiegelt empfinden und vielleicht irgendwie schuldig fühlen. Denn wir wissen, dass es gegenwärtig zu den schlimmsten Strafen für Menschen gehört, eingesperrt zu sein. Und dabei auch noch »ausgestellt« zu werden, war in früheren Zeiten eine Verschärfung der Strafe. Sie hieß, »an den Pranger gestellt« zu sein. Angeprangert werden will niemand, am wenigstens in den sogenannten sozialen Medien im Internet unserer Zeit. Die »Hater« können die betroffenen Menschen vernichten. Im Tierschutz versuchen starke Gruppierungen die Zoohaltung von Menschenaffen verboten zu bekommen, weil diese eine ebenso ungerechtfertigte wie in unserer Zeit untragbare Freiheitsberaubung darstellt. Es sind Emotionen, die sich dabei ausdrücken; Emotionen, die keiner besonderen Begründung bedürfen. Wie vieles im Tierschutz auch. Wer einen Hund von klein an großgezogen und in die Familie integriert hat, weiß, wie stark die emotionalen Bindungen werden. Ebenso spürbar vonseiten der Hunde.
Doch halten wir kurz inne. Der Orang-Utan lebt (noch) in zwei sehr nahe verwandten Arten in den (schrumpfenden) Tropenwäldern von Borneo und Sumatra. Seine Haltung in Zoos bringt ihn uns zwar körperlich näher, dabei aber zwangsläufig in verfremdeter Form. Orang-Utans können sich nicht mit uns durchs tägliche Leben bewegen wie unsere Hunde. Bei ihren entfernteren Verwandten in Südasien, insbesondere in Indien, ist das anders. Mitten unter Menschen leben dort die schlanken, smarten Hanuman-Languren in Städten, sogar in Großstädten. Als »Tempelaffen« sind sie akzeptiert und trotz mancher Dreistigkeiten geschätzt, weil sie als lebende Repräsentanten des Affengottes Hanuman gelten. So ein Status ist deutlich mehr als die Zuordnung der Orang-Utans zur Gruppierung Mensch als Wald-Mensch. Der Hinduismus steht mit dem Affengott Hanuman nicht allein. Uns in Europa und den Abkömmlingen der europäischen Kultur in anderen Regionen der Erde lag vor Entstehung des Christentums historisch viel näher der altägyptische Gott Anubis, im gleichnamigen Pavian verkörpert. Das Leben des Steppenpavians, seinem ostafrikanischen Vetter, ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts intensiv erforscht worden, unter anderem von der Primatologin Shirley Strum. Das Buch, das sie (1987) über die Paviane publiziert hatte, trägt den Titel Almost human. In der Tat ähneln Teile des sozialen Verhaltens der Paviane menschlichen Verhaltensweisen eher noch stärker als das ohnehin schier unfassbar Menschliche im Leben der Schimpansen, die Jane Goodall und andere erforschten. Bei diesem Schnellüberblick begeben wir uns nach kurzem Zwischenstopp in Gibraltar von (Alt-)Ägypten und Ostafrika nach Südamerika. Am Felsen von Gibraltar genießen Berberaffen, buchstäblich, weil sie gefüttert und gepflegt werden, das Privileg, Schützlinge des gewiss ansonsten nicht sentimentalen britischen Empires zu sein. Weil es heißt, das Empire bricht dann zusammen, wenn die Affen den Felsen von Gibraltar verlassen (müssen). Nun kann man inzwischen zwar ziemlich skeptisch sein, was Zustand und Fortbestand des Empires betrifft, aber das ficht die Royal Navy nicht an, weiterhin das Leben der Affen zu sichern.
Göttlich wurden die Affen Mittel- und Südamerikas hingegen nie, sondern insbesondere in Amazonien vornehmlich gejagt und gegessen. Aber trotzdem waren und sind sie gern gehaltene, von klein an großgezogene Haustiere. Oft wurden sie von Frauen gestillt, die gerade selbst Babys hatten. Unter den Scharrbildern der Pampa von Nasca in Peru gibt es einen riesigen Affen, der nur bei genügender Höhe aus der Luft zu erkennen ist. Seine Bedeutung ist unbekannt. Affenköpfe wurden früher am Westrand Amazoniens zu Schrumpfköpfen anstelle solcher von Menschen verarbeitet und galten diesen als ziemlich gleichwertige Trophäen. Diese kurze globale Übersicht lässt sich mit den Schneeaffen Japans beschließen. Sie erfreuen sich dort nicht nur allgemeiner Wertschätzung, sondern auch einer besonderen Toleranz. Für westliche Augen ist es gewiss höchst befremdlich, dass diese Japanmakaken in heißen Quellen baden dürfen, sogar zusammen mit Menschen, obgleich die japanische Bevölkerung so hygienebewusst ist. Uns im Westen ist allenfalls am Rande bekannt, zumal wenn wieder einmal Aktionen gegen Tierversuche mit Affen durchgeführt werden, welch immense Bedeutung diese tatsächlich für die medizinische Forschung haben. Nicht nur Menschenaffen, auch andere Affen stehen uns biologisch so nahe, dass ihre Körper fast genauso wie unsere funktionieren. Eine Unverträglichkeit, die bei Menschenfrauen zum vorzeitigen Verlust des Fötus führt, wenn die väterlichen und die mütterlichen Anlagen hierin nicht zusammenpassen, war an Rhesusaffen entdeckt worden und ist als Rhesusfaktor bekannt. Affen sind uns zweifellos sehr ähnlich. Wie ähnlich, hat die moderne Molekulargenetik festgestellt.
Ihren Befunden zufolge sind die beiden Schimpansenarten, der Schimpanse im engeren Sinne, Pan troglodytes, und der Bonobo, Pan paniscus, mit nur ein wenig mehr als ein Prozent Unterschied im Erbgut biologisch unsere allernächsten Artverwandten. Die beiden (Unter-)Arten des GorillasGorilla gorilla folgen mit knapp eineinhalb und die Orang-Utans mit etwas über zwei Prozent. Wir, Homo sapiens, der Mensch als biologische Art, gehören mit ihnen zusammen zur Gruppe der Menschenaffen. Aufgrund der großen genetischen Nähe betitelte der weltbekannte amerikanische Evolutionsbiologe Jared Diamond in einem seiner höchst erfolgreichen Bücher uns Menschen als Der dritte Schimpanse (1992). Von den Pavianen, den Rhesusaffen, den Languren und anderen Affen trennen uns etwas größere genetische Abstände. Zwischen ihnen und den großen Menschenaffen liegen die Kleinen, die Gibbons und ihre Verwandten in Südostasien. Ins Detail zu gehen ist hier nicht nötig. Die genetischen Befunde sind bestens abgesichert und vielfach überprüft worden. Was sie in Zahlen, in Prozenten Unterschied, ausdrücken, entspricht unseren Empfindungen recht gut. Wir fühlen uns den Menschenaffen näher als den anderen Affen. Mit diesen gehören wir in eine Familie, die Primaten. Carl von Linné hatte diese bereits in seinem System der Natur eingeführt. Die Eindeutschung »Herrentiere« ist außer Gebrauch gekommen. Das ist gut so, weil die Primaten in Linnés System nicht auf die Herren, sondern auf die Spitzenposition bezogen waren und daher keiner geschlechtergerechten Sprachbereinigung bedurften. »Primaten« schmeichelt uns dennoch ähnlich wie sapiens. Ob zu Recht, das soll, wie schon angemerkt, im zweiten Teil näher behandelt werden.
An dieser Stelle halten wir fest, dass die moderne Biologie mit ihren Methoden vollauf bestätigt, was uns von den natürlichen Empfindungen her geläufig ist: die abgestuften Unterschiede in der Nähe zu uns Menschen. Schweine stehen uns offensichtlich ferner als Affen. Mit Schweinen und Rindern wird in der Massenviehhaltung gegenwärtig umgegangen, als ob sie keine Lebewesen wären, die Empfindungen haben. Undenkbar, Affen oder gar Menschenaffen so zu behandeln. Vögel stehen uns noch ferner als die Säugetiere, zu denen wir als Primaten gehören, neben Fledermäusen, Mäusen, Ratten und anderen, deren Junge mit Muttermilch aufwachsen. Mit Hühnern empathische Beziehungen aufzubauen fällt schwerer als mit Ratten, die zeitweise bei Jugendlichen recht beliebte Heimtiere waren. Bei den wohl Cleversten unserer Vogelwelt, den Krähenvögeln mit den Raben, lassen wir nach wie vor zu, dass Jäger Zigtausende zu ihrem Jagdvergnügen abschießen. Und bei den Fischen hört die allgemeine Empathie ohnehin weitestgehend auf. Was sie empfinden, wenn sie an den Angelhaken geraten, scheint allenfalls kleinen Randgruppen im Tierschutz einer ernsthaften Diskussion wert.
Noch weniger emotional gehen wir mit Insekten, Schnecken oder Würmern um. Sie liegen außerhalb unseres inneren Mitleids. Die gesamte Pflanzenwelt wird behandelt, als ob sie nicht lebendig wäre. Blumen, die Fortpflanzungsorgane von Blütenpflanzen, stellen wohl auch Veganerinnen als schmückenden Anblick in Vasen ins Zimmer. Vollends außerhalb der Sphäre von Anteilnahme liegen die anderen großen Reiche des Lebendigen, die die Pilze, Bakterien und Viren umfassen. Auf sie erstreckt sich die »Biophilie« nicht mehr, wie Edward O. Wilson in vielen Schriften und einem damit betitelten Buch darlegte. Seltsamerweise wird Steinen und Bergen eher wieder Wertschätzung zuteil. Edel-Steine werden als Schmuck getragen, ein Thema, das im zweiten Teil eingebunden im erweiterten Zusammenhang des Sich-Schmückens aufgegriffen wird, und Berge wurden vielfach zu Orten der Verehrung des Göttlichen. Auf einem Berg übergab Gott nach jüdisch-christlicher Tradition die »Zehn Gebote«. Offenbar waren strikte Gebote, wie eingangs schon angedeutet, bereits in dieser mythischen Zeit des Übergangs vom Dasein als nomadisch umherstreifende Jäger und Sammler zur sesshaften Lebensweise notwendig. Der Erfolg der Zehn Gebote hielt sich sehr in Grenzen, selbst innerhalb der jüdisch-christlichen Religion. Berggipfel »schmücken« Gipfelkreuze, die man aus allgemeiner Sicht wohl als Ersatz für die einstige mystische Verehrung der Berge als Sitz der Götter betrachten kann.
Mit allen Lebewesen verbindet uns also eine abgestufte Verwandtschaft. Sie umfasst alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und erstreckt sich über die nächstverwandten Menschenaffen, die anderen Primaten und die Säugetiere hinein in die ganze Fülle des Lebendigen. Die Verwandtschaft nimmt uns aber keine Eigenständigkeit. Als Menschen sind wir eindeutig verschieden von den Menschenaffen und im Wortsinn »einzig-artig«. Es gibt keine Zwischenformen. Wir haben keine Mühe, Schimpansen als Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans als solche zu erkennen oder Paviane, Languren und so fort. Die Unterschiede können augenfällig sein, wie zwischen Schimpansen und Gorillas, oder geringer, sodass eine genauere Betrachtung nötig ist, wie bei Schimpansen und ihrer Zwillingsart, den Bonobos. Noch ähnlicher sehen sich untereinander die Orang-Utans von Borneo und Sumatra. Sie werden erst seit Kurzem als zwei eigenständige Arten betrachtet.
Hierzu kann man aus biologischer Sicht jedoch geteilter Meinung sein. Arten lassen sich nicht einfach und eindeutig festlegen, geschweige denn hinreichend sicher begründen. Warum die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten nicht ungefähr gleich groß (und damit ganz klar) sind, ergibt sich aus den Prozessen der Bildung von Arten und deren Zeitdauer. Als Faustregel gilt: Je länger die Trennung von den gemeinsamen Vorfahren zurückliegt, desto größer sind die genetischen Unterschiede und umso besser lassen sich die Arten erkennen — und umgekehrt. Diese Gegebenheit führt uns hinein in die Dimension der Zeit, in die Vergangenheit. Denn was wir gegenwärtig vorfinden, ist ein Zustand, der sich über lange Zeitspannen entwickelt hat und der nicht etwa deshalb abgeschlossen ist, weil wir unsere Schlüsse daraus ziehen, sondern der weiterlaufen wird.
Ein Blick auf unsere persönlichen Familiengeschichten drückt dies deutlich genug aus. Jeder Mensch hat eine familiäre Vorgeschichte aus Vorfahren, die oft verblüffend komplex ist, wo die Nachforschung dies genauer ausbreiten kann. Das zeigen die genetischen Untersuchungen, die in unserer Zeit möglich geworden sind. Genaue genetische Analysen sind nicht mehr teuer. Man kann sie sich privat erstellen lassen. Jeder Mensch weiß mit Blick auf eigene Kinder und Enkel, so vorhanden, wie es aussieht mit der möglichen Zukunft seiner Nachkommen. Wer ohne Nachkommen geblieben ist, hat keine Zukunft mehr. Dies einzusehen bedarf keiner tiefschürfenden Überlegungen. Zusammengefasst heißt es, die Vergangenheit wirkt über die Gegenwart in die Zukunft. Das Leben ist ein historischer Prozess, kein fester Zustand. Davon müssen wir ausgehen, wenn wir uns selbst, die Menschheit und die Zukunft der Erde verstehen wollen.
Blicken wir zuerst weiter zurück. Nicht zu den »Anfängen«, denn solche hat es im Strom des Lebens nicht gegeben. Sondern in jene Vergangenheit, in der unsere Linie, zu der wir gehören, noch nicht abgetrennt war von den nichtmenschlichen Primaten.
Der Weg zu den Ursprüngen
Wie wir gesehen haben, sind die Menschenaffen die uns nächstverwandten Arten. Zudem gehören wir wie sie zu den Säugetieren, den Mammalia. Damit können wir unsere Eigenheiten einordnen und vergleichen. Um die drei eingangs genannten Hauptmerkmale unseres Körperbaus soll es zuerst gehen. Bei diesen handelt es sich um buchstäblich sicht- und greifbare Anatomie, die uns ganz unabhängig von philosophischen Vorstellungen oder religiösen Sichtweisen eigen ist. Greifbar, weil wir Knochen von unserem Skelett mit denen von Schimpansen und anderen Primaten vergleichend untersuchen können. Und die mit dem Körperbau verbundenen Leistungen dazu. Was geht aus dem Vergleich der Zustände hier und jetzt hervor? Das ist die erste und einfacher zu behandelnde Frage. Die zweite betrifft das Zustandekommen. Wenn wir, wie es die genetischen Vergleiche anzeigen, so nahe mit den Menschenaffen verwandt sind, muss es irgendwann in fernerer Vergangenheit einen gemeinsamen Vorgänger gegeben haben. Diesen aufzuspüren und den Weg der Menschwerdung über die Veränderungen im Körperbau zu verfolgen stellt die zweite Aufgabe in diesem Teil dar.
Der erstgenannte Unterschied ist offensichtlich. Wir brauchen uns nur mit in Zoos gehaltenen Schimpansen und anderen Primaten zu vergleichen. Anders als sie alle sind wir aufrecht gehende Zweibeiner mit weitgehend nackter Haut. Diese beiden Unterschiede sind eindeutig. Nicht so direkt hingegen lässt sich die relative Kopfgröße erkennen. Denn der Gorilla hat einen gewaltigen, unseren erheblich übertreffenden Schädel. Schimpansenkinder wirken auf den ersten Blick jedoch menschlich in den Proportionen von Kopf und Körper. Stellen wir die Kopfgröße kurz zurück. Sie wird als tatsächlich ganz beträchtlicher Unterschied zu den anderen Primaten erst dann wichtig, wenn wir sie im Zusammenhang von Geburt und Wachstum des Kopfes nach der Geburt betrachten — bezogen auf die Körpermasse der Erwachsenen. Aufrechter Gang und Nacktheit sind auch voneinander zunächst getrennt zu behandeln, weil die Zweibeinigkeit eine bedeutende anatomische Veränderung darstellt, die weitgehende Verminderung der primatentypischen Behaarung aber sehr eigenständig, ja eigenartig ist. Tragen doch alle Primaten und die allermeisten Säugetiere ein mehr oder weniger dichtes Fell. Die Ausnahmen bilden Arten, die uns offensichtlich nicht gerade nahe verwandt sind, wie die Nilpferde und die Elefanten oder der maulwurfsähnlich unterirdisch lebende Nacktmull. Meeressäugetiere, wie die großen Wale und die Delfine ohne Fell bilden ohnehin eigene, gänzlich anders geartete Gruppierungen von Säugetieren.
Also zuerst zum aufrechten Gang: Schimpansen und andere Menschenaffen schaffen die zweibeinige Fortbewegung nur auf kurzen Strecken. Dabei halten sie sich mehr oder weniger stark vornübergebeugt. Jüngere Schimpansen, die sich öfters zweibeinig aufrichten, sehen aus, als ob sie wie Kleinkinder mit Windeln laufen. Der aufgerichtete Gang ist offensichtlich sehr mühsam für Schimpansen. Er wird dann angewandt, wenn es darum geht, etwas Wichtiges gezielt wegzutragen, wie ein Büschel Bananen oder einen Gegenstand beim Spielen im Zoogehege. Sobald eine nennenswerte Wegstrecke zurückgelegt werden soll, wechseln Schimpansen und Gorillas in den vierbeinigen Knöchelgang. Dieser wird so genannt, weil sie dabei die Hände faustartig einsetzen und nicht flach wie Füße auf den Boden aufsetzen.
Orang-Utans gehen zwar auch auf diese Weise, aber nicht allzu gern. Sie hangeln sich lieber im Geäst weiter, ähnlich wie die als Kleine Menschenaffen zusammengefassten Arten der Gibbon-Gruppe. Dieses ihr Schwinghangeln drückt sich im Verhältnis der Arm- zur Beinlänge klar aus. Orang-Utans und Gibbons sehen auf dem Boden aus, als ob sie nicht so recht wüssten, wohin mit den Armen. Vielfach balancieren sie damit halb ausgestreckt wie auf großen Ästen in den Baumkronen, bevor sie zum Schwinghangeln wechseln. Bei Gorillas und Schimpansen ist die Überlänge der Arme nicht so ausgeprägt. Dennoch sind sie in ihren Proportionen von Arm- zu Beinlänge klar von den Menschen verschieden. Übrigens drücken sich diese Unterschiede auch aus in den Körperkräften. Menschliche Brachialgewalt unterliegt klar der von Schimpansen und Gorillas oder Orang-Utans, zumal wenn die Kraft auf gleiche Körpermasse bezogen wird.
Vereinfacht ausgedrückt: Körperkräfte und Leistungsfähigkeit sind beim Menschen zu den Beinen verlagert. Dass die Menschenaffen zudem ungleich besser im Klettern als Menschen sind, bedarf kaum einer Betonung. Wenn sich große alte Silberrücken-Männer der Gorillas dabei schwertun oder dies vermeiden, drückt sich lediglich ihr zu hohes Gewicht darin aus. Menschenmänner mit 100 Kilogramm sind auch keine Turn- und Kletterkünstler. Hinzu kommt, dass der Fuß der Menschen erheblich anders gestaltet ist als der aller Menschenaffen und anderer Primaten. Wir sehen dies beim Vergleichen unserer Füße mit den Händen. Diese ähneln weit stärker denen von Menschenaffen als die Füße. Beinlänge, Fußform und Verhältnis von Beinen zur Körperlänge charakterisieren die Menschen anatomisch eindeutig, und zwar als Läufer! In dieser Eigenheit unterscheiden wir uns am stärksten von allen Primaten und auch allen übrigen Säugetieren. Wie sich das auswirkt, wird gleich etwas näher ausgeführt.
Ein kurzer Einschub soll die Besonderheit als Zweibeiner weiter verdeutlichen. Bezug sind die Vögel. Viele Vögel sind ausgeprägte Läufer, zumal die größten Arten, wie die Straußenvögel, aber auch kleinere, wie die Trappen, die mit ihrem Körpergewicht an die Grenzgröße zur Flugfähigkeit reichen. Diese liegt bei etwa 20 bis 25 Kilogramm. Gute Läufer sind die uns vertrauten Hühner, sofern es sich nicht um arg überzüchtete, zu schwer geratene Formen handelt. Zwar pflegen wir das Charakteristische der Vögel in ihrer Flugfähigkeit zu sehen, der die Menschen früher oft so sehnsuchtsvoll nachblickten, wenn sie »frei wie ein Vogel« sein wollten. Aber ein großer Teil der Vogelarten kann gar nicht fliegen. Diese sind dann umso bessere Läufer oder Schwimmer und Taucher, wie die Pinguine. Deren Lebendgewicht zusammengerechnet dürfte die Gesamtmasse der flugfähigen Vögel durchaus übertroffen haben, bevor die Menschen mit ihrem Massenfischfang die Häufigkeit der Pinguine so sehr beeinträchtigten.
Der Seitenblick auf die Vögel ist in zweierlei Hinsicht gerechtfertigt. Erstens zeigen sie mit den unterschiedlichen Formen ihrer Füße, insbesondere mit der Anzahl und Ausrichtung der Zehen, ein ganzes Spektrum von Anpassungen an das Laufen. Der menschliche Fuß ist nicht die einzig mögliche Variante und sicherlich nicht die beste Version. Wichtiger noch ist der zweite Aspekt. Die echten Laufvögel bewegen sich nicht zweibeinig wie wir mit in die Senkrechte aufgerichtetem Körper und Kopf. Vielmehr tragen sie beide ziemlich waagerecht. Ihr mehr oder weniger langer Hals bringt den Kopf in die Höhe, doch wiederum mit dem Unterschied zu uns, dass dieser nicht wie bei uns der Halswirbelsäule oben aufsitzt, die die Schwere von Schädelknochen und Gehirn ausbalanciert tragen muss. Und mitunter noch viel größere Gewichte, etwa wenn Menschen Wasserkrüge, Nahrungsmittel oder Holz auf dem Kopf zu ihren Wohnstätten tragen. Diese anders geartete Körperstruktur des aufrecht gehenden Menschen im Vergleich zu den gleichfalls zweibeinigen Vögeln zeitigt Folgen in anderen, zunächst nicht erwarteten Bereichen. Sie seien hier nur angedeutet: Schwere Geburt durch den engen Beckenring, der nicht weiter werden durfte, weil sonst die Gedärme hinausdrücken würden. Bei der waagerechten Körperhaltung der zweibeinigen (Lauf-)Vögel treten solche Schwierigkeiten nicht auf. Sie können sogar vergleichsweise riesige Eier legen, wie etwa die Kiwis von Neuseeland. Bei ihnen macht das Ei ein Drittel des Weibchenkörpers aus. Dieser Hinweis soll hier genügen, weil der schweren Geburt des Menschenkindes eine vertiefte Betrachtung zu widmen ist. Mit zwei anderen Folgen der aufgerichteten Bewegungsweise sind viele, letztlich alle Menschen konfrontiert, wenn sie alt genug werden. Unsere Wirbelsäule erweist sich als nicht stabil genug, ein ganzes langes Leben lang den aufgerichteten Körper zu tragen und häufig schwere Arbeit in gebückter Stellung auszuhalten. Wir neigen zum angenehmeren Sitzen und beeinträchtigen mit zu viel Sitzen die Stabilität von Wirbelsäule und Bandscheiben noch mehr. Von den Vögeln kennen wir solche Probleme nicht. Ein altes Huhn steht und sitzt nachts »stehend« auf der Stange genauso wie die jungen Hühner. Ein automatisch wirkender Zehengriff verhindert das Herunterfallen im Schlaf. Die Pinguine, als die in ihrer aufrechten Körperhaltung am menschenähnlichsten unter den Vögeln, zählen hier nicht, weil sie den weitaus größten Teil ihrer Fortbewegung schwimmend und tauchend ausführen, also dabei vom Wasser getragen werden. Ihr Watscheln an Land fällt viel unbeholfener aus als unser Gehen, vom Laufen ganz abgesehen.
Zurück zur zweibeinigen Fortbewegung des Menschen und dem Vergleich mit dem Knöchelgang der großen Menschenaffen oder, allgemein, dem vierbeinigen Laufen der Primaten am Boden. Schimpansen sausen damit sehr schnell. Auf kurzer Strecke hätten wir keine Chance, ihnen zu entkommen. Doch dies gilt sogar für aus unserer Sicht so unförmige Dickhäuter wie Nilpferde. Tatsächlich fällt es schwer, die Vorteilhaftigkeit des aufrechten Gangs zu begründen, wenn lediglich kurze Strecken berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass wir aufgrund der anatomischen Veränderungen viel schlechter im Erklettern von Bäumen oder von felsigem Gelände geworden sind als die Schimpansen. In ihren Augen müsste das Freestyle Climbing fitter junger Menschen wie eine Zeitlupendarbietung wirken, über die sie sich köstlich amüsieren könnten. Das höchst mühevolle Klettern an steilen Felswänden, nur um diese zu »bezwingen«, würden sie höchstwahrscheinlich für sinnlos und lebensgefährlich halten, was es de facto häufig auch ist. Es sei denn, in solchen Leistungen wird ein Wert an sich empfunden. Darauf ist zurückzukommen, wenn es um die inneren Belohnungssysteme mit Freisetzung von Endorphinen und ihre Rolle für das Verhalten von Menschen geht.
Die Sachlage ist insoweit klar, als die Aufrichtung des Körpers in die zweibeinige Fortbewegungsweise weder die Qualität und Stabilität der Laufvögel erreicht noch kurzfristige und unmittelbare Steigerungen der Geschwindigkeit, etwa bei notwendiger Flucht. Erschwerend kommt hinzu, dass unsere nächste Primatenverwandtschaft in Wäldern lebt und das Klettern und Hangeln für sie von zentraler Bedeutung ist. Die gemeinsamen Vorfahren von Schimpansen und Menschen sollten daher entweder auch Waldbewohner gewesen sein, oder die weiteren Entwicklungen verliefen nach der Trennung in unterschiedliche Richtungen: hinein in die Wälder mit Verbesserung von Kletterfähigkeit und Schwinghangeln bei den Menschenaffen und weiter hinaus ins offene Land bei der Entwicklung zum Menschen.
Beide Sichtweisen werden in der Forschung zum Ursprung der Menschen vertreten, allerdings mit recht unterschiedlicher Gewichtung und ungleicher Zahl der Forscherinnen und Forscher, die sie jeweils favorisieren. In neuerer Zeit interessierten sich die darüber berichtenden Medien vornehmlich für die, wie man es nennen könnte, feministischen Deutungen von Forscherinnen, die zusammengefasst von der Wissenschaftsjournalistin Elaine Morgan sogar so weit gehen, die entscheidende Umbildung vormenschlicher Primaten zur Stammeslinie der Gattung Homo ins Wasser zu verlagern. Als sogenannte Wasseraffentheorie ist diese Sichtweise bekannt, aber allgemein wenig angenommen geworden. Sie wird in unterschiedlichem Zusammenhang immer wieder eine gewisse Rolle spielen. An dieser Stelle soll sie nicht weiter ausgebreitet werden, weil der anatomische Befund, dass wir unserem Körperbau zufolge Läufer sind, zu gewichtig dagegensteht. Bei der Behandlung der Nacktheit ist ohnehin alsbald darauf zurückzukommen. Folgen wir daher dem inzwischen in der Forschung zur Evolution des Menschen als klassisch zu bezeichnenden Szenario. Dieses geht davon aus, dass die Vormenschen von den Waldrändern den Weg hinaus in die Savanne genommen hatten und sich ihr Körperbau im Verlauf langer Zeiträume daran angepasst hat. Der zweite, ungleich bedeutendere Befund zum zweibeinigen Gang, nämlich die Leistungen im Laufen, bildet hierfür die solide Grundlage. Denn der Mensch ist tatsächlich der beste Läufer; der bei Weitem beste sogar. Diese Feststellung verdient es, genauer erläutert zu werden.
Marathonläufer
In Leichtathletikwettkämpfen sind der 100-Meter-Sprint und der Marathonlauf die beiden Königsdisziplinen. Sie repräsentieren die Enden des Spektrums von der nur kurz durchzuhaltenden Spitzengeschwindigkeit bis zum Dauerlauf. Im Sprint sind allerdings die Schnellsten den Guten unter den Säugetieren vergleichbarer Körpergröße unterlegen. Sogar Nilpferde, plumpe Dickhäuter, übertreffen, wie schon angemerkt, die Spitzenleistungen sprintender Menschen. Gegen wirklich schnelle Renner, wie den Schnellsten von allen, den Geparden mit über 100 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit, oder die kaum langsameren Gazellen und Windhunde blieben sie chancenlos.
Sind Vergleiche von Sprints überhaupt sinnvoll? Warum sollten unsere einstigen Vorfahren im Zuge ihrer Menschwerdung Höchstleistungen dieser Art angestrebt und nach und nach verbessert haben, wenn wir Löwen oder Wölfen immer noch nicht davonlaufen können? Die in fast allen evolutionsbiologischen Erörterungen gängige Antwort geht dennoch von der Flucht vor Feinden aus. Der Volksmund hält offenbar nicht allzu viel von so einer Deutung, weiß er doch, dass »den Letzten die Hunde beißen«. Ohne hier schon näher auf die Lebensbedingungen der Vor- und Frühmenschen in der (afrikanischen) Savanne einzugehen, sei vermerkt, dass Kinder, schwangere Frauen und ältere Menschen weitaus gefährdeter gewesen sein müssten als die am schnellsten rennenden Männer. Für das Weiterkommen von Familiengruppen und Horden zählen aber genau die schnellen jungen Männer am wenigsten, Frauen und Kinder hingegen am meisten. Auf junge Männer wird bis in die Gegenwart am ehesten verzichtet, wie die Zusammensetzung der Kampftruppen zeigt, die in Kriege geschickt werden. Als Anmerkung zu den kleinen Kindern sei hier bereits vermerkt, dass sie mit ihrem durchdringenden Geschrei Angriffe von Raubkatzen geradezu auslösen müssten. Wären Verluste an sogenannte natürliche Feinde im langen Prozess der Menschwerdung wirklich bedeutsam gewesen, müssten die Menschen anders aussehen, anderweitige Fähigkeiten entwickelt haben, und es dürfte kein Baby- und Kindergeschrei geben. Wer erlebt hat, wie Lämmer geboren werden und was sie kurz nach ihrer Geburt bereits zu leisten haben, um selbst unter Bedingungen der Tierhaltung richtig ins Leben zu kommen, wird sich des riesigen Unterschieds zum Menschenkind rasch voll bewusst werden. Um es nochmals und nachdrücklicher zu betonen: Von Frauen und Kindern hängt es ab, wie sich Familien, Gesellschaften und Völker entwickeln, weit weniger von Zahl und physischer Leistungsfähigkeit der Männer.
Bedeutet dies, dass die Einstufung des Menschen als Läufer die Argumentation in eine Sackgasse manövriert hat? Das wäre nur dann der Fall, wenn wir im Sprintvermögen den Schlüssel zum evolutionären Wandel und zum Erfolg suchen würden. Der Hinweis auf das gefährlich sprintende Nilpferd, das von den Afrikanern aus guten Gründen mehr gefürchtet wird als Löwen, drückt aus, dass wir damit viel zu kurz gegriffen hätten. Nilpferde sind keine Sprinter geworden, um vor irgendeinem anderen Tier erfolgreich zu flüchten. Sie können sprinten aufgrund der Leistungsfähigkeit ihrer Muskeln und ihres säugetiertypisch vierfüßigen Körperbaus. »Um zu«-Erklärungen sollten stets mit großer Vorsicht betrachtet werden. So direkt verwendet liegen sie zumeist ziemlich falsch.
Zurück zum Menschen als Läufer. Um diese unsere Besonderheit zutreffend einordnen zu können, müssen wir den Dauerlauf betrachten, also das andere Ende des Spektrums der Laufleistungen. Hierin sind »wir« tatsächlich spitze. Selbstverständlich nicht wir alle, zumal nicht all jene, die von Kindheit an zu wenig Bewegung mit zu viel sitzender Lebensweise hatten und damit zu füllig geworden sind. Aber dies sind sekundäre Effekte unserer Zeit des Überflusses an noch dazu sehr kalorienreicher Nahrung. Vielmehr geht es um menschliche Körperformen, die unserem Skelettbau und den Besonderheiten von Fuß und aufrechter Haltung entsprechen. Mit dazu passender Muskulatur nämlich und einer Ernährung, die nicht oder allenfalls kurzzeitig belastet. Dass Menschen unserer Zeit, die sich auf das Laufen spezialisieren, eine entsprechend passende Lebensweise zu führen haben, ist nicht nur ihnen bewusst. Wir alle, die wir vom Ideal abweichen, wissen darum. Manche kämpfen für eine sportliche Figur und trainieren hart dafür, ohne an Laufwettbewerben teilnehmen zu wollen. Zunehmend mehr werden es, weil wir die großen gesundheitlichen Risiken von Übergewicht und falscher Ernährung kennen und fürchten müssen. Letztlich strebt man mit Sport einen Zustand an, der wieder zu Läuferinnen und Läufern mit Ausdauer (!) machen würde. Die Erfolge, die Initiativen wie »Lauf 10« des Bayerischen Fernsehens erzielten, und die wachsende Zahl von Menschen, die an Langstreckenläufen teilnehmen, bekräftigen diese Sichtweise. »Lauf 10« hat zum Ziel, durch entsprechende Umstellung im Essen und über konsequentes Training die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, 10 Kilometer zu laufen. Seit einigen Jahrzehnten wissen wir, dass unser Körper aus sich heraus das Laufen und andere, körperlich anspruchsvolle Sportarten mit der Ausschüttung von Endorphinen belohnt. Mit dem Gefühl der Hochstimmung, die sie auslösen, entsprechen die Endorphine den Opiaten. Das sind Wirkstoffe, die süchtig machen können. Dass längerer Lauf vom damit geschundenen Körper selbst belohnt wird, unterstreicht die Bedeutung dieser Fortbewegungsweise. So ein Belohnungssystem muss triftige (Hinter-)Gründe haben.
Die solcherart geförderte Leistungsfähigkeit ist enorm. Menschen schaffen nicht nur Marathondistanzen von 42,2 Kilometern, sondern beträchtlich längere Strecken bei Ultra-Marathonläufen. Diese reichen über 100 Kilometer am Stück und bis zu etwa 600 Kilometern in einer Challenge. Als ultimative Steigerung sind sie zusammengefasst im Ironman-Wettbewerb mit Marathonlauf, 180 Kilometer Radfahren und 3,8 Kilometer Schwimmen: Gesamtdistanz 226 Kilometer. Kein land-, d.h. bodengebundenes Lebewesen schafft so etwas. Schon einen Marathonlauf halten fast alle vierfüßigen Säugetiere unmöglich durch. Am nächsten kommen dieser Leistung speziell trainierte Schlittenhunde. Aber nur, wenn der Lauf in hinreichend kalter Gegend stattfindet. Ansonsten würden sich ihre Körper hoffnungslos überhitzen. Die notwendige Kühlung durch Thermoregulation verweist auf die Bedeutung der Nacktheit, die gleich behandelt wird. An ihr hängt die Fähigkeit des Menschen, auf ganzer Körperoberfläche höchst effizient zu schwitzen. Sie ermöglicht es bei anhaltender Anstrengung, den Körper kühl genug zu halten, nicht wie bei den Hunden nur mit heraushängender Zunge und feuchten Pfotensohlen. Damit schaffen selbst gut trainierte Hunde nicht annähernd die extremen Laufleistungen von Menschen.
Mit ihrer Fähigkeit zum Dauerlauf waren Menschen in ihrem nomadischen Urzustand in der Lage, jedes größere flüchtende Säugetier einzuholen, das sich nicht in ein unzugängliches Loch im Boden zurückziehen und damit der Verfolgung entziehen konnte. Auch ein Pferd ließ sich müde laufen, obwohl Pferde an sich eine besondere Ausnahme sind, die sie in gewisser Weise dem Menschen ähnlich und als Reittier geeignet macht. Denn wie der Mensch verfügt das Pferd mit der Milz über einen bedeutenden Blutspeicher. Bei den Rinderartigen, zu denen auch die Antilopen und Gazellen gehören, und bei den Huftieren ganz allgemein wirkt die Milz mehr als Organ der Entgiftung der vom Blutkreislauf aufgenommenen Stoffe. Mit Seitenstechen macht sich die Milz bei uns bemerkbar, wenn wir ohne angemessenes Vortraining zu lange oder zu schnell laufen. Welche Konsequenz dies hat, lässt sich mit etwas Glück ganz unmittelbar auf einer Safari in einem afrikanischen Wildschutzgebiet erleben, wenn ein Gepard sich an eine Gazelle anschleicht und sie mit einem blitzartigen Sprint zu erbeuten versucht. Beide rennen dabei um ihr Leben. Die Gazelle direkt, weil sie getötet wird, so sie der Gepard erwischt. Dieser aber auch, weil er umkommt, wenn es ihm nicht gelingt, genügend Gazellen zu erjagen. In der Evolutionsbiologie gilt die Wechselwirkung zwischen Gepard und Gazelle als Musterbeispiel eines biologischen Wettrüstens in Richtung auf immer größere Geschwindigkeit: Schnelle Katzenbeine machen schnelle Gazellenbeine. Jeder noch so geringe Vorteil der einen gerät der anderen Seite zum Nachteil. Hinreichend stabil ist ein mittlerer Zustand, bei dem sowohl die Geparde im nötigen Maße Beute machen, die Gazellen aber gut genug überleben, zumal die Jungtiere. Diesen gelten die meisten Jagden der Geparde.
Dieser Seitenblick auf ein sogenanntes Räuber-Beute-System bekräftigt, dass bei der Menschwerdung die Verbesserung des Sprintens keine Bedeutung gehabt haben konnte. Andere, wie eben die Geparde, aber auch Löwen und weitere Raubkatzen, waren längst erfolgreich in ähnlichen Jäger-Gejagte-Verhältnissen. Die Vor- und Frühmenschen wären da von Anfang an hoffnungslos im Nachteil gewesen. Bei der Verbesserung ihrer Leistungen im anhaltenden Lauf sieht die Lage hingegen anders aus. Das obige konkrete Beispiel des Gepardensprints hat nämlich häufig ein Ende, bei dem beide völlig erschöpft wenige Meter voneinander entfernt verharren, bis sie sich wieder erholt haben. Der Gepard ist nicht mehr in der Lage, die letzten Meter durchzuhalten, die es bis zur Gazelle zu schaffen gälte. Und diese rennt nicht unnötig weiter, sobald sie bemerkt, dass der Gepard nicht mehr kann. Noch häufiger gibt dieser bereits nach kurzer Sprintstrecke auf, weil er erkennt, dass er nicht gut genug aufholen kann. 100 bis 200 Meter Sprint bilden oft die kritische Distanz. Wäre ein Mensch, ein Jäger aus der Gruppe der San-Buschleute der Kalahari zum Beispiel, auf Gazellenjagd, würde dieser den Sprint gar nicht erst starten, sondern das ins Auge gefasste Beutetier abzudrängen versuchen auf ein möglichst offenes Gelände, auf dem er dieses anhaltend bis zur Ermüdung verfolgen kann. Mit dieser Langstrecken-Hetzjagd ist der Mensch als Jagdmethode konkurrenzlos einzigartig. Lediglich im Rudel jagende Wildhunde oder Wölfe außerhalb Afrikas erzielen vergleichbar gute Erfolge. Doch auch die Menschen pflegten in Gruppen zu jagen, bevor die weit reichenden Gewehre das Erschießen auf Distanz ermöglichten.
Folgen wir dieser Argumentation, gestützt auf die Leistungen von Menschen im Dauerlauf und verbunden mit dem inneren Belohnungssystem der Ausschüttung von Endorphinen, so wird die anhaltende Verfolgung von größeren Tieren zur plausiblen Erklärung für die Entwicklung von zweibeinigem Gang und Läuferstatur. Führte der Weg zum Menschen also über eine Umstellung in der Ernährung, von einem mehr oder weniger von Pflanzen lebenden Primaten vom Typ der Menschenaffen zum Beute machenden Raubaffen, als den der bekannte südafrikanische Paläontologe Raymond Dart den Frühmenschen aufgefasst und charakterisiert hatte? Die heutigen Jäger pflegen ihre Passion auf dieses uralte Erbe zurückzuführen. Beute zu machen stecke ihnen im Blut und die Jagd gebe enorme, endorphinbegleitete Befriedigung. Vielleicht verraten die Jägerinnen mehr dazu, die in unserer Zeit in zunehmender Zahl auch auf die Jagd gehen. Indirekte Äußerungen im Jägerverhalten könnten darauf hindeuten. Dennoch bleibt das Problem, dass Jäger nur eine Minderheit in den Bevölkerungen darstellen. In Deutschland sind sie mit nur gut einem Prozent vertreten. Der Anteil der Jägerinnen ist mit Hundertstelprozenten verschwindend gering.
In anderen Ländern gibt es zwar unterschiedlich große Jägeranteile, aber insgesamt kann die Jagdausübung in Europa und bei den Abkömmlingen der Europäer global nicht als repräsentativ für die Menschheit angesehen werden. Was die Bezeichnung »Jäger-und-Sammler-Kulturen« bedeutet, erschließt sich aus den bloßen Worten nicht hinreichend. Stellen wir daher diesen Aspekt besser noch zurück. Denn hier geht es um die ungleich bedeutendere Frage, ob Jagderfolge durch Verfolgung mit Dauerlauf die entscheidende Triebkraft für die Evolution des Menschen aus vormenschlichen Primaten gewesen sein können. Ein gewichtiger Einwand liegt auf der Hand. Da es Raubtiere, die Beute machen, längst vor Entstehung der Menschen gegeben hat, stellt sich das gleiche Problem wie beim Sprint. Solange die Vormenschen noch wackelig auf ihren Beinen waren, hätten sie keine Chancen gehabt, den flinken, leichtfüßigen Gazellen oder Antilopen zu folgen. Die Ausdauer macht sich erst bezahlt, wenn der Laufapparat, um es so technisch auszudrücken, entsprechend optimiert ist. Doch genau dies dauert lange; viel zu lange für einen direkten Weg von Primaten, die Früchte und Triebe oder Knollen von Pflanzen verzehren, zu erfolgreichen Jägern. Wiederum gilt, ein unmittelbares »um zu« geht nicht. Zusätzlich ist zu fragen, wozu sie denn gut gewesen sein soll, die Fähigkeit zum ausdauernden Laufen. Denn wie wir heutigen Menschen verfügten auch unsere fernen Vorfahren über keine langen Krallen und spitzen Zähne zum Töten größerer Tiere. Tödliche Waffen mussten erst erfunden werden. Eine Gazelle mit bloßen Händen zu erwürgen, mag der mythische Herkules gekonnt haben. Als Ziel der Entwicklung zum Menschen ist das nicht vorstellbar.
Sortieren wir die Fakten an dieser Stelle. Sicher ist, dass wir unserer Statur nach sehr gute Dauerläufer sind. Geworden sind, um es präzise auszudrücken. Sicher ist auch, dass unsere nächsten Verwandten unter den Primaten, die beiden Arten von Schimpansen, keine Krallen, aber immerhin große spitze Zähne zum Töten von Tieren haben. Die Schimpansen jagen auch immer wieder mal, wie die Langzeituntersuchungen von Jane Goodall und anderen gezeigt haben. Kleine Antilopen oder kleinere Affen zerreißen sie mit einer die damaligen Forscherinnen erschreckenden Gier. Aber dies geschieht mit blitzartigen Überfällen in gemeinschaftlichem Zusammenwirken der Schimpansenmänner. Sie jagen nicht über längere Strecken, sind aber vierfüßig schnell genug. Ihr Gebiss ist zum Töten ungleich besser als unseres geeignet. Unzweifelhaft braucht eine so grundlegende Umgestaltung des Körpers, wie die aufgerichtete, zweibeinige Fortbewegungsweise, einen anderen Grund als die gelegentliche Jagd nach frischem Fleisch. Ein sehr triftiger und entsprechend lange wirksamer Grund muss das gewesen sein. Ein Grund, der in einer besonderen Hinsicht dauerhaft Vorteile einbringt. Es ist dies die Fortpflanzung. In dieser steckt, wie es in der Evolutionsbiologie treffend heißt, »die Währung« in der Zahl der überlebenden Kinder. Nachhaltige Änderungen in Körperbau und Lebensweise kommen zustande über erheblich verbesserte Fortpflanzungserfolge. Nur ausnahmsweise vielleicht auch mal über bloß hinreichend gute, wenn tendenziell die Reproduktionsrate langfristig sinkt. Auf diese offensichtlich wenig realistische Möglichkeit bezieht sich die in der Forschung zur frühen Evolution unserer Gattung seltsam verbreitete Ansicht, dass schrumpfende Wälder in jenen fernen Zeiten die »Vormenschen«, wie sie vielfach genannt werden, hinaus in die Savanne getrieben hätten und sie somit zu Fußgängern werden mussten. Warum Schimpansen und Gorillas oder die Orang-Utans in Südostasien sowie die Gibbons und all die anderen Wälder bewohnenden Primaten offensichtlich erfolgreich darin verbleiben konnten, müsste allerdings erst bewiesen werden, um das Schrumpfen der Wälder als Anstoß für den Weg auf zwei Beinen hinaus ins Freie plausibler zu machen, zumal es voraussetzt, dass dieser »mehr gebracht« hatte als das Bleiben. Das Schrumpfen der Wälder hätte lediglich die Gesamtgröße der Bestände der Vormenschen vermindert, wie bei allen anderen Waldbewohnern auch.
Ein Seitenblick auf die Paviane ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Sie nutzen die Freiräume der afrikanischen Savannen oder, von den für sie sicheren Felsen aus, die höheren Gebirgslagen in Nordostafrika. Und sie sind im Gegensatz zu ihren in Wäldern lebenden nächsten Verwandten sehr zahlreich. Also ein Parallelfall! Nein, das sind die Paviane ganz und gar nicht. Denn sie sind Vierfüßer geblieben, sogar noch ausgeprägter als ihre Waldverwandtschaft. Sie sind offensichtlich sehr gut zu Fuß auf allen vieren, wie man gegenwärtig in vielen Regionen Afrikas beobachten kann, nicht nur in den großen Nationalparks. Paviane erweisen sich zudem als äußerst clever im Umgang mit Menschen. Schier endlos ließen sich dazu Geschichten erzählen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Das Ergebnis dieses Sortierens der erörterten Ansichten bedeutet, dass die schrumpfenden Wälder nicht der Anlass gewesen sein können, dass die fernen Vorfahren der Menschen in die Savanne hinauszogen, um dort schließlich Tiere zu jagen. Der entscheidende Grund fehlt offenbar noch.
Jagdprobleme
Worum könnte es sich bei diesem gehandelt haben? Die Begründung muss zwei Kriterien erfüllen, um ernsthaft in Betracht zu kommen. Erstens muss es sich um etwas gehandelt haben, an dem es in den Wäldern mangelt. Und zweitens muss die Vorteilhaftigkeit lange anhaltend gewährleistet gewesen sein, zumindest einige Millionen Jahre. Denn so lange hat die Entwicklung zum Läufer gedauert, wie wir den Fossilfunden entnehmen. Dazu später mehr.
Einen Hinweis, worum es sich gehandelt haben könnte, gaben die jagenden Schimpansen bereits mit ihrer Gier nach Fleisch. Diese äußert sich offenbar unregelmäßig und eher in längeren Zeitabständen. Dazwischen ernähren sich die Schimpansen hauptsächlich pflanzlich sowie von Kleingetier, wie Termiten, die sie mit Hölzchen regelrecht fischen. Sie machen sich solche Kleinwerkzeuge zurecht, die in die Eingänge zu den Termitenbauten passen, und stochern so lange herum, bis sich Termiten daran festgebissen haben. Sichtlich genießend verzehren sie diese bescheidene tierische Beute. Auch anderes Kleingetier wird verspeist. Darin zeigen sich Anklänge an die Abstammung der Menschenaffen von ursprünglichen Primaten, die sich ähnlich wie Insektenesser ernähren, wie sie uns etwa in Form von Spitzmäusen bekannt sind. Hierauf näher einzugehen würde in unserem Zusammenhang zu weit ausgreifen. Es muss genügen, darauf hinzuweisen, dass es um Proteine geht, um tierisches Eiweiß. Primaten, die sich rein pflanzlich ernähren, müssen sehr viel zu sich nehmen. Fast den ganzen Tag futtern sie mit geringen Unterbrechungen, weil die Pflanzenkost sehr arm ist an Proteinen. Der Einwand, wir können uns doch auch ganz vegan ernähren, lässt sich in diesem Zusammenhang sogleich ausräumen, denn das geht nur mit den jetzt verfügbaren, gezüchteten Kulturpflanzen, nicht aber mit der in den Tropenwäldern wachsenden natürlichen Vegetation. Gerade auch die von vielen Primaten geschätzten süßen Früchte enthalten wenige Proteine. Ihr Zuckergehalt liefert Energie, aber viel zu wenig Eiweiß, um den Bedarf zu decken. Dieser Aspekt wird in einem anderen Zusammenhang noch sehr wichtig.
Was also können wir der Ernährungsweise der uns nächstverwandten Schimpansen und anderer Primaten entnehmen? Ganz unmittelbar, dass sie ihre Pflanzenkost mit tierischen Proteinen immer wieder aufzubessern versuchen. Dabei machen die Schimpansen gelegentlich Jagd auf Tiere, die viel kleiner als sie sind und die sie mit ihrem recht kräftigen Gebiss töten können. Den Eckzähnen der Männer kommt dabei eine besondere Rolle zu. Diese entblößend, drohen sie auch Rivalen. Allerdings haben wir kein schimpansenähnliches Gebiss. Führt das Jagdverhalten der Schimpansen also doch nicht weiter? Den Ausweg bietet die Betrachtung der »richtigen Raubtiere«.
Davon gibt es ein breites Spektrum verschiedener Arten in den Regionen, in denen Schimpansen und Gorillas vorkommen. Auch die Orang-Utans und Gibbons in Südostasien leben in einer Welt mit Großraubtieren, deren Artenspektrum von Wildhunden bis zu Leoparden und Tigern reicht. In Afrika sieht es ähnlich aus, wobei die Löwen als stärkste Großkatzen die Position der Tiger Asiens einnehmen. Doch dies ist nur der gegenwärtige Zustand. Wie noch auszuführen ist, waren die Verhältnisse deutlich anders gelagert in den Zeiten, in denen sich die Menschen entwickelten. Denn damals gab es noch mehr große Raubtiere. Dennoch verrät schon der heutige Befund genug: Löwen töten zwar recht effizient große Beutetiere, aber bei Weitem nicht so erfolgreich, wie die mit ihrem tatsächlichen Leben nicht vertrauten Menschen zumeist annehmen oder befürchten. Die Jagd auf kräftige Antilopen oder wehrhafte Büffel fordert Löwen, die Stärksten von allen, so sehr, dass sie nach dem Töten der Beute gezwungen sind, eine mehr oder minder lange Zeitspanne zuzuwarten, bevor sie selbst wieder zu Kräften kommen. Am Beispiel der Hetzjagd der Geparde ist dies bereits angedeutet worden.
Wie bedeutsam die mit dem Töten großer Tiere verbundenen Anstrengungen sind, drückt sich noch auf andere Weisen aus. So versuchen fast alle Raubtiere, einander die Beute wegzunehmen. Geparden widerfährt dies häufig, sodass sie bei ihrer Jagd die Kernbereiche meiden, in denen Löwenrudel aktiv sind. Doch selbst Löwen büßen häufig ihre frisch geschlagene Beute ein, wenn sie von einem Rudel Hyänen entdeckt werden, bevor sie sich selbst daran satt gefressen haben. Hyänen, die Tüpfelhyänen, um präzise zu sein, repräsentieren gleichsam die perfekte Mischung von erfolgreichen Jägern und besonders guten Aasjägern. Die Afrikaner verachten »Fisi«, die Hyäne, und fürchten sie zugleich, während sie »Simba«, den Löwen, durchaus ähnlich schätzen wie europäische Völker, die Löwenmotive in ihren Wappen und auf ihren Fahnen tragen. Die Hyäne wurde nirgends Wappentier; eine Feststellung, über die es lohnt nachzusinnen. Vielleicht war sie von Anfang an die größte Konkurrentin der Vor- und Frühmenschen. Warum, das ergibt sich sowohl aus ihrer Existenz als auch aus der Entwicklung der anderen Aasjäger. Sie ermöglichen es uns, ein plausibles Szenario dafür zu entwerfen, warum die Vormenschen zu Läufern geworden sind.