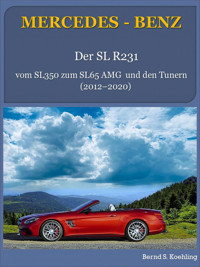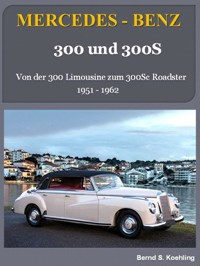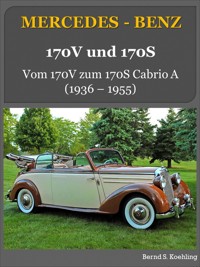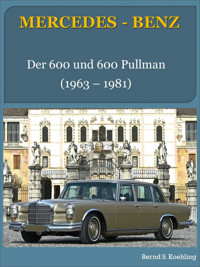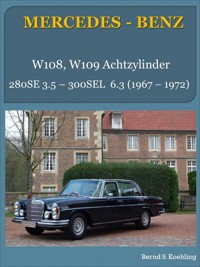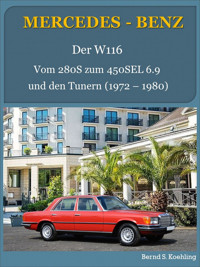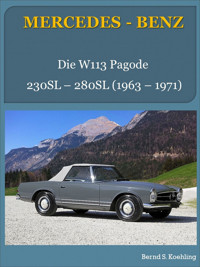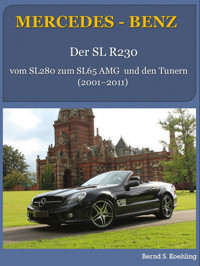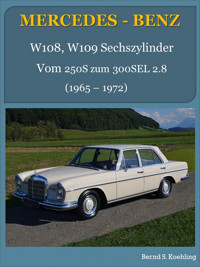
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mercedes W108/W109 mit Reihensechszylinder – Die stilvolle S-Klasse der 60er Jahre. Die Mercedes W108 und W109 Baureihen zählen zu den zeitlosesten Limousinen der 1960er und frühen 1970er Jahre. Besonders die Varianten mit Reihensechszylindermotor – vom 250S über den 280SE bis hin zum seltenen 300SEL – begeistern Kenner bis heute. Dieses 200-seitige Buch bietet einen umfassenden Überblick über Geschichte, Technik und Modellvielfalt der R6-befeuerten W108/W109. Dazu gibt es zahlreiche aktuelle Fotos, technische Daten und eine ausführliche Kaufberatung, die Ihnen hilft, das passende Modell zu finden. Ausgewählte Inhalte: • Entwicklung, Modellpflege und Upgrades • Kaufberatung mit Tipps zu typischen Schwachstellen • Fahrgestellnummer & Datenkarte erklärt • Karosserieumbauten und Sonderversionen • Leistungs- und Drehmomentkurven • Technische Daten & Produktionsgeschichte • Über 150 aktuelle Fotos – von Karosserie bis Fahrwerk Ein eigenes Kapitel widmet sich Fritz Nallinger, dem Daimler-Benz Vorstand, unter dessen Leitung nicht nur die W108/W109 entstanden, sondern auch Ikonen wie der Mercedes 600 und der 300 SL. Fazit: Ein unverzichtbarer Begleiter für Oldtimer-Besitzer, Sammler und Kaufinteressenten, die mehr als nur Prospektwissen suchen – faktenreich, praxisnah und mit Leidenschaft für die „S-Klasse der 60er Jahre“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MERCEDES - BENZ
W108, W109 Sechszylinder
Vom 250S zum 300SEL 2.8
1965 - 1972
Bernd S. Koehling
© 2023 Bernd S. Koehling
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Buch oder Teile daraus dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors weder in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt, verbreitet, gespeichert, noch in ein elektronisches System übertragen oder in irgendeiner Weise verarbeitet werden – auch nicht auszugsweise.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis
Dieses Buch wurde mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt der Autor keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen. Technische Daten, Ausstattungen und Marktbedingungen können sich ändern oder abweichen.
Alle Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine professionelle Beratung oder verbindliche Kaufempfehlung dar. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Autor haftet nicht für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Anwendung der Informationen aus diesem Buch entstehen.
Dieses Buch steht in keiner Verbindung zur Mercedes-Benz Group AG. Alle erwähnten Marken, Produktnamen oder Firmenbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen lediglich der Beschreibung.
Persönliche Einschätzungen und Meinungen des Autors basieren auf eigenen Erfahrungen und stellen keine objektive Bewertung im rechtlichen Sinn dar.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Entwicklung der W108 Modelle
Technische Aspekte, die 250er-Reihe
Technische Aspekte, die 300er Reihe
Sicherheitsaspekte
Die 250er- und 300er-Reihe
Auszüge aus dem 250S, SE, 300SE Prospekt
Auszüge aus dem 300SEL 3.0 Prospekt
Die 280er-Reihe
Auszüge aus 280er Prospekten
Kurze Rennsportgeschichte
Karosseriebauer
Absatzentwicklung
Den 250SE erleben
TECHNISCHE KAPITEL
W108 / W109 Fahrgestellnummer erklärt
W108 / W109 Datenkarte erklärt
W108 / W109 Kaufberatung
Auf den Punkt gebracht
Originalität
Korrosion
Fahrwerk, Bremsen etc
Motoren, Getriebe
Innenraum
Allgemeines
Farb-Optionen
Zweiton Farbvarianten
Farboptionen für die Innenausstattung
Allgemeine technische Daten
Leistungs- und Drehmomentkurven
Jährliche Produktionszahlen
Fritz Nallinger (6. Aug. 1898 – 4. Juni 1984)
Über den Verfasser
Weitere Bücher des Verfassers
Kostenloses e-Buch Angebot
Vorwort
Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie dieses Buch in die Hand genommen haben. Als Sammler oder Liebhaber klassischer Mercedes-Benz-Fahrzeuge wissen Sie um den Wert von Authentizität, Substanz und technischer Klarheit – Eigenschaften, die ich versucht habe diesem Buch von Anfang an mitzugeben. Ich hoffe, die Lektüre bereitet Ihnen ebenso viel Freude, wie mir das Recherchieren, Schreiben und Fotografieren.
Eine ausführliche Kaufberatung bietet nicht nur eine strukturierte Entscheidungshilfe für Interessierte, sondern auch eine technische Quelle für Kenner. Detaillierte Informationen zu Fahrgestellnummern, Datenkarte, Motor- und Getriebevarianten, Drehmomentkurven und Beschleunigungswerten sind ebenso enthalten wie Produktionszahlen pro Modelljahr, Farb- und Polsterkombinationen sowie Hinweise zu Modellpflegemaßnahmen. Ergänzt wird dies durch neue Farbfotos, die technische Besonderheiten und originale Ausstattungsmerkmale sichtbar machen – ein visuelles Werkzeug für jeden, der Originalität schätzt und erhalten will.
Ein separates Kapitel widmet sich Fritz Nallinger, der als technischer Vorstand und Leiter der Pkw-Gesamtentwicklung in den 1950er Jahren bis zu seinem Ausscheiden Ende 1965 maßgeblich die Grundlagen für den technischen Standard setzte, den der W108 und alle anderen Mercedes Modelle vorher und nachher eindrucksvoll erfüllte.
Mit der Einführung der Baureihe W108 – gestaltet unter der Federführung von Friedrich Geiger und Paul Bracq – verabschiedete sich Daimler-Benz vom Konzept der universellen Plattform. Die „Heckflossen“ der W111, W110 und W112-Baureihe hatten versucht, mit mehr oder weniger einer Karosserie alle Kundenschichten zu bedienen – vom Taxifahrer bis zum Generaldirektor. Der W108 hingegen setzte neue Maßstäbe in Eleganz, Proportion und technischer Reife. Er ähnelte nicht mehr den Vierzylinder-Modellen , sondern war Ausdruck eines neuen Premiumanspruchs.
Die 250er- und 280er-Modelle waren weltweit erfolgreich – nicht nur wegen ihres stilvollen Auftritts, sondern aufgrund ihrer souveränen Straßenlage, der hervorragenden Verarbeitung und des großzügigen Raumgefühls. Selbst heute wirken sie nicht angestaubt, sondern klassisch. Wer jemals einen gut erhaltenen W108 gefahren ist, weiß, dass sich Qualität nicht nur sehen, sondern auch spüren lässt. Und auch ohne V8-Antrieb erzielen gepflegte Sechszylindermodelle auf dem Sammlermarkt stetig steigende Werte – aus gutem Grund.
Weniger einfach gestaltete sich die Positionierung der 300SE und später der 300SEL mit Sechszylinder. Sie wirkten optisch fast identisch zu den günstigeren 250er-Modellen, boten jedoch kaum greifbare Vorteile: Die Leistungsentfaltung war nicht merklich überlegen, die Geräuschkulisse höher, der Verbrauch deutlich gestiegen – und die exklusive Luftfederung des W112 war inzwischen zumindest bei dem 300SE entfallen. Dennoch fanden diese Modelle, wenn auch nur in homöopathischer Zahl ihre Käufer: Manchmal, weil die Typenbezeichnung auf dem Kofferraumdeckel entscheidend war. Manchmal, weil das Fahrzeug schlicht schneller lieferbar war.
Was Sammler heute am W108 und W109 fasziniert, ist nicht allein ihre elegante Erscheinung oder die verlässliche Technik. Es ist die Mischung aus Understatement und Substanz, aus Ingenieurskunst und zeitlosem Design. Diese Fahrzeuge verkörpern eine Ära, in der mechanische Präzision und formale Zurückhaltung im Zentrum des Automobilbaus standen – lange vor digitaler Effekthascherei und inflationärer Ausstattung.
Dieses Buch versucht Ihnen als Referenz zu dienen – beim Kauf, bei der Restaurierung, bei der Einordnung Ihres Fahrzeugs in die historische Modellfamilie. Und vielleicht liefert es ja auch neue Impulse für Ihre eigene Fortbewegung. Denn der W108 ist kein beliebiger Youngtimer – er ist das elegante Bindeglied zwischen der Nachkriegsmoderne und dem technischen Anspruch der Oberklasse.
Wer ihn fährt, fährt Geschichte. Wer ihn besitzt, bewahrt sie.
Dezember 2023
Bernd S. Koehling
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Entwicklung der W108 Modelle
Dass die Heckflossen weg mussten, war allen klar. Karl Wilfert, Leiter der Abteilung Personenwagen-Konstruktion bei Daimler-Benz, hatte schon vor der Markteinführung des W111 vergeblich versucht, sie loszuwerden, aber da war es schon zu spät. Das neue W111 Coupé/Cabriolet, entworfen von Friedrich Geiger und Paul Bracq, beide Mitglieder des Wilfert-Teams, zeigte erfolgreich, wie ein ausgewogenes Design aussehen kann. So lag es nahe, dieses Konzept auch für den neuen W108 zu übernehmen. Die Coupé/Cabrio-Modelle zählen heute zu den besten Entwürfen, die je aus Stuttgart kamen, und auch die Limousinen W108/109 wirken mit ihrer zeitlosen, zurückhaltenden Eleganz noch heute edel. Mit ihrem hohen Kühlergrill und den senkrechten Scheinwerfern steht die Baureihe für eine Ära, in der jeder Junge und jedes Mädchen sagen konnte: Das ist ein Mercedes. Wäre es nach Paul Bracq (oder Bruno Sacco, um genau zu sein) gegangen, dem Leiter der Abteilung für fortschrittliches Design, hätten die Autos eine andere Front gehabt, eine Front wie die des W116 mit horizontal angeordneten Scheinwerfern. Es gelang ihm jedoch nicht, seine Vorgesetzten und das Marketing-/Verkaufsteam davon zu überzeugen, so dass die Fahrzeuge bei ihrer Markteinführung im August 1965 weiterhin die traditionelle Mercedes-Front aufwiesen.
Obwohl es Bracq zu diesem Zeitpunkt nicht gelang, seine Kollegen von einer neuen Frontpartie zu überzeugen, gelang es ihm, beim W108 die Prinzipien umzusetzen, die seiner Meinung nach bei der Entwicklung eines neuen Designs beachtet werden sollten: Das Auto muss ausgewogene Proportionen mit einer niedrigen Gürtellinie haben, um die Sicht für die Passagiere zu verbessern. Die Seiten des Fahrzeugs sollten eine durchgehende Linie von der Front bis zum Heck aufweisen.
Ein Design mit quergestellten Scheinwerfern sollte erst mit dem W116 verwirklicht werden
Dieser 1962er Vorschlag von Bracq wurde schnell wieder verworfen
stets darauf, dass die Räder bündig mit der Außenkante der Karosserie abschlossen, was dem Wagen ein maskulineres Aussehen verlieh.
Obwohl Bracq vergeblich versucht hatte, seine Kollegen und Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass eine große, gerade Frontmaske und senkrechte Scheinwerfer für den Nachfolger des 220b nicht unbedingt notwendig seien, räumte er später in einem Interview zumindest ein, dass ein aufrechtstehender Kühlergrill vielleicht doch keine schlechte Idee gewesen war. Ob die überwiegend konservative Kundschaft der Sechszylinder-Mercedes Mitte der 1960er Jahre zu einem derart radikalen Bruch mit einer Mercedes-Tradition bereit gewesen wäre, die Daimler-Benz immerhin seit der Gründung 1926 begleitete, darf bezweifelt werden. Knapp zehn Jahre später, mit der Einführung des W116, war die Zeit reif.
Für Bracq war es nur natürlich, eine Limousine mit dem patentierten Barenyi-Pagodendach zu entwerfen
Das endgültige Design des neuen Fahrzeugs entwickelte sich in drei Schritten. Der erste Entwurf hatte noch die höhere Karosserie der W111 Limousine, aber mit dem Dach des Coupés. Später, 1962, näherte sich die Heckscheibe der des 600 an, und 1963 wurde die endgültige Form (siehe unten) mit einer niedrigeren und breiteren Karosserie und einer größeren Glasfläche vorgestellt.
Bracqs Idee, die Seitenlinien des Wagens optisch zu trennen, wurde durch einen Chromgürtel mit schwarzen Gummieinsätzen umgesetzt. Er umgab das gesamte Auto mit Ausnahme der Front und schützte gleichzeitig die Türen in engen Parklücken. Ziel war es, die Gesamtabmessungen des W111 beizubehalten, aber das Platzangebot im Innenraum zu verbessern. Am Ende war der Wagen 60 mm niedriger und 15 mm breiter, was ihn von außen größer wirken ließ als seinen Vorgänger. Während die Scheinwerfer des alten und des neuen Wagens identisch waren, war der Kühlergrill etwas niedriger und breiter, und die kleinen Chromleisten links und rechts des Kühlergrills waren verschwunden.
Die Windschutzscheibe war aufgrund der abgesenkten Gürtellinie rund 17 Prozent größer. Und gewölbte Seitenscheiben und kleinere, weiter außen liegende Säulen sorgten dafür, dass die Innenraumbreite vorne um beeindruckende 90 mm und hinten um 70 mm zunahm.
Diese Zeichnung von Bracq aus dem Jahr 1963 kommt dem endgültigen Entwurf schon sehr nahe
Ein historisches Foto von Bracq mit einigen seiner Entwürfe
Die optionale größere Mittelarmlehne vorne wurde durch zwei dünnere separate Armlehnen ersetzt. Dies geschah, um den Komfort für den einzelnen Fahrgast zu erhöhen. Auch ein Sitzkissen zwischen den beiden Vordersitzen konnte wieder bestellt werden, um Platz für eine dritte Person vorne zu bieten. Zum ersten Mal konnte der Fahrersitz mit einem Hebel an der linken Seite des Sitzes in der Höhe verstellt werden.
Der Innenraum war nicht nur komfortabel, sondern auch sehr geräumig. Die mittleren Armlehnen waren länger (wie auf diesem Foto), wenn das Auto mit einer Lenkradschaltung ausgestattet war
Echte schützende Kopfstützen waren noch nicht entwickelt worden
Evolution der Sechszylinder-Limousine. Die Front zeigte noch Ähnlichkeiten mit dem W111
Die Instrumentenanordnung war schließlich wieder eher traditionell mit zwei großen Rundinstrumenten für Geschwindigkeit und verschiedene Kontrollfunktionen und einem kleinen Instrument für die Uhr. Eine Chromleiste verlief entlang der oberen Hälfte des Armaturenbretts. Sie trennte den "Arbeitsbereich" mit den Bedienknöpfen für Heizung und Licht vom unteren Bereich, in dem sich das Radio, die Zündung und die beiden kleinen verchromten Lüftungsdüsen befanden, die vom W111 übernommen worden waren (und später durch größere aus Kunststoff ersetzt wurden). Wenn kein Radio bestellt war, wurde der Raum mit einer Holzplatte abgedeckt, die auch eine kleinere Version des Kofferraumabzeichens trug. Dieses Typenschild muss sehr beliebt gewesen sein, denn bei einigen restaurierten Fahrzeugen mit Radio wurde es auf dem Deckel des Handschuhfachs angebracht.
Alle vier Türen hatten Haltegriffe und die beiden vorderen Türen große offene Taschen. Um die Außenseiten der Sitze vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen, waren sie mit Vinylkanten versehen.
Die 250er Serie war niedriger und breiter als der W111
Karl Wilfert (links) ist Leiter der Styling-Abteilung von Daimler-Benz. Paul Bracq (rechts) erläutert dem Vorstandsmitglied Fritz Nallinger, der für die gesamten Personenwagen zuständig ist, Stylingvorschläge. Die Person hinter Nallinger im weißen Kittel ist Friedrich Geiger, der Vorgesetzte von Bracq.
Sowohl Bracq als auch Geiger betonten immer wieder, dass die Entwicklung von Autos eine Teamleistung sei und nicht einer einzelnen Person zugeschrieben werden könne
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Technische Aspekte, die 250er-Reihe
Die Radaufhängung mit Doppelquerlenkern, Schraubenfedern und Drehstabstabilisator vorn sowie Einzelradaufhängung hinten wurde erstmals 1954 bei der Sechszylinder-Ponton-Limousine eingesetzt. Mit der Einführung des W111 im Jahr 1959 wurde sie leicht modifiziert und um eine Ausgleichsfeder über der Hinterachse ergänzt. Da Daimler-Benz noch keine Notwendigkeit für eine komplette Neukonstruktion sah, entschloss man sich, die Hinterachse weiter zu verstärken und die Ausgleichsfeder zu verbessern. Beim W111 handelte es sich noch um eine simple Feder, die neue Version war eine hydropneumatische Feder, die das Niveau des Wagens während der Fahrt wesentlich besser anpasste. In den USA warb Daimler-Benz 1966 für diese geniale Neuerung mit den Worten:
„Man könnte ein paar Zementblöcke einladen und den Rücksitz mit fetten Männern vollstopfen, und das Heck des 250er würde nicht absacken. Der Grund: eine teuflisch clevere neue technische Errungenschaft, die hydropneumatische Ausgleichsfeder“.
Die neue hydropneumatische Ausgleichsfeder befindet sich oberhalb der Hinterachse
Verschiedene Ansichten der Vorderradaufhängung
Die linke Vorderradaufhängung mit ihrem außen angebrachten Stoßdämpfer
Auch motorseitig war der W108 noch eng mit dem W111 verwandt. Die gusseisernen Reihenmotoren mit obenliegender Nockenwelle wurden durch eine um zwei Millimeter von 80 auf 82 mm vergrößerte Bohrung und einen um sechs Millimeter von 72,8 auf 78,8 mm verlängerten Hub auf 2.496 ccm vergrößert. Größere Ventile und Einlasskanäle waren weitere Modifikationen. Die Kurbelwelle war nun in sieben statt bisher vier Lagern gelagert, was zu einem deutlich ruhigeren Lauf des Motors beitrug. Weitere Modifikationen waren eine Ölpumpe mit größerem Fördervolumen und kürzere Pleuel, die dem um sechs Millimeter verlängerten Hub bei ansonsten unveränderter Motorblockhöhe Rechnung trugen. Die neu gestalteten Zylinderköpfe wiesen größere Öffnungen auf, die Ventildurchmesser waren um zwei Millimeter vergrößert. Das Kühlgebläse der Motoren besaß sechs statt bisher vier Schaufeln und war mit einer Visko-Kupplung ausgestattet, die das Gebläse nur dann aktivierte, wenn die Motordrehzahl 3.000 U/min überschritt oder die Wassertemperatur im Kühler einen bestimmten Grenzwert erreichte.