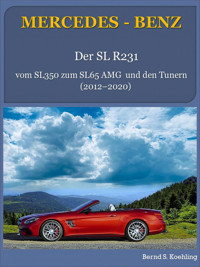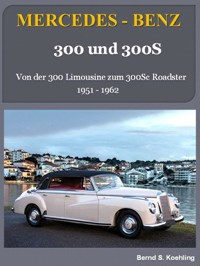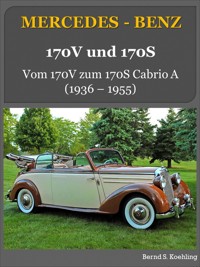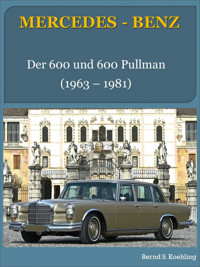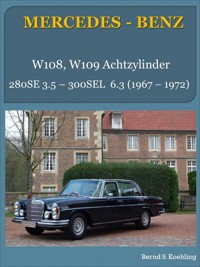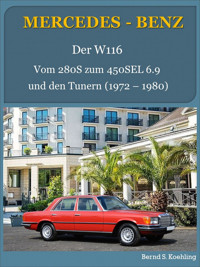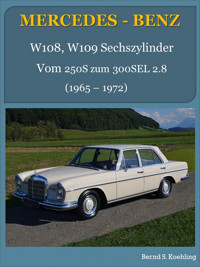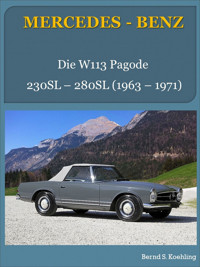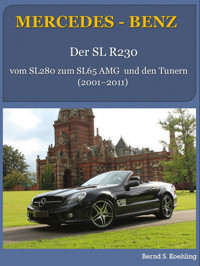
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wenn Sie ein Auto suchen, das sich neben einem Porsche 911 Cabrio behaupten kann, brauchen Sie nicht weiter zu suchen. Denn der Mercedes SL R230 wird von vielen als der bestaussehende SL angesehen, der Stuttgart nach dem berühmten 300SL Flügeltürer verlassen hat. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über den R230 und seine Entwicklung und Geschichte wissen möchten. Es erklärt auch die FIN und die Datenkarte und eine Kaufberatung kann Ihnen beim Kauf Ihres SL helfen. All dies wird von großartigen aktuellen Fotos begleitet. Dies sind einige der behandelten Themen: • Entwicklung des R230 • Verbesserte Sicherheitsstandards • Die Sechs- und Achtzylindermotoren • Ein problematisches SBC und ein hervorragendes ABC • Der SL55 kommt auf den Markt • Neue V6- und V12-Motoren • Das Facelift 2006 (MOPF 1) • Das Facelift 2008 (MOPF 2) • Der SL63 löst den SL55 ab • Der SL65 • Der SL65 Black Series • Die Sondereditionen, von der Mille Miglia 2003 bis zur Night Edition 2010 • Die Tuning-Szene, von Brabus bis RENNtech • Die FIN und Datenkarte erklärt • Die verschiedenen COMAND-Systeme • Optionen und Optionspakete • Probleme mit dem Variodach • R230-Kaufberatung • Technische Daten und Produktionszahlen Wenn Sie Interesse am R230 haben, gehört dieses Buch in Ihre Sammlung. Eine gedruckte Version ist auf Amazon erhältlich. Viel Spaß beim Lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MERCEDES - BENZ
SL R230
Vom SL280 zum SL65 AMG Black Series
2001 – 2011
Bernd S. Koehling
© 2024 Bernd S. Koehling
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Buch oder Teile daraus dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors weder in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt, verbreitet, gespeichert, noch in ein elektronisches System übertragen oder in irgendeiner Weise verarbeitet werden – auch nicht auszugsweise.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis
Dieses Buch wurde mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt der Autor keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen. Technische Daten, Ausstattungen und Marktbedingungen können sich ändern oder abweichen.
Alle Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine professionelle Beratung oder verbindliche Kaufempfehlung dar. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung.
Der Autor haftet nicht für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Anwendung der Informationen aus diesem Buch entstehen.
Dieses Buch steht in keiner Verbindung zur Mercedes-Benz Group AG. Alle erwähnten Marken, Produktnamen oder Firmenbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen lediglich der Beschreibung.
Persönliche Einschätzungen und Meinungen des Autors basieren auf eigenen Erfahrungen und stellen keine objektive Bewertung im rechtlichen Sinn dar.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Das Vario-Stahldach wird geboren
Geschichte des Variodachs
Ein sanfteres Design
Die Liste der Serienausstattung wird länger
Beeindruckendes Sicherheitssystem
Der R230
Ein problematisches SBC und ein tolles ABC
Der SL55 AMG wird eingeführt
Ein neuer V6 und V12
Der SL65 AMG
2006: ein erstes Facelift
Das 2008 Facelift
Der SL63 ersetzt den SL55
Der SL65 AMG
Der SL65 AMG Black Series
Special Edition Modelle
Mille Miglia Edition
Edition 50
50th Anniversary Edition
SL63 AMG Edition IWC
Night Edition
Swiss Edition
Der letzte R230
Die Tuning Szene
Brabus
Brabus SL65 Vanish und Stealth
Carlsson
MKB-Motorenbau
RENNtech
ASMA-Design
Andere Tuner
Absatzentwicklung
Die R230 Fahrgestellnummer erklärt
Erklärung der R230 Datenkarte
Das COMAND System
Die Options Pakete
Modellpflege (MOPF) Übersicht
R230 Kaufberatung
Auf den Punkt gebracht
Karosserie
Motoren, Getriebe
Aufhängung (Das ABC-System)
Elektrohydraulische Bremse SBC
Räder, Reifen und Auspuff
Interieur
Probleme mit dem Variodach
Technische Spezifikationen
Produktionsdaten
Farboptionen
Über den Verfasser
Weitere Bücher des Verfassers
Kostenloses e-Buch Angebot
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben. Ich hoffe, Sie werden ebenso viel Freude beim Lesen empfinden, wie ich sie beim Recherchieren und Schreiben hatte. Dieses Werk ist Teil einer Buchreihe, die sich den von Daimler-Benz produzierten SL-Modellen widmet – Fahrzeugen, die nicht nur automobile Meilensteine darstellen, sondern auch ein Stück Motorsportgeschichte verkörpern.
Der Fokus dieses Bandes liegt auf dem SL der R230 Baureihe. Seine Modellgeschichte ist geprägt von technischer Innovation, vielfältigen Modellvarianten und einer bemerkenswerten Weiterentwicklung innerhalb seines Produktionszyklus von 2001 bis 2011. Neben den Serienmodellen werden auch die leistungsstarken AMG-Versionen, limitierte Sondereditionen und ausgewählte Umbauten renommierter Tuner wie Brabus, Carlsson und RENNtech behandelt.
Besonderes Augenmerk liegt auf der technischen Komplexität des Fahrzeugs. So wird beispielsweise das Active Body Control (ABC) Fahrwerk ebenso erklärt wie das elektrohydraulische Bremssystem Sensotronic Brake Control (SBC). Eine umfangreiche, rund dreißig Seiten umfassende Kaufberatung bietet potenziellen Käufern eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Hierbei wird auf bekannte Schwachstellen eingegangen, unter anderem auf die Automatikgetriebe der Baureihen 722.6 und 722.9 sowie auf die spezifischen Eigenheiten aller im R230 angebotenen Motorvarianten – vom SL350 bis hin zum SL65 AMG Black Series. Auch die Fahrzeugidentifikation und die Interpretation der Datenkarte werden Schritt für Schritt erläutert. Ergänzt wird das Buch durch zahlreiche aktuelle Fotografien, darunter auch Aufnahmen des Fahrwerks.
Die Geschichte des SL begann im Jahr 1952 mit dem W194 Rennsportwagen. Niemand konnte damals absehen, dass sich der Modellkürzel „SL“ – ursprünglich für „Super Leicht“ stehend – zu einem der bekanntesten Namen der Automobilwelt entwickeln würde. Der ikonische 300SL Flügeltürer setzte wenig später Maßstäbe in Technik und Design und begründete den Mythos des SL.
Im Laufe der Jahrzehnte wandelte sich das Konzept. Während frühe Generationen in erster Linie sportlich orientiert waren, traten mit den späteren Modellen Komfort und luxuriöse Ausstattung zunehmend in den Vordergrund. So sehr, dass manche Kritiker spöttelten, das „L“ in SL stehe inzwischen weniger für „Leicht“ als vielmehr für „Luxus“.
Die Entwicklung des SL war nie frei von Kontroversen. Als beispielsweise 1963 im sogenannten „Pagoden“-SL erstmals Automatikgetriebe und Servolenkung angeboten wurden, sahen Puristen das Ende des sportlichen Anspruchs gekommen.
Doch Daimler-Benz bewies Weitsicht und orientierte sich zunehmend an internationalen Märkten – allen voran Nordamerika, wo Komfort-Features stärker nachgefragt wurden. Diese Strategie setzte sich auch mit dem R107 fort, dessen Design und Ausstattung erneut stark auf den US-Markt ausgerichtet waren. Trotz anfänglicher Skepsis avancierte der R107 zum zweitlängst produzierten Pkw in der Geschichte des Unternehmens.
Der R230, präsentiert im Jahr 2001, knüpfte an diese Tradition an und stellte gleichzeitig einen technologischen Sprung dar. Er war der erste SL mit voll versenkbarem Vario-Stahldach – einer Lösung, die Komfort, Alltagstauglichkeit und Design vereinte. Obwohl das Fahrzeuggewicht nicht nennenswert reduziert wurde, überzeugte der R230 durch eine gelungene Balance aus Fahrdynamik, Langstreckentauglichkeit und technischer Raffinesse. Insbesondere der SL500 fand schnell eine treue Fangemeinde.
Ein Höhepunkt der Baureihe waren zweifellos die SL55/SL63 AMG, die den Anspruch eines Sportwagens mit der Souveränität eines luxuriösen Reisewagens vereinten. In puncto Preis-Leistungs-Verhältnis setzten sie Maßstäbe, die weltweit ihresgleichen suchten.
Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch, dass die Qualität der ersten Produktionsjahre nicht immer den hohen Erwartungen entsprach, die man mit dem Markennamen Mercedes-Benz verbindet. Erst mit den Modellpflegen in den Jahren 2006 und 2008 wurden zahlreiche Kritikpunkte behoben – insbesondere im Hinblick auf Verarbeitung, Elektronik und Komfortfeatures.
Als im November 2011 die Produktion des letzten R230 im Bremer Werk endete, hinterließ er ein Vermächtnis, das den Anspruch des SL als Ikone der automobilen Oberklasse erneut bestätigte.
Dieses Buch soll dem Leser nicht nur ein umfassendes technisches Verständnis dieser faszinierenden Baureihe vermitteln, sondern auch einen Beitrag zur Erhaltung und Pflege dieses Klassikers leisten – sei es als aktueller oder künftiger Besitzer, als Sammler oder einfach als leidenschaftlicher Enthusiast der Marke Mercedes-Benz.
Januar 2024
Bernd S. Koehling
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Das Vario-Stahldach wird geboren
Der SL der Baureihe R230, die fünfte Generation des legendären Sportwagens, wurde im Juli 2001 in den Hamburger Deichtorhallen, einem der größten Ausstellungszentren für moderne Kunst in Europa, vorgestellt. Lionel Richie und Leslie Mandoki wurden gebeten, einen Song zu komponieren, der die Markteinführung des neuen SL begleiten sollte. 500 Journalisten aus aller Welt waren zu der Feier eingeladen, bei der Daimler-Benz den neuen Shooting Star präsentierte und Lionel Richie und Juliette, eine junge deutsche Sängerin, den Song "The One" vortrugen.
Einzigartig war nicht nur der Song, sondern in typischer SL-Tradition auch der R230. Auffälligstes Merkmal war das neue versenkbare Stahl-Hardtop mit Variodach, das von einer Hydraulikpumpe und elf computergesteuerten Hydraulikzylindern bedient wurde. Von nun an trug der SL sein Hardtop mit sich herum und benötigte keinen separaten Stauraum in der Garage mehr. Das Stoffverdeck war Geschichte. Ein Prototyp mit einem solchen Dach wurde bereits 1994 vorgestellt. Der erste Mercedes mit Vario-Dach war der SLK R170, der 1996 auf den Markt kam. Ein ungewöhnliches Extra war das Panorama-Glasdach, das für einen Aufpreis von 1.840,- € bestellt werden konnte.
Per Fernbedienung oder nach Hochklappen des Wippschalters am Ende der Mittelkonsole konnte man 16 Sekunden lang genießen, wie sich das Dach öffnete, ein hochkomplexer Schwenkmechanismus die Aluminium- und Glasplatten trennte und sie in den oberen Teil des Kofferraums absenkte. Der SLK von 1996 brauchte dafür noch 25 Sekunden.
Darunter standen 235 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Ein kleiner roter Knopf an der Kofferraumschwelle konnte das zusammen-gefaltete Verdeck wieder etwas anheben, so dass etwas mehr Gepäckraum zur Verfügung stand. Bei geschlossenem Verdeck waren es 317 Liter, 50 Liter mehr als beim R129.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Geschichte des Variodachs
In den meisten Publikationen erfährt der interessierte Leser, dass das erste Auto mit einem faltbaren Hardtop ein Peugeot 401 aus dem Jahr 1934 war. Das ist richtig, wenn man nur die elektrischen Hardtops betrachtet. Aber es ist nur die halbe Wahrheit, denn das Konzept des abnehmbaren Allwetterdachs im Automobil reicht viel weiter zurück. Und es begann nicht in Frankreich, sondern in den USA. Benjamin Ellerbeck aus Salt Lake City, Utah, war ein Ingenieur mit großem Interesse an allem, was mit Autos zu tun hatte.
Im Herbst 1919 hatte er das Grundkonzept eines Schiebedachs für offene Autos entwickelt, und Anfang der 1920er Jahre baute er eine Reihe von Modellen im Maßstab 1:8, um potenziellen Kunden die Funktionsweise seiner Erfindung zu demonstrieren. 1921 erhielt er ein Patent (US-Patent Nr. 1.379.906) für sein Schiebedach. Im Dezember 1930 erhielt er ein weiteres US-Patent für einen Roadster mit einer zweiten Windschutzscheibe für den Schwiegermuttersitz.
Obwohl er von seiner Erfindung ziemlich begeistert war, war es ihm bisher nicht gelungen, einen Großkunden für die Umsetzung seiner Ideen zu gewinnen. Deshalb kaufte Ellerbeck 1922 einen Hudson Super Six aus dem Jahr 1919, der ihm als reales Modell für sein innovatives Verdeck dienen sollte. Damit sein neues Dach passte, musste er große Teile des Hudson umbauen.
Aber das Ergebnis war ein attraktives Auto, das mit geschlossenem Verdeck besonders einladend aussah. In geschlossenem Zustand glich der Überhang über der Windschutzscheibe einer riesigen Lufthutze oder Sonnenblende.
Ein Problem war der recht komplizierte Mechanismus zum manuellen Öffnen und Schließen des Verdecks. Er war teuer in der Herstellung und schreckte viele potenzielle Kunden ab. Deshalb änderte er 1923 seine Kreation, indem er das Dach auf Landau-Stäben ruhen ließ, die an den Enden einer durch die Karosserie verlaufenden Querstrebe befestigt waren.
Die vorherige Kreation hatte gerade, diagonale Arme, die sich sowohl im Korpus als auch im Oberteil befanden. Das Verdeck bestand aus einem Metallrahmen mit einer Stoff- oder Metallabdeckung. In abgesenkter Position lag es bündig auf dem hinteren Wagenbereich auf. Sowohl in der abgesenkten als auch in der angehobenen Position war es mit Feststellern gesichert.
Trotz seiner Konstruktionsänderungen hatte er noch immer keinen Interessenten für das innovative Verdeck gefunden. Deshalb schrieb er 1925 einen langen Brief an die Packard Motor Company und versuchte, sie für seine Kreation zu interessieren.
In seinem Brief erklärte er, dass er den Wunsch des Automobilherstellers verstehe, irgendwo eine Grenze in der Vielfalt der Karosserieformen zu ziehen.
Dann fuhr er in seinem Brief fort, dass er überzeugt sei, dass ein Packard-Roadster in der Gunst steigen würde, wenn er eine moderne Verdeckkonstruktion bekäme. Leider lehnte Packard ab, aber das tat seiner Begeisterung für seinen Entwurf keinen Abbruch.
Ellerbeck schaffte es sogar, dass sein Entwurf Anfang der 1930er Jahre in einem Artikel einer britischen Autozeitschrift erwähnt wurde, aber auch bei ausländischen Herstellern stieß er auf kein Interesse.
Der Börsenkrach von 1929 und die folgende Wirtschaftskrise trugen sicher nicht dazu bei, sein Konzept erfolgreich zu vermarkten, und als Mitte der 1930er Jahre das Interesse an Roadstern nachließ, erlahmten auch die Bemühungen von Benjamin Ellerbeck, der über 15 Jahre lang hart um die Akzeptanz seines innovativen Konzepts gekämpft hatte. Wie so viele gute Ideen war es wahrscheinlich seiner Zeit voraus.
Die Idee war zwar fast in Vergessenheit geraten, aber noch nicht ganz tot. Ein französischer Zahnarzt, der sich wie Ellerbeck für alles rund ums Auto interessierte, griff Ellerbecks Idee 1930 in Europa auf. Denn George Paulin verdiente seinen Lebensunterhalt nicht nur als Zahnarzt, sondern war nebenberuflich auch ein begabter Autokonstrukteur. Das Konzept des verschiebbaren Verdecks wurde überarbeitet, vereinfacht und schließlich unter Paulins Leitung zum ersten elektrisch versenkbaren Hardtop weiterentwickelt und 1931 patentiert.
Das Verdeck für den Hudson wurde geändert, da es nun auf dem hinteren Teil des Wagens sitzt.
Eine Öffnung im Dach bot Platz für zusätzliche Passagiere
Doch auch diesseits des Atlantiks interessierte sich zunächst niemand für das Konzept. Das änderte sich glücklicherweise im Herbst 1933, als der mit Paulin befreundete Pariser Peugeot-Händler Emile Darl`mat den Zahnarzt dem französischen Karosseriebauer Marcel Pourtout vorstellte. Pourtout war sofort fasziniert von Paulins Patent und alle drei arbeiteten an der Realisierung des versenkbaren Verdecks. Paulin hatte das Glück, einen großen Autohändler und einen angesehenen Karosseriebauer an seiner Seite zu haben, eine Unterstützung, die Ellerbeck leider nie zuteilwurde.
Im Mai 1934 präsentierte Carosserie Pourtout seinen Eclipse Decapotable (= mit versenkbarem Dach) auf einem von Darl`mat gelieferten Mittelklassewagen Peugeot 402BL. Dieser revolutionäre Wagen fand in der Presse große Beachtung, woraufhin die Direktion von Peugeot Kontakt zu Paulin aufnahm. 1935 überzeugte er das Unternehmen von den Vorteilen seines neuen Konzepts und verkaufte ihm sein Patent.
Um das Konzept weiter voranzutreiben, arbeitete Paulin von 1934 bis 1938 als Konstrukteur bei Pourtout und half bei der Einführung des Systems bei Fahrzeugen wie dem Peugeot 301, 401 und 601. 79 Fahrzeuge des Typs Peugeot 401 und 473 Fahrzeuge des Typs Peugeot 402 wurden mit diesem Dach produziert. Um genügend Platz für das große Metalldach zu haben, wurden von allen Fahrzeugen ca. 400 auf dem verlängerten Limousinenfahrgestell der "Familiale Limousine" gebaut, das eine Länge von ca. 5,30 m hatte. Das verlängerte Fahrgestell machte die Fahrzeuge allerdings relativ teuer.
Um dieses Problem zu entschärfen, wurde beschlossen, diese Fahrzeuge nur noch mit einem manuell zu bedienenden Verdeck anzubieten. Die meisten Kunden hatten nichts dagegen, da es relativ einfach war, das Verdeck manuell zu heben oder zu senken. Leider haben bis heute nur 34 Eclipse Decapotables überlebt. Weitere von Paulin entworfene und von Pourtout produzierte Fahrzeuge mit Klappverdeck waren der italienische Lancia Belna und verschiedene Modelle der französischen Automobilhersteller Hotchkiss und Panhard.
Peugeot 401 Eclipse: nachdem das Dach abgesenkt war, gab es allerdings keinen Platz mehr für Koffer
Ein 1941 Chrysler Thunderbolt Roadster. Nur wenig ist bekannt über diese Autos. Sein Wendekreis muss gewaltig gewesen sein
Das erste amerikanische Fahrzeug, das nach dem gescheiterten Versuch von Ellerbeck mit einem versenkbaren Hardtop ausgestattet wurde, war der Chrysler Thunderbolt Roadster von 1941, der das Image von Chrysler bei den Kunden verbessern sollte. Er war wohl einer der ersten amerikanischen Traumwagen und wurde von Alex Tremulis entworfen. Von den fünf gebauten Thunderbolts sind vier erhalten geblieben.
1956 griff Ford die Idee des versenkbaren Hardtops wieder auf und bot für die Modelljahre 1957 bis 1959 einen Fairlane 500 Skyliner an. Der Skyliner war ein vollwertiger Zweitürer mit einem recht komplizierten, elektrisch betriebenen Hardtop. Das Verdeck hatte vorne eine Klappe, die mit dem Rest des Daches unter einer langen Kofferraumklappe verschwand. Im Vergleich zum Peugeot-Dach war dies eine reine Hightech-Konstruktion.
Ford Fairlane 500 Skyliner: Das Dach sah kompliziert aus, war aber zuverlässig und war in den 1950er Jahren ein Showstopper
Der Fahrer des 5,35 Meter langen Ford Fairlane brauchte nur einen Knopf zu drücken, und alles andere geschah wie von Geisterhand. Das System bestand aus drei Elektromotoren, die vier Arme zum Heben und Senken des Verdecks, vier Verriegelungsmechanismen zum Festhalten des Verdecks, zehn Magnetventile und weitere vier Elektromotoren zum Verriegeln der Türen und des Kofferraums antrieben.
Jeder der sieben Elektromotoren hatte seinen eigenen Stromkreisunterbrecher, und 186 Meter Kabel waren nötig, um alles in Gang zu halten. Trotz der komplizierten Konstruktion funktionierte das Verdeck laut zeitgenössischen Berichten zuverlässig. Ford verkaufte in den drei Produktionsjahren insgesamt 38.394 Exemplare.
Mitsubishi bot in den Jahren 1995 und 1996 eine Sonderedition seines Modells 3000 GT an. Sie wurde als Coupé vom Werk im japanischen Nagoya an ASC (American Sunroof Company) in Kalifornien geliefert. In Kalifornien wurde es zum ersten modernen Auto mit einem faltbaren Hardtop umgebaut und erhielt den Namen "3000GT Spyder".
Wie beim Ford Skyliner öffnete sich das Dach vollautomatisch auf Knopfdruck. Nach nur 1.618 verkauften Exemplaren wurde die Produktion 1996 eingestellt. Es war wohl die schnelle Antwort von Mitsubishi auf die Präsentation der SLK-Studie 1994 in Turin und Paris.
Doch der Transport von Japan zu ASC, wo das Verdeck entfernt, das Chassis verstärkt und das faltbare Hardtop eingebaut werden musste, war eine kostspielige Angelegenheit. Kein Wunder, dass die Verkaufszahlen gering blieben und das Projekt bald wieder eingestellt wurde.
Der interessante Mitsubishi 3000GT Spyder scheiterte leider an seinem hohen Preis
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ein sanfteres Design
Das Design des R230 war eine sorgfältige Mischung aus Tradition und Moderne. Zehn junge Designer aus Deutschland, den USA und Japan begannen 1996 mit den ersten Entwürfen. Die Tradition zeigte sich in den vorderen Kotflügeln, deren Lufteinlässe ein typisches Merkmal des 300SL aus den 1950er Jahren aufgriffen. Die dünnen, flügelartigen, silberfarbenen Segmente dieser Lufteinlässe erinnern ebenfalls an die stolze Geschichte der Marke SL.
Der horizontal gestreckte Kühlergrill ist seit jeher ein unverwechselbares Merkmal des SL. Dieses traditionelle Design wurde leicht modifiziert, da der neue Wagen eine modernere, flachere Neigung als seine Vorgänger aufwies. Dadurch und durch die im Windkanal erprobte Keilform der Karosserie wirkte die Front sehr dynamisch.
Die Scheinwerfer setzten ein Thema fort, das erstmals 1995 bei der E-Klasse W210 eingeführt worden war: das "Vier-Augen-Design". Jetzt sind sie zu einem verschmolzen, ohne ihre ovale Grundform aufzugeben. Die lange Motorhaube nahm die Rundungen der Scheinwerfer auf und setzte sie in den muskulös wirkenden Kotflügeln fort. Im unteren Bereich der Kotflügel entwickelte sich unterhalb der Lufteinlässe eine weitere Linie, die entlang der Türen verlief und in den hinteren Stoßfänger überging. Die steil abfallende Windschutzscheibe verstärkte mit ihrer niedrigen, keilförmigen Silhouette den Sportwagencharakter.
Das Heck prägten große, dreieckige Rückleuchten, ähnlich denen des SLK, die in einheitlichem Rot leuchteten. Spezielle Filter vor den Rückstrahlern sorgten dafür, dass die Blinker gelb und das Rückfahrlicht weiß blieben.
Um den Kraftstoffverbrauch des neuen Wagens zu senken, wurden Teile wie Motorhaube, vordere Kotflügel, Türen, Kofferraumdeckel und Tanktrennwand aus Aluminium gefertigt.
Frühe Designvorschläge zeigten noch einen gewissen R129-Einfluss
Mit all den zusätzlichen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen war der Wagen trotz des verstärkten Einsatzes von Aluminium recht schwer. Je nach gewählter Motorisierung und Ausstattung wog er zwischen 1.755 und 2.120 kg.
Der Kraftstoffverbrauch des SL500 wurde mit 15,7 l/100 km im Stadtverkehr und 9,8 l/100 km auf der Autobahn angegeben. Ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,29 für das geschlossene Fahrzeug spricht für die ausgefeilte Aerodynamik von Karosserie und Fahrwerk. Der Vorgänger R129 hatte mit aufgesetztem Hardtop einen cw-Wert von 0,32. Der offene R230 erreichte bei geöffneten Seitenfenstern einen cw-Wert von nur 0,34, während der R129 einen Wert von 0,40 aufwies.
Diese rundere Form war schon näher an der Realität
Ein früher Vorschlag, der aber schon im Wesentlichen bereits das endgültige, geschwungene Layout des Armaturenbretts zeigt
Peter Pfeiffer, damals Leiter des Corporate Design, präsentiert eine Karosserievariante des neuen SL. Das obere Bild mit ihm zeigt ein interessantes Detail, das es nicht in die Serie schaffte: die Linie, die sich über den Lüftungsdüsen entlang der Karosserie bis zu den Hinterrädern zieht. Diese Linie wurde beim R231 wieder aufgenommen
Obwohl die moderne Technik ganz andere Darstellungsmöglichkeiten bot, war die gute alte Kunst des Modellierens immer noch ein wichtiger Bestandteil des Entwurfsprozesses, wie das Bild auf der nächsten Seite zeigt
Ein Teil des Entwicklungsprozesses bestand darin, das Auto extremen Temperaturen auszusetzten
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Liste der Serienausstattung wird länger
Zur umfangreichen Serienausstattung des SL gehörten lederbezogene Integralsitze, deren Aluminiumrahmen weniger massiv wirkte als beim R129. Die elektrische Sitz- und Lenkradverstellung war mit einer Memory-Funktion ausgestattet, die zusätzlich im elektronischen Zündschlüssel gespeichert wurde.
Zur weiteren Serienausstattung gehörten ein Multifunktionslenkrad, eine Klimaautomatik und ein Bose-Audiosystem mit CD-Wechsler. Zur Individualisierung des Fahrzeugs gab es eine lange Liste von Sonderausstattungen wie den Abstandsregel-Tempomaten DISTRONIC, das Bedien- und Anzeigesystem COMAND oder ein elektronisches Reifendruck-Kontrollsystem.
Die COMAND-Bedienoberfläche und ihre vermeintliche Intuitivität waren nicht unumstritten. Die Tasten für Radio, Telefon und GPS-gestützte Navigation waren dicht gedrängt. Die Sprachsteuerung und die ovalen Tasten am Lenkrad halfen zumindest ein wenig, sich zurechtzufinden, aber die Bedienung des Systems konnte sich auch nach Lektüre der Bedienungsanleitung als so schwierig erweisen wie das Hüten hungriger Ziegen. Manch einer war auch nach Jahren noch frustriert und schrieb sogar an Daimler-Benz (damals Daimler-Chrysler) mit der Bitte, sich doch einmal bei der japanischen Konkurrenz nach einfach zu bedienenden Systemen umzusehen.