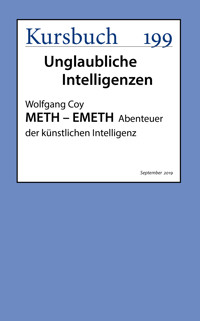
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In der Rubrik Kursbuch-Classics findet sich in Kursbuch 199 "METH-EMETH. Abenteuer der künstlichen Intelligenz" aus Kursbuch 75, aus dem Jahr 1984. Darin beschreibt Wolfgang Coy den Verlauf der Entwicklung künstlicher Intelligenzen unter Zuhilfenahme der jüdischen Golem-Legende. Für die 1980er Jahre muss er den Verlauf der technologischen Entwicklung tatsächlich analog zur Legende, nämlich von EMETH zu METH, von Wahrheit zu Tod, konstatieren. Was gilt für 2019?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Wolfgang CoyMETH – EMETHAbenteuer der künstlichen Intelligenz
Der Autor
Impressum
Wolfgang CoyMETH – EMETHAbenteuer der künstlichen Intelligenz
1. Der Golem als androider Helfer und Beschützer des Menschen ist eine Legende, die seit dem 10. Jahrhundert in allen jüdischen Gemeinden auftaucht. Die Übertragung der Golem-Legende auf den Rabbi Löw ist eine späte literarische Verneigung vor der Bedeutung der jüdischen Ghettos im Prag des Alchimisten-Kaisers Rudolf II. Kern dieser Legende ist der Traum vom Sprengen der Herrschaftsfesseln – zeigt sie auch kein Sprengen der politischen Fesseln, so doch die Beseitigung der unmittelbaren Fron des Menschen, der erzwungenen Arbeit. Sie ist darin den kühnen Träumen der Wissenschaft nach der Kopernikanischen (und vor allem Galileischen) Wende verpflichtet. Die Suche nach der Wahrheit ist nicht länger eine religiöse oder philosophische Aufgabe, sie soll der praktischen Veränderung der Welt dienen – selbst wenn das Erkennen der Wahrheit dabei auf der Strecke bleibt. Die Legende benennt die Spannungspole dieses Denkens deutlich: Der aus Lehm geschaffene Golem hat das Wort EMETH auf die Stirn geschrieben, das heißt »Wahrheit«. Und die Suche nach dieser, der befreienden Wahrheit endet damit, daß der Rabbi Löw seine nicht mehr zu bändigende Schöpfung auslöschen muß: Er wischt das E aus, es bleibt das Wort METH, und das heißt »Tod«. Damit ist diese Geschichte schon das ganze Lied der neuen, befreiten und als befreiend gedachten Wissenschaft: WAHRHEIT – TOD.
2. Die Golem-Legende berührt einen Kern menschlichen Denkens, einen Mythos: den Mythos der zweiten, der besseren Schöpfung, die Hoffnung auf das Überschreiten von Grenzen, deren Natur uns nicht bekannt ist (und vielleicht nicht bekannt sein kann). Da ist zunächst der Traum, die Sehnsucht nach der Befreiung von der Last der Arbeit und dahinter, wie es der Golem zuerst verheißt, die Befreiung von der Arbeit als Herrschaftsinstrument, als Peitsche der Unterdrückung, ob als Sklavenarbeit oder als Lohnarbeit oder als Arbeitslosigkeit. In seiner ersten Form nimmt dieser Traum die Gestalt des Märchens, der Legende an – kollektiver Gestaltungsprozeß gegen die herrschende Macht: gesellschaftliche Konstruktion einer neuen, besseren Wirklichkeit. In dieser Neugestaltung grenzt sich der Golem-Mythos vom Prometheus-Mythos ab; letzterer besingt die Unterordnung der Natur, ersterer die Verbesserung der Natur. Seit der Renaissance wird das Märchen verdrängt durch die wissenschaftliche Hypothese und ihre technische Realisierung: Stand des gesellschaftlichen Bewußtseins der industriellen Gesellschaften. Doch dahinter erscheint – im Spiegelbild, als verkehrtes Abbild, Neues und anderes zeigend – die Entfaltung des Mythos durch die Kunst. Dies ist der andere Weg zur Schöpfung der neuen Wirklichkeit. Traum – Wahrheit – Schöpfung sind die drei Bestimmenden dieser Utopie, die drei verschiedene, voneinander nicht unabhängige Wirklichkeiten konstruieren, drei Möglichkeiten menschlicher Arbeit also.
3. Das wissenschaftliche und »aufgeklärte« Spiegelbild des Menschen, soweit er sich als »arbeitenden« Menschen sehen wollte, hat sich in den letzten Jahrhunderten im engen Verbund mit der Entwicklung der Naturwissenschaften geändert. Norbert Wiener hat auf diese Veränderungen der »Menschenmodelle« hingewiesen. Aus dem Hebelmodell der Renaissance, sichtbar in Giovanni Battista Bracellis eigenartigen Graphiken des Maschinenmenschen und perfekt dargestellt in Leonardo da Vincis anatomischen Skizzen (und perfid von den modernen Sklavenhändlern zum Firmenzeichen erhoben), über das Pumpen- und Kreislaufmodell im Gefolge der thermodynamischen Entdeckungen, entstand das Steuermodell der Nervenstränge in der Kybernetik und das moderne Paradigma des Menschen als eines informationsverarbeitenden Systems (das man nur noch an den Rechner anschließen muß: »Mensch-Maschine-Kommunikation« heißt der neue Kampfruf der Informatik). Was uns noch fehlt, ist die adäquate Technik zur Realisierung »biologischer« und »selbstreproduzierender« Systeme, doch da hat sich auch schon die kleine, aber finanzstarke Gruppe der Genbastler gemeldet. Aber: Noch beherrschen der Computer und der Robot, die menschenleere Fabrik und das automatische Schlachtfeld die projektive Phantasie der Technokraten – ihnen soll deshalb unsere Aufmerksamkeit gelten.
Folgt der Alltagsverstand in gemächlichem Tempo dem herrschenden Paradigma der Naturwissenschaften, so greift die Kunst – im folgenden kurz (zu kurz?) Literatur genannt – diesen meist vor. Die Literatur ist dem Märchen halt direkter verbunden als die Naturwissenschaften, wenngleich nicht unbedingt enger. Die große Welle der antizipierenden Androiden-Literatur findet sich in der Romantik (die gerade darin zu Unrecht als weltabgewandt begrüßt und verdammt wurde). Sicher als Antwort auf die mechanischen Meisterwerke Vaucansons und Jaquet-Drozs, all die kleinen Enten, Nachtigallen, Schreiber, Zeichner und Cembalistinnen, aber auch als Antwort auf die Architekten im Gefolge Ledoux’, ihre Manufakturen, Gefängnisse, Kasernen und Spitäler und deren perfekte Herrschaftsmechanik. Der wesentliche Unterschied besteht darin, daß sich die Literatur (bis hin zu ihrer kümmerlichen Variante dieses Jahrhunderts, SF unter Kennern und Gönnern genannt) nicht auf die unvollkommenen technischen Implementierungen einläßt, sondern perfekte Kopien der unvollkommenen Originale liefert – die Imagination wirklich werden läßt. Vor allem E. T. A. Hoffmann hat die Erscheinung des Spießers, der Spießerin als unvollkommenen gesellschaftlichen Automaten beschrieben. »Die Automate« und »Der Sandmann« sind zwei dieser Erzählungen, die den Blendungscharakter der gesellschaftlichen »Rolle« als eine mechanische Funktion zeigen. Hoffmann hat in den Märchen die mechanischen Androiden noch weiter entwickelt, da selbst Mohrrüben (in »Die Königsbraut«) und Flöhe (in »Meister Floh«) menschliche Rollen perfekt spielen können – wenn nur ihre menschlichen Partner/Gegner sich darauf einlassen (also haben die Gentechnologen auch ihre literarischen Vorbilder). Ludwig Tieck behandelt das gleiche Thema in »Die Vogelscheuche«. Bei Jean Paul findet sich der (selbst für J. P.) eigenartige Text »Der Maschinen-Mann nebst seinen Eigenschaften«, eine Beschreibung für »Leute auf dem Monde, auf dem Saturn, auf dessen Trabanten, auf dessen Ringen«. Geschildert wird die Umwandlung eines Menschen zu einem Maschinenwesen, der Ersatz aller menschlichen Funktionen durch maschinelle Hilfsmittel. Die Auswahl des Leserkreises ist zwingend: Der Maschinen-Mann ist kein Sonderling, sondern der Genius des ganzen 18. Jahrhunderts, ja das Jahrhundert selber; Leser kann die Geschichte deshalb nur noch auf fremden Planeten finden, da die irdischen Leser schon alle Maschinen sind.





























