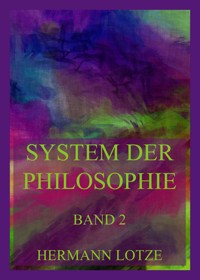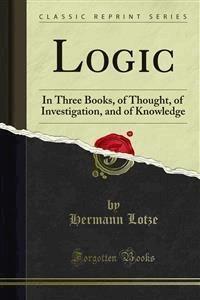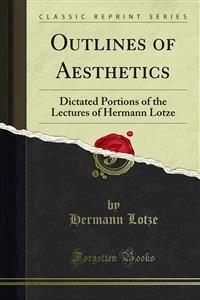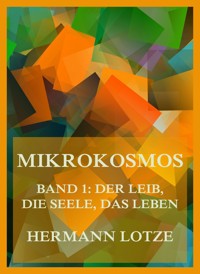
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Lotze liefert seine weltberühmte Anthropologie in diesem seinem populären dreibändigen Hauptwerk "Mikrokosmos, Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit." Lotzes Ehrgeiz ließ ihn in diesem ungemein reichhaltigen, reifen, gediegenen und unvergleichlich schön geschriebenen Werk dem interessierten Leser ein Seitenstück einerseits zu Humboldts "Kosmos", anderseits zu Herders "Ideen" schenken. Die Wirkung sowohl auf die naturwissenschaftlichen als auf die philosophischen und theologischen Kreise war damals tief und nachhaltig und ist es heute noch. Mit diesem Buch hat Lotze nicht nur den Zugang zum Herzen der Philosophie gefunden, sondern sich auch ein Stimmrecht unter deren größten Köpfen erworben. Dies ist Band eins von drei, betitelt "Der Leib."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mikrokosmos
Band 1: Der Leib, die Seele, das Leben
HERMANN LOTZE
Mikrokosmos, Band 1, Hermann Lotze
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682772
Quelle: https://www.google.de/books/edition/Mikrokosmos/cR-nKipEYAAC?hl=de&gbpv=1&dq=lotze+mikrokosmos&printsec=frontcover
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort des Herausgebers. 1
Vorwort2
Erstes Buch. Der Leib.10
Erstes Kapitel. Der Streit der Naturansichten.10
Zweites Kapitel. Die mechanische Natur.29
Drittes Kapitel. Der Grund des Lebens.48
Viertes Kapitel. Der Mechanismus des Lebens.68
Fünftes Kapitel. Der Bau des tierischen Körpers.87
Sechstes Kapitel. Die Erhaltung des Lebens.106
Zweites Buch. Die Seele.121
Erstes Kapitel. Das Dasein der Seele.121
Zweites Kapitel. Natur und Vermögen der Seele.141
Drittes Kapitel. Von dem Verlauf der Vorstellungen.162
Viertes Kapitel. Die Formen des beziehenden Wissens.184
Fünftes Kapitel. Von den Gefühlen, dem Selbstbewusstsein und dem Willen.200
Drittes Buch. Das Leben.221
Erstes Kapitel. Der Zusammenhang zwischen Leib und Seele.221
Zweites Kapitel. Von dem Sitz der Seele.240
Drittes Kapitel. Formen der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele.260
Viertes Kapitel. Das Leben der Materie.283
Fünftes Kapitel. Von den ersten und den letzten Dingen des Seelenlebens.305
Schluss.324
Vorwort des Herausgebers
Sehr geehrter Leser,
wir, der Herausgeber dieses Buches, halten Hermann Lotzes Werke, die lange Zeit nur kaum, schwer oder gar nicht erhältlich waren, für unverzichtbar für das kulturelle Erbe Deutschlands und der Welt.
Aus diesem Grund haben wir unter anderem dieses Ihnen hier vorliegende Werk zusammengesetzt aus Scans des in den 1870er Jahren erschienen Originals –– eine spannende, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe, da selbst den allerbesten Adleraugen der eine oder andere Druck- oder grammatikalische Fehler entgeht.
Deswegen geschätzter Leser, seien Sie nachsichtig, wenn Sie über etwas stolpern, das so ganz offensichtlich dort nicht hingehört. Teilen Sie uns auch gerne Ihre Funde mit, wir werden die entsprechenden Stellen schnellstens berichtigen.
In diesem Sinne, sehr viel Freude beim Lesen,
Ihr Jazzybee Verlag
(Jürgen Beck)
Vorwort
Zwischen den Bedürfnissen des Gemütes und den Ergebnissen menschlicher Wissenschaft ist ein alter nie geschlichteter Zwist. Jene hohen Träume des Herzens aufzugeben, die den Zusammenhang der Welt anders und schöner gestaltet wissen möchten, als der unbefangene Blick der Beobachtung ihn zu sehen vermag: diese Entsagung ist zu allen Zeiten als der Anfang jeglicher Einsicht gefordert worden. Und gewiss ist das, was man so gern als höhere Ansicht der Dinge dem gemeinen Erkennen gegenüberstellt, am häufigsten doch nur eine sehnsüchtige Ahnung, wohl kundig der Schranken, denen sie entfliehen, aber nur wenig des Zieles, das sie erreichen möchte. Denn aus dem besten Teil unseres Wesens entsprungen, empfangen doch jene Ansichten ihre bestimmtere Färbung von sehr verschiedenartigen Einflüssen. Genährt an mancherlei Zweifeln und Nachgedanken über die Schicksale des Lebens und über den Inhalt eines doch immer beschränkten Erfahrungskreises, verleugnen sie weder die Eindrücke überlieferter Bildung und augenblicklicher Zeitrichtungen, noch sind sie selbst unabhängig von dem natürlichen Wechsel der Stimmungen, die andere sind in der Jugend, andere nach der Aufsammlung mannigfaltiger Erfahrungen. Man kann nicht ernstlich hoffen, dass eine so unklare und unruhige Bewegung des Gemütes den Zusammenhang der Dinge richtiger zeichnen werde, als die besonnene Untersuchung, mit der in der Wissenschaft das Allen gemeinsame Denken beschäftigt ist. Dürfen wir dem menschlichen Herzen nicht gebieten, seine sehnsüchtigen Fragen zu unterdrücken, so wird es gleichwohl ihre Beantwortung als eine nebenher reifende Frucht jener Erkenntnis erwarten müssen, die nicht von denselben Fragen, sondern von leidenschaftsloseren und darum klareren Anfängen ausging.
Aber das wachsende Selbstgefühl der Wissenschaft, die nach Jahrhunderten des Schwankens einzelne Gebiete der Erscheinungen zweifellosen Gesetzen unterworfen sieht, droht dieses richtigere Verhältnis zwischen Gemüt und Erkennen in eine neue unwahre Stellung zu verschieben. Man begnügt sich damit nicht, am Anfange der Untersuchung sich der zudringlichen Fragen zu erwehren, mit denen unsere Wünsche, Träume und Hoffnungen das beginnende Werk zu verwirren bereit sind: man leugnet zugleich die Verpflichtung, im Laufe der Forschung sich jemals zu ihnen zurückzuwenden. Ein reiner Dienst der Wahrheit um der Wahrheit willen, habe die Wissenschaft nicht zu sorgen, ob sie die selbstsüchtigen Wünsche des Gemütes befriedigen oder verletzen werde. Und von der Verzagtheit wendet sich auch hier das menschliche Herz zum Trotz. Nachdem es einmal den Stolz der unbefangenen und rücksichtslosen Untersuchung gekostet hat, wirft es sich in jenen falschen und so gebrechlichen Heroismus, der dem entsagt zu haben sich rühmt, dem nie entsagt werden darf, und schätzt, in maßlosem Vertrauen auf keineswegs unbestreitbare Voraussetzungen, die Wahrheit seiner neuen Weltansicht nach dem Grad der Feindseligkeit, mit welchem sie Alles beleidigt, was das lebendige Gemüt außerhalb der Wissenschaft für unantastbar achtet.
Diese Vergötterung der Wahrheit scheint mir weder als unabhängige Schätzung ihres Wertes gerecht noch vorteilhaft für den Zweck zu bewirkender Überzeugung, den die Wissenschaft doch stets verfolgen muss.
Könnte es der menschlichen Forschung nur darauf ankommen, den Bestand der vorhandenen Welt erkennend abzubilden, welchen Wert hätte dann doch ihre ganze Mühe, die mit der öden Wiederholung schlösse, dass, was außerhalb der Seele vorhanden war, nun nachgebildet in ihr noch einmal vorkäme? Welche Bedeutung hätte das leere Spiel dieser, Verdoppelung, welche Pflicht der denkende Geist, ein Spiegel zu sein für das, was nicht denkt, wäre nicht die Auffindung der Wahrheit überall zugleich die Erzeugung eines Gutes, dessen Wert die Mühe seiner Gewinnung rechtfertigt? Der Einzelne, in die Teilung der geistigen Arbeit verstrickt, welche der wachsende Umfang der Wissenschaft unvermeidlich herbeiführt, mag für Augenblicke den Zusammenhang seiner engbegrenzten Beschäftigung mit den großen Zwecken des menschlichen Lebens vergessen; es mag ihm scheinen, als sei die Förderung des Wissens um des Wissens willen an sich ein verständliches und würdiges Ziel menschlicher Bestrebungen. Aber alle seine Bemühungen haben zuletzt doch nur die Bedeutung, zusammengefasst mit denen unzähliger Anderen, ein Bild der Welt zu entwerfen, das uns ausdeutet, was wir als den wahren Sinn des Daseins zu ehren, was wir zu tun, was zu hoffen haben. Jene strenge Unbefangenheit der Forschung aber, die ohne alle Rücksicht auf diese Fragen zu dem Aufbau des Wissens mitwirkt, ist nur eine weise Enthaltsamkeit, die eine späte aber volle Beantwortung derselben von dem vereinigten Ergebnisse der Untersuchungen erwartet und sie der verfrühten und einseitigen Aufklärung vorzieht, mit welcher untergeordnete und zufällige Standpunkte unser Verlangen unzureichend beschwichtigen. Den unruhigen Fragen daher, wie sie unzusammenhängend die Bedrängnis des Lebens erzeugt, mag die Wissenschaft eine augenblickliche Antwort vorenthalten; sie mag auf den Fortschritt der Forschung verweisen, der manche Schwierigkeit in Nichts auflösen wird, ohne die neuen Verwirrungen zu verschulden, in welche die vereinzelten Beantwortungen zudringlicher Zweifel uns stets zu verwickeln pflegen. Aber das Ganze der Wahrheit dürfen wir nicht als eine abgeschlossene Glorie für sich betrachten, von der keine notwendige Beziehung mehr zu den Bewegungen des Gemütes hinüberliefe, aus denen doch stets der erste Antrieb zu ihrer Entdeckung hervorging. So oft vielmehr eine Umwälzung der Wissenschaft alte Auffassungsweisen verdrängt hat, wird die neue Gestaltung der Ansichten sich durch die bleibende oder wachsende Befriedigung rechtfertigen müssen, die sie den unabweisbaren Anforderungen unseres Gemütes zu gewähren vermag.
Ihre eigenen Zwecke müssen jedoch die Wissenschaft nicht minder bestimmen, eine solche Verständigung zu suchen. Denn sie selbst, welchen anderen Ort des Daseins hätte sie, als die Überzeugung derer, die von ihrer Wahrheit durchdrungen sind? Aber sie wird nie diese Überzeugung bewirken, wenn sie vergisst, dass alle Bereiche ihrer Forschung, alle Gebiete der geistigen und natürlichen Welt vor jedem Anfange einer geordneten Untersuchung längst von unseren Hoffnungen, Ahnungen und Wünschen überzogen und in Besitz genommen sind. Überall zu spät kommend, findet sie nirgends eine völlig unbefangene Empfänglichkeit; sie findet überall vielmehr bereits befestigt jene Weltansicht des Gemütes vor, die mit dem ganzen Gewicht, welches sie ihrem Ursprunge aus der lebendigsten Sehnsucht des Geistes verdankt, sich hemmend an den Gang ihrer Beweise hängen wird. Und wo eine widerwillige Überzeugung im Einzelnen dennoch erzwungen wird, da wird sie ebenso leicht wieder im Ganzen durch die Erinnerung vereitelt, dass ja die Macht jener ersten Grundsätze, durch deren Folgen die Wissenschaft uns bezwingen will, zuletzt auch nur auf einem unmittelbaren Glauben an ihre Wahrheit beruht. Mit demselben Glauben meint man viel richtiger sogleich jenes Weltbild selbst festhalten zu müssen, dessen Zusammenklang mit der Stimme unserer Wünsche seine Wahrheit zu bekräftigen scheint. Und so lässt man das Ganze der Wissenschaft als ein Irrsal dahingestellt sein, in welches die Erkenntnis, abgelöst von ihrem Zusammenhange mit dem ganzen lebendigen Geiste, auf nicht weiter angebbare Weise sich verwickelt habe.
Man kann im Glauben an die Welt des Gemütes nicht schwärmen, ohne bei jedem Schritt des wirklichen Lebens die Vorteile der Wissenschaft zu benutzen und ihre Wahrheit stillschweigend dadurch anzuerkennen; man kann ebenso wenig der Wissenschaft leben, ohne Lust und Last des Daseins zu empfinden und sich von einer Weltordnung anderer Art überall umspannt zu fühlen, über welche jene kaum kärgliche Erläuterungen gibt. Was liegt näher als die Ausflucht, sich an beide Welten zu verteilen, beiden angehören zu wollen, ohne sie doch zu vereinigen? in der Wissenschaft den Grundsätzen des Erkennens bis in ihre äußersten Ergebnisse zu folgen und im Leben sich von den hergebrachten Gewöhnungen des Glaubens und Handelns nach ganz anderen Richtungen treiben zu lassen?
Dass diese Zwiespältigkeit der Überzeugung häufig die einzige Lösung ist, die man findet, ist nicht befremdlich; trauriger, wenn sie als die wahre Fassung unserer Stellung zur Welt empfohlen würde. Die Unvollkommenheit menschlichen Wissens kann uns wohl am Ende unserer Bemühungen zu dem Geständnisse nötigen, dass die Ergebnisse des Erkennens und des Glaubens sich zu keinem lückenlosen Weltbau vereinigen; aber nie können wir teilnahmslos zusehen, wie das Erkennen durch seinen Widerspruch die Grundlagen des Glaubens unterhöhlt, oder dieser kühl im Ganzen das ablehnt, was die Wissenschaft eifrig im Einzelnen gestaltet hat. Immer von neuem müssen wir vielmehr den ausdrücklichen Versuch wiederholen, beiden ihre Rechte zu wahren und zu zeigen, wie wenig unauflöslich der Widerspruch ist, in welchen sie unentwirrbar verwickelt erscheinen.
Der Übermut der philosophischen Forschung und die rastlosen Fortschritte der Naturwissenschaft haben von verschiedenen Seiten her jenes Weltbild zu zerstören gesucht, in welchem das menschliche Gemüt die Befriedigung seiner Sehnsucht fand. Die Beunruhigungen jedoch, welche die Angriffe der Philosophie erzeugten, hat unsere Zeit durch das wirksamste Mittel überwunden, durch die völlige Teilnahmslosigkeit, mit der sie sich von den kaum mehr beachteten Anstrengungen der Spekulation abwendet. Sie hat sich nicht ebenso leicht der weit zudringlicheren Beredsamkeit der Naturwissenschaften entziehen können, deren Behauptungen jeden Augenblick die Erfahrungen des alltäglichsten Lebens bestätigten. Dieser übermächtige Einfluss, den die wahrhaft großartige Entwicklung der Naturkenntnis auf alle Bestrebungen unseres Jahrhunderts äußert, ruft unfehlbar einen ebenso anwachsenden Widerstand gegen die Beeinträchtigungen hervor, die man von ihm für das Höchste der menschlichen Bildung erwartet. Und so stehen wieder die alten Gegensätze zum Kampfe auf: hier die Erkenntnis der Sinnenwelt mit ihrem täglich sich mehrenden Reichtum des bestimmtesten Wissens und der Überredungskraft anschaulicher Tatsachen, dort die Ahnungen des Übersinnlichen, kaum ihres eigenen Inhaltes recht sicher, jeder Beweisführung schwer zugänglich, aber durch ein stets wiederkehrendes Bewusstsein ihrer dennoch notwendigen Wahrheit noch unzugänglicher für jede Widerlegung. Dass der Streit zwischen diesen beiden eine unnötige Qual ist, die wir durch zu frühes Abbrechen der Untersuchung uns selbst zufügen, dies ist die Überzeugung, die wir befestigen möchten.
Gewiss mit Unrecht wendet sich die Naturwissenschaft ganz von den ästhetischen und religiösen Gedankenkreisen ab, die man ihr als eine höhere Auffassung der Dinge überzuordnen liebt; sie fürchtet ohne Grund, ihre scharfbegrenzten Begriffe und die feste Fügung ihrer Methoden durch die Aufnahme von Elementen zerrüttet zu sehen, die aller Berechnung unfähig, ihre eigene Unbestimmtheit und Nebelhaftigkeit Allem mitteilen zu müssen scheinen, was mit ihnen in Berührung kommt; sie vergisst endlich, dass ihre eigenen Grundlagen, unsere Vorstellungen von Kräften und Naturgesehen, noch nicht die Schlussgewebe der Fäden sind, die sich in der Wirklichkeit verschlingen. Auch sie laufen vielmehr für einen schärferen Blick in dasselbe Gebiet des Übersinnlichen zurück, dessen Grenzen man umgehen möchte.
Nicht minder unbegründet aber ist, was anderseits der Anerkennung der mechanischen Naturauffassung so hemmend entgegensteht: die ängstliche Furcht, vor ihren Folgerungen alle Lebendigkeit, Freiheit und Poesie aus der Welt verschwinden zu sehen. Wie oft ist diese Furcht schon geäußert worden, und wie oft hat der unaufhaltsame Fortschritt der Entdeckungen neue Quellen der Poesie eröffnet für die alten, die er verschütten musste! Jenes Gefühl der Heimatlichkeit, mit dem ein abgeschlossenes Volk, unkundig des unermesslichen menschlichen Lebens auch außerhalb seiner Grenzen, sich selbst als die ganze Menschheit, und jeden Hügel, jede Quelle seines Landes in der pflegenden Obhut einer besonderen Gottheit fühlen durfte: diese Einigkeit des Göttlichen und Menschlichen ist überall zu Grunde gegangen in dem Fortschritt der geographischen Kenntnis, den der wachsende Völkerverkehr herbeiführte. Aber diese erweiterte Aussicht verdarb nicht, sondern veränderte nur und erhöhte den poetischen Reiz der Welt. Die Entdeckungen der Astronomie zerstörten den Begriff des Himmels, wie den der Erde; sie lösten jenen, den anschaulichen Wohnsitz der Götter, in die Unermesslichkeit eines Luftkreises auf, in welchem die Phantasie keine Heimat des Übersinnlichen mehr zu finden wusste; sie wandelten die Erde, die einzige Stätte des Lebens und der Geschichte, in einen der kleinsten Teile des grenzenlosen Weltalls um. Und Schritt für Schritt nahm diese Zerstörung altgewohnter Anschauungen ihren weiteren Verlauf.
Aus einem ruhenden Mittelpunkt ward die Erde ein verloren wandelnder Planet, um eine Sonne kreisend, die vorher nur zu ihrem Schmuck und Dienst vorhanden schien; selbst die Harmonie der Sphären schwieg, und Alle haben wir uns darein gefunden, dass ein stummer, allgemeinen Gesetzen gehorchender Umschwung unzähliger Himmelskörper die umfassende Welt ist, in der wir mit allen unseren Hoffnungen, Wünschen und Bestrebungen wohnen.
Dass diese Umbildung der kosmographischen Anschauungen auf das Bedeutsamste im Laufe der Geschichte die Phantasie der Völker umgestimmt hat, wer möchte dies leugnen? Anders lebt es sich gewiss auf der Scheibe der Erde, wenn die sichtbaren Gipfel des Olymp und in erreichbarer Ferne die Zugänge der Unterwelt alle höchsten und tiefsten Geheimnisse des Weltbaues in die vertrauten Grenzen der anschaulichen Heimat einschließen; anders auf der rollenden Kugel, die weder im Inneren noch um sich in der öden Unermesslichkeit des Luftkreises Platz für jenes Verborgene zu haben scheint, durch dessen Ahnung allein das menschliche Leben zur Entfaltung seiner höchsten Blüten befruchtet wird. An dem Faden einer heiligen Überlieferung mochte die Vorzeit das Gewirr der Völker, das den bunten Markt des Lebens füllt, in die stille Heimlichkeit des Paradieses zurückleiten, in dessen Schatten die Mannigfaltigkeit der menschlichen Geschlechter das verbindende Bewusstsein eines gemeinsamen Ursprunges wiederfand; die Entdeckung neuer Erdteile erschütterte auch diesen Glauben; andere Völker traten in den Gesichtskreis ein, unkundig der alten Sagen, und die gemeinsame Heimat der Menschheit wurde weit über die äußersten Grenzen geschichtlicher Erinnerung hinausgerückt. Endlich tat die starre Rinde des Planeten selbst, den das menschliche Geschlecht seit dem Tage seiner Entstehung zu besitzen wähnte, ihren verschlossenen Mund auf und erzählte von unmessbaren Zeiträumen des Daseins, in denen dies menschliche Leben mit seinem Trotz und seiner Verzagtheit noch nicht war und die schöpferische Natur, auch so sich genügend, zahlreiche Gattungen des Lebendigen wechselnd entstehen und vergehen ließ.
So sind alle die freundlichen Begrenzungen zerfallen, durch die unser Dasein in eine schöne Sicherheit eingefriedigt lag; unermesslich, frei und kühl ist die Aussicht um uns her geworden. Aber alle diese Erweiterungen unserer Kenntnisse haben weder die Poesie aus der Welt vertrieben noch unsere religiösen Überzeugungen anders als förderlich berührt; sie haben uns genötigt, was in anschaulicher Nähe uns verloren war, mit größerer geistiger Anstrengung in einer übersinnlichen Welt wiederzufinden. Die Befriedigung, die unser Gemüt in Lieblingsansichten fand, ist stets, wenn diese dem Fortschritt der Wissenschaft geopfert werden mussten, in anderen neuen Formen wieder möglich geworden. Wie dem Einzelnen im Verlaufe seiner Lebensalter, so verwandeln sich auch unvermeidlich in der Geschichte des menschlichen Geschlechtes die bestimmten Umrisse des Bildes, in dem es den Inhalt seiner höchsten und unverlierbaren Ahnungen ausprägt. Nutzlos ist jede Anstrengung, der klaren Erkenntnis der Wissenschaft zu widerstreben und ein Bild festhalten zu wollen, von dem uns doch das heimliche Bewusstsein verfolgt, dass es ein gebrechlicher Traum sei; gleich übel beraten aber ist die Verzweiflung, die das aufgibt, was bei allem Wechsel seiner Formen doch der unerschütterliche Zielpunkt menschlicher Bildung sein muss. Gestehen wir vielmehr zu, dass jene höhere Auffassung der Dinge, deren wir uns bald rühmen, bald gänzlich unfähig fühlen, in ihrem dunklen Drange sich des rechten Weges wohl bewusst ist, und dass jede beachtete Einrede der Wissenschaft nur eine der täuschenden Beleuchtungen zerstreut, welche die wechselnden Standpunkte unserer veränderlichen Erfahrung auf das beständig gleiche Ziel unserer Sehnsucht werfen.
Jene Entgötterung des gesamten Weltbaues, welche die kosmographischen Entdeckungen der Vorzeit unwiderruflich vollzogen haben, den Umsturz der Mythologie, dürfen wir als verschmerzt ansehen, und der letzten Klage, die in Schillers Göttern Griechenlands sich ergoss, wird nie ein Versuch folgen, im Widerstreit mit den Lehren der Wissenschaft den Glauben an dieses Vergangene wiederherzustellen. Große Umwälzungen der religiösen Ansichten haben über diesen Verlust hinausgeführt und längst den überreichen Ersatz dargeboten. Aber wie die wachsende Fernsicht der Astronomie den großen Schauplatz des menschlichen Lebens aus seiner unmittelbaren Verschmelzung mit dem Göttlichen löste, so beginnt das weitere Vordringen der mechanischen Wissenschaft auch die kleinere Welt, den Mikrokosmos des menschlichen Wesens, mit gleicher Zersetzung zu bedrohen. Ich denke nur flüchtig hierbei an die überhandnehmende Verbreitung materialistischer Auffassungen, die alles geistige Leben auf das blinde Wirken eines körperlichen Mechanismus zurückführen möchten. So breit und zuversichtlich der Strom dieser Ansichten fließt, hat er seine Quelle doch keineswegs in unabweisbaren Annahmen, die mit dem Geiste der mechanischen Naturforschung unzertrennlich zusammenhingen. Aber auch innerhalb der Grenzen, in denen sie sich mit besserem Recht bewegt, ist die zersetzende und zerstörende Tätigkeit dieser Forschung sichtbar genug und beginnt alle jene durchdringende Einheit des Körpers und der Seele zu bestreiten, auf der jede Schönheit und Lebendigkeit der Gestalten, jede Bedeutsamkeit und jeder Wert ihres Wechselverkehrs mit der äußeren Welt zu beruhen schien. Gegen die Wahrheit der sinnlichen Erkenntnis, gegen die freie Willkürlichkeit der Bewegungen, gegen die schöpferische, aus sich selbst quellende Entwicklung des körperlichen Daseins überhaupt sind die Angriffe der physiologischen Wissenschaft gerichtet gewesen und haben so alle jene Züge in Frage gestellt, in denen das unbefangene Gefühl den Kern aller Poesie des lebendigen Daseins zu besitzen glaubt. Befremdlich kann daher die Standhaftigkeit nicht sein, mit welcher die Weltansicht des Gemütes als höhere Auffassung der Dinge den überzeugenden Darstellungen der mechanischen Naturbetrachtung hier zu widerstreben sucht; umso nötiger dagegen der Versuch, die Harmlosigkeit dieser Ansicht nachzuweisen, die, wo sie uns zwingt, Ansichten zu opfern, mit denen wir einen Teil unseres Selbst hinzugeben glauben, doch durch das, was sie uns zurückgibt, die verlorene Befriedigung wieder möglich macht.
Und je mehr ich selbst bemüht gewesen bin, den Grundsätzen der mechanischen Naturbetrachtung Eingang in das Gebiet des organischen Lebens zu bereiten, das sie zaghafter zu betreten schien, als das Wesen der Sache es gebot: umso mehr fühle ich den Antrieb, nun auch jene andere Seite hervorzukehren, die während aller jener Bestrebungen mir gleich sehr am Herzen lag. Ich darf kaum hoffen, ein sehr günstiges Vorurteil für den Erfolg dieser Bemühung anzutreffen; denn was jene früheren Darstellungen an Zustimmung etwa gefunden haben mögen, das dürften sie am meisten der Leichtigkeit verdanken, mit der jede vermittelnde Ansicht sich dahin umdeuten lässt, dass sie doch wieder einer der einseitigen äußersten Meinungen günstig erscheint, welche sie vermeiden wollte. Gleichwohl liegt in dieser Vermittlung allein der wahre Lebenspunkt der Wissenschaft; nicht darin freilich, dass wir bald der einen bald der anderen Ansicht zerstückelte Zugeständnisse machen, sondern darin, dass wir nachweisen, wie ausnahmslos universell die Ausdehnung, und zugleich wie völlig untergeordnet die Bedeutung der Sendung ist, welche der Mechanismus in dem Bau der Welt zu erfüllen hat.
Es ist nicht der umfassende Kosmos des Weltganzen, dessen Beschreibung wir nach dem Muster, das unserem Volke gegeben ist, auch nur in dem beschränkteren Sinne dieser ausgesprochenen Aufgabe zu wiederholen wagen möchten. Je mehr die Züge jenes großen Weltbildes in das allgemeine Bewusstsein dringen, desto lebhafter werden sie uns auf uns selbst zurücklenken und die Fragen von neuem anregen, welche Bedeutung nun der Mensch und das menschliche Leben mit seinen beständigen Erscheinungen und dem veränderlichen Laufe seiner Geschichte in dem großen Ganzen der Natur hat, deren beständigem Einfluss wir uns nach den Ergebnissen der neueren Wissenschaft mehr als je unterworfen fühlen. Indem wir hierüber die Reflexionen zu sammeln suchen, die nicht allein innerhalb der Grenzen der Schule, sondern überall im Leben sich dem nachdenklichen Gemüte aufdrängen, wiederholen wir unter den veränderten Anschauungen, welche die Gegenwart gewonnen, das Unternehmen, das in Herders Ideen zur Geschichte der Menschheit seinen glänzenden Beginn gefunden hat.
Erstes Buch. Der Leib.
Erstes Kapitel. Der Streit der Naturansichten.
Nach der frühesten Vorzeit unseres Geschlechtes wenden wir zuweilen, ein verlorenes Gut beklagend, unsere Gedanken zurück. Damals, in der schönen Jugend der Menschheit, habe ein gegenseitiges Verstehen die Natur dem Geiste genähert, und freiwillig habe sie vor ihm das verwandte Leben ihres Inneren entfaltet, das sie jetzt dem Ernst der Untersuchung verberge. Ich weiß nicht, ob diese Klage gerecht, ob jenes Gut verloren oder je vorhanden gewesen ist. Alle jene Regsamkeit freilich, die unser eigenes Gemüt füllt, den vielgestaltigen Lauf der Gedanken, das heimliche Spiel der Gefühle, die lebendige Kraft des Wollens: das Alles glaubt die Kindheit des Einzelnen und glaubte die Jugend der Erkenntnis auch unter den fremdartigsten Formen der äußern Welt wiederzufinden. Doch wohl nur dem Kinde mag der geringe Umfang seiner Erfahrungen und der geringere Ernst ihrer Verknüpfung den Genuss dieser Täuschung fristen. Die Jugend des menschlichen Geschlechtes dagegen umfasst das Altern vieler Einzelnen. Schon früh musste sie deshalb die volle Mannigfaltigkeit der Erfahrungen, die ein ganzes menschliches Leben füllen, so wie jenes Maß verständiger Einsicht besitzen, welches ohne die Hilfe geschichtlicher Überlieferung jedem Einzelnen aus der Reihe seiner Erlebnisse hervorgeht. In die Sinnesart einer so entfernten Vergangenheit dürfen wir nicht hoffen, uns völlig zurückzuversetzen. Selten werden wir mit Sicherheit entscheiden, wie vieles von dem Inhalt einer uns überlieferten Weltansicht schon jenen frühen Zeiten nur noch als ein schönes Bild der Dichtung, wie vieles Andere länger für volle Wirklichkeit gegolten hat. Aber dies werden wir uns doch zugestehen müssen, dass schon das jugendliche Nachdenken der frühesten Geschlechter einen spröden und dunklen Kern der Dinge anerkennen musste, und dass eine so schrankenlose Beseelung, wie wir so oft sie der Natur wiedergewinnen möchten, entweder keine der ursprünglichsten, oder eine der am frühesten wieder aufgegebenen Vorstellungen der menschlichen Bildung gewesen ist.
Denn nur eine völlig tatenlose Beschaulichkeit könnte sich ungestört an dem Gedanken einer Lebendigkeit erfreuen, die mit freier willkürlicher Regsamkeit alle Gebiete der Natur durchdränge. Das wirkliche Leben dagegen muss für die Befriedigung seiner Bedürfnisse und für alle Zwecke seines Handelns auf eine gewisse Beständigkeit und Berechenbarkeit der Ereignisse bauen dürfen. Die alltäglichsten Erfahrungen reichen hin, uns von dieser willenlosen Zuverlässigkeit der Dinge zu überzeugen, und sie mussten früh schon das Gemüt gewöhnen, die Welt, in der die menschliche Tätigkeit sich bewegt, als ein Reich benutzbarer Sachen zu behandeln, in welchem alle Wechselwirkungen an die leblose Regelmäßigkeit allgemeiner Gesche gebunden sind.
Die einfachsten Vorkommnisse des Lebens lehrten unvermeidlich die Wirkung der Schwere kennen; der roheste Versuch zum Bau eines Obdachs erregte Vorstellungen vom Gleichgewicht der Massen, von der Verteilung des Druckes, von den Vorteilen des Hebels; Erfahrungen, die wir in der Tat schon die mindest gebildeten Völker zu dem mannigfachsten Gebrauche anwenden sehen. Pfeil und Bogen benutzend, musste die früheste Jagdkunst auf die Schnellkraft der gespannten Saite rechnen, ja sie musste stillschweigend zugleich auf die Regelmäßigkeit vertrauen, mit der diese Eigenschaft unter wechselnden Bedingungen wächst und abnimmt. Selbst die noch einfachere Fertigkeit, durch den geschleuderten Stein das Wild zu erlegen, wäre nie geübt worden, hätte nicht wie eine unmittelbare Gewissheit gleichsam in Fleisch und Blut des Armes die Voraussicht gelebt, dass Richtung und Geschwindigkeit des geworfenen Körpers durch die fühlbaren Unterschiede in der Art und Größe unserer Anstrengung völlig bestimmt sein werde.
Keine Mythologie hat den Kreis dieser Erscheinungen und das in ihnen sichtbare Band einer naturgesetzlichen Verknüpfung absichtlich in das Ganze ihres Weltbildes aufgenommen. Und doch lagen alle diese Dinge, Schwere, Gleichgewicht der Massen, Stoß und Mitteilung der Bewegung, täglich vor Aller Augen; doch sind sie es, durch deren willkürliche Benutzung der Mensch um sich her jenen künstlichen Verlauf der Dinge, jene technische und wohnliche Natur begründet, auf die sein Leben ungleich mehr, als auf die ursprüngliche wilde Kraft und Schönheit der Schöpfung bezogen ist. Aber vielleicht eben deshalb, weil diese Dinge vor Aller Augen lagen, konnte der weitsichtige Blick der Phantasie über sie hinwegsehen und das blendende Bild einer lebendig beseelten Natur entwerfen, während das handelnde Leben fortfuhr, für seine Zwecke die Leblosigkeit der gemeinen Wirklichkeit auszubeuten. Denn nur allzu leicht wohnen in derselben menschlichen Seele die verschiedensten Gedanken friedlich nebeneinander, ohne dass ihr Widerspruch bis zur Notwendigkeit einer Ausgleichung gefühlt wird. Nicht nur den Neger sehen wir abwechselnd seinen Fetisch prügeln und anbeten; auch unsere Bildung wiederholt zuweilen, obwohl mit mehr Geschmack, dieselbe Wunderlichkeit. Auch wir pflegen für jene freie schöpferische Lebendigkeit zu schwärmen, die allem blinden Mechanismus entzogen, die Natur allgegenwärtig durchdringe, und doch umgibt uns in weit größerer Mannigfaltigkeit als jene frühen Zeiten, eine Welt künstlicher Vorrichtungen, deren leblose Teile, nur durch unsere Absicht untereinander verkettet, mit immer vollkommener zusammengreifender Beweglichkeit die Regsamkeit des Lebendigen nachahmen. Niemand rechnet diese Gebilde zur Natur; aber indem wir sie dieser als Erzeugnisse menschlicher Kunst gegenüberstellen, finden wir sie doch aus denselben Stoffen bereitet, mit denen die Natur wirkt, und sehen ihr Bestehen und ihre Leistungsfähigkeit auf denselben Kräften und Gesetzen beruhen, die in den freiwilligen Hervorbringungen der Natur tätig sind. Und diese freiwilligen Gebilde selbst, wie sehr hat die List des Menschen sie umgestaltet! Zahllose Mischungen der Stoffe, welche nie die Natur von selbst erzeugt, hat die Hand des Chemikers scheidend und verknüpfend hervorgebracht, und den mannigfachsten Bedürfnissen dienend, hat diese Flut technischer Erzeugnisse sich bis in die bescheidenste Häuslichkeit verbreitet. Künstlichen Befruchtungen und einer langen sorgsamen Pflege unterworfen, haben die Pflanzen Blüte und Frucht zu erhöhter Schönheit entwickeln müssen, und unsere Gärten füllt eine Flora, die so, wie sie uns entzückt, nirgends eine natürliche Heimat hat. Und selbst die Gestalt der Tiere erfährt den umbildenden Einfluss menschlicher Zucht; wohin wir uns wenden, begegnen wir nicht mehr den ursprünglichen Zügen der Natur, sondern sehen sie durch die berechnenden Eingriffe des Menschen überall in beständige Veränderung hineingezogen.
So entsteht und mehrt sich um uns her diese merkwürdige Zwischenwelt, die ihre Stoffe der Natur, ihre Form der menschlichen Willkür verdankend, einen steten stillen Einwurf gegen den Glauben an eine lebendige Schöpfung erhebt. Denn zu dem Hause, das wir bauten, zu dem Gerät, das wir schnitzten, zu der rastlos fortarbeitenden Maschine lag in den Stoffen, aus denen wir sie bildeten, keine lebendige Vorherbestimmung. Nur wenige einfache Eigenschaften und Wirkungsweisen kamen ihnen ursprünglich zu, nach allgemeinen Gesehen an genau bestimmte Bedingungen gebunden. Diese Kräfte hat unsere Technik durch die künstliche Zusammenstellung, die sie ihren Trägern gab, unter Umständen zu wirken genötigt, unter denen ihre Folgsamkeit gegen jene allgemeinen Gesetze unsere willkürlichen Zwecke verwirklichen musste. Ist dies nun so, und lassen unter unseren Händen die Elemente der Natur sich in dauerhafte Erzeugnisse verbinden und in Formen gießen, zu denen keine entwicklungsbegierige Neigung ihres Wesens sie trieb: warum sollte es in der Natur selbst anders sein? Auch in ihr vielleicht entstehen die bedeutungsvollen Gestalten der Geschöpfe nur durch den äußerlichen Zwang entweder einer göttlichen Kunst, oder eines zufälligen Weltlaufes, der die Elemente in haltbare Formen zusammenführt, und unterworfen, wie wir sie nun einmal kennen, unter die allgemeinen Gesetze des Stoffes, besitzen sie vielleicht eben so wenig ein Inneres, als die Erzeugnisse unserer Hände, von deren Selbstlosigkeit wir überzeugt sind.
Je vielseitiger und kräftiger sich die praktische Herrschaft der menschlichen Technik über die Schöpfung ausbreitet, umso bestimmter sehen wir auch diese Folgerung gezogen; die Naturauffassung, die mehr und mehr sich der Annahme einer inneren Selbstlosigkeit der Erscheinungen zuneigt, wiederholt damit nur einen Gedanken, an welchen die mannigfachste Erfahrung des täglichen Handelns gewöhnen musste. Aber es ist doch keineswegs unsere Zeit allein, die durch die Ausdehnung ihres Gewerbefleißes an das Vorhandensein blinder Notwendigkeit in den Naturwirkungen gemahnt wird; selbst den einfachsten Kulturstufen fehlten, wie wir erwähnten, ähnliche Erfahrungen nicht. Aber wie viel zu nahe diese Tatsachen auch liegen mochten, um unbemerkt zu bleiben: die mythologische Phantasie entschlug sich der Gedanken, welche sie erregen mussten. Sie zog sich früh von allen den Erscheinungen zurück, die wir entweder selbst künstlich erzeugen, oder deren Verhalten zu augenscheinlich von Maßbestimmungen äußerer Anlässe geregelt wird. Sie beschränkte ihre poetische Deutung auf Vorgänge, die entweder in wandelloser Regelmäßigkeit, wie die Bewegung der Gestirne, die Jahreszeiten und der Kreislauf des Pflanzenlebens, oder in unberechenbarer Unordnung, wie die launenhaften Veränderungen des Luftkreises, allen umgestaltenden Einflüssen unserer Willkür entzogen sind. In diesen Auszug einer auserwählten Natur vertiefte sich die Phantasie jener Geschlechter, in seiner Verherrlichung durch keine Erinnerung an die gemeine Wirklichkeit gestört, die täglich vor ihren Augen als ein Zeugnis für die blinde Notwendigkeit im Zusammenhange der Dinge dalag.
Aber selbst auf jenem beschränkteren Gebiet gelang es der mythologischen Dichtung dennoch nicht, die äußere sinnliche Erscheinung gänzlich zu vergeistigen. Denn in anderer Gestalt, als in der des menschlichen und des verwandten tierischen Lebens hat geistige Regsamkeit nicht jene überredende Anschaulichkeit für uns, die den vollen unbefangenen Glauben erzeugt. Mochten die Germanen die keimende Saatspike, indem sie den Boden durchbohrt, als ein lebendiges Wesen feiern, so hatte doch der mythische Ausdruck dieser zierlichen Naturbeobachtung kaum einen anderen Sinn als den eines Bildes, das im Stillen doch wieder von dem Bezeichneten unterschieden wird. Auch den Griechen konnte Demeter nicht das sprossende Grün, nicht die Seele der Feldfrucht selbst sein; sie war die menschlich gestaltete Göttin, die beschützend und fördernd sich um das Gedeihen eines Keimes bemüht, dessen Entwicklungskraft zuletzt doch nur in dem Dunkel seines eigenen Inneren lag. Jeder Fortschritt des Feldbaues musste die Kenntnis der Bedingungen erweitern, die diese Entwicklung begünstigen, und der gläubigen Verehrung blieb für die Göttin kaum etwas Anderes übrig, als der Ruhm der ersten unbegreiflichen Schöpfung eines Keimes, der, einmal entstanden, durch die Wechselfälle des Naturlaufs entfaltet wird. Mag die dichterische Sprache den Flussgott selbst dahin fließen lassen: immer zieht sich doch fühlbar die Phantasie auf die Vorstellung zurück, ihn in menschlicher Gestalt als die beherrschende Persönlichkeit zu fassen, der das flüssige Element zwar als nächstes Eigentum, aber doch stets als ein Fremdes und Anderes gegenübersteht. Nur ein Werkzeug in der Hand Jupiters sind die Blitze; die Winde werden eingefangen und entlassen von ihren göttlichen Gebietern: überall tritt die elementare Welt in den alten Gegensatz zu dem Reich der Geister zurück, ein gestaltbarer Stoff für ihre Herrschaft, aber nie selbst zu geistigem Leben aufblühend. Es mag eine poetischere Naturauffassung gewesen sein, für die nach den Worten des Dichters aus dem Schilf die Klage der Syrinx tönte, oder die Tochter des Tantalus in dem Stein schwieg; aber diese und wie viele ähnliche Sagen überzeugen uns doch nur, dass der Mythologie die eindringende und eigentümliche Belebung der Natur misslang. Denn nur dadurch wusste sie ja Stein und Schilf zu beseelen, dass sie beide als verwandeltes menschliches Leben fasste und es nun der Anstrengung der Phantasie überlief, die Erinnerung an dies verständliche vormalige Dasein in die spröde Unverständlichkeit der verwandelten Form zu verfolgen.
Die trügerische Farbenpracht des Herbstes, der jedes Blatt zur Blüte zu veredeln scheint, vergleicht ein reizendes Gedicht Rückerts mit der gediegenen Lebenskraft des Frühlings, der unter allem Blühen niemals den vollen, dunklen grünen Trieb verleugnet. Ein günstiges Misslingen bewahrte die Mythologie vor dem Missgeschick, die Natur in die haltlose Schönheit allgemeiner Lebendigkeit und Freiheit zu verklären; unüberwindlich trat der dunkle Trieb einer ursprünglichen unausdenkbaren Notwendigkeit wieder hervor. Cs half ihr nicht, dass sie seinen Anblick floh und dem Glanze der Götterwelt, ihrer gestaltenden Herrschaft über das Reich der Stoffe, sich zuwandte. Denn auch hier musste sie, um nur diese Herrschaft möglich zu finden, einen Kreis ewiger und allgemeiner Gesche bekennen, unter deren Zustimmung allein der Wille der Götter Macht gewann über die Zustände der Dinge. In der Verehrung eines unergründlichen Schicksals, das auch die Götter bindet, sprach sie diesen Gedanken in seiner Beziehung zu dem Gange der sittlichen Welt aus; minder ausdrücklich, aber doch erkennbar genug wiederholt ihn jede Schilderung des Wechselverkehrs zwischen den göttlichen Wesen und den Elementen der Natur. Nur der mühseligen Anstrengung des eigenen Handanlegens konnte die Poesie die Götter überheben, aber nie hat sie ganz die Vorstellung einer allgemeinen Ordnung der Dinge verdrängt, nach deren Gesetzen allein der lebendige Wille die Welt der Stoffe bewegt. Während Kronion den Blitz noch durch die Anstrengung seiner Hände schleudert, bewegt allerdings das Zucken seiner Augenbrauen mühelos die Liefen des Olymp; aber dies ergreifende zweite Bild der göttlichen Macht wiederholt doch nur verhüllter denselben Hergang einer mittelbaren Wirksamkeit, den jenes erste in anschaulicher Ausführlichkeit ausspricht. Selbst die mosaische Schöpfungsgeschichte, erhabener als andere, weil sie unmittelbar dastehen lässt, was der göttliche Wille befahl, ohne durch Schilderung physischer Vermittlungen den Eindruck der Allmacht zu schwächen: auch sie hält doch den schweigenden Gedanken noch nicht für den genügenden Anfang der Schöpfung. Sie lässt Gott wenigstens das Wort aussprechen, die zarteste allerdings, aber doch immer eine deutliche Vorbedingung, die hergestellt sein zu müssen schien, damit durch sie angeregt die ewige Notwendigkeit der Dinge das gebotene Werden vollbrächte.
So ist es also der Mythologie nicht gelungen, die vorhandene Welt völlig zu vergeistigen; nur eine zweite Welt hat sie hinzugedichtet, jene göttlichen Seelen, die um dies dunkle Reich der Dinge anschauend und umgestaltend ein seliges Leben führen. Sie sind es, die in ihrem eigenen Inneren jeden Zufall des wechselreichen blinden Naturlaufs zu Bewusstsein und Genuss verklären; aber den Fesseln einer ewigen Notwendigkeit vermögen auch sie sich nicht zu entziehen. Wo jetzt der seelenlose Feuerball sich dreht, da mochte damals in stiller Majestät Helios den goldenen Wagen lenken; aber das Rad dieses göttlichen Wagens vollendete seinen Umschwung nicht nach anderen Gesetzen, und nicht nach anderen übte und litt die Achse Druck, als nach welchen allezeit auf Erden sich die Räder jegliches Wagens um ihre belastete Achse drehen werden. Diesen Zwiespalt der Anfänge, die blinde Notwendigkeit eines Reiches der Sachen gegenüber der Götterwelt, deren lebendiger Glanz an diesem fremden und dunklen Grunde erscheint, hat die Mythologie nicht versöhnt; mit einer frischen Kraft der Phantasie hat sie nur hinweggesehen über das Eine, um dem Anderen gläubig anzuhängen. Einer anderen Richtung der Gedanken überließ sie den Versuch, auch jenen spröden Kern des Weltlaufs zu beleben.
Käme es hier darauf an, den geschichtlichen Hergang dieser Wandlungen der Ansichten zu schildern, so dürften wir allerdings nicht so sprechen. Eine weit ausgedehnte grübelnde Reflexion scheint vielmehr viel früher dem Gedanken eines allgemeinen Naturlebens nachgehangen und ihn bis in Formen des Daseins verfolgt zu haben, vor deren Fremdartigkeit sich später die Mythologie auf einen engeren Kreis anschaulicher Gestalten zurückzog; Gestalten, deren ideale Schönheit verständlich blieb, lange nachdem die Erinnerung an ihre ursprüngliche Bedeutung verloren war. Aber als ein völlig abgetaner Traum tritt für uns die mythologische Weltansicht in größere Ferne zurück; jene andere Auffassung dagegen, deren wir noch gedenken wollen, wie sie vielleicht die früheste Blüte des forschenden Geistes war, ist zu allen Zeiten lebendig geblieben, und gilt der Gegenwart nicht geringer als der Vorzeit.
Nachdem die wachsende Erfahrung den Glauben an anschauliche Göttergestalten zerstreut hatte, indem sie nie eine Anschauung derselben gewährte, konnte die Reflexion auf einem anderen Wege den Versuch erneuern, welcher der Mythologie misslungen war. Sie verlangte nun nicht mehr, die belebenden Naturgeister als gesonderte Wesen neben den toten Stoffen zu erblicken; vereinigen wollte sie vielmehr, was die Mythologie stets unter ihren Händen in zwei getrennte Welten wieder zerfallen sah: unmittelbar in sich selbst lebendig sollte der Körper der natürlichen Gebilde die seelenvolle Kraft seiner Entwicklung im eigenen Inneren besitzen. Aber als man so die lebendige Regsamkeit durch die Formen der organischen Geschöpfe bis in die formlosen Bestandteile der umgebenden Welt verfolgte, da musste, wie der Umriss der menschlichen Gestalt, so noch weiter auch das Bild menschlichen Seelenlebens unzureichend erscheinen zur Bezeichnung jener Lebendigkeit, die man suchte. Denn nur wenige Erzeugnisse der Natur stellen sich so als abgeschlossene Ganze dar, dass es leicht ist, sie als Wohnsitze persönlicher Seelen zu denken. Man mag auch anderen noch die Fähigkeit zugestehen, Eindrücke in sich aufzunehmen, aber die Abwesenheit jener Gliederung, an welche nach unserer Erfahrung die Möglichkeit sinnlicher Anschauungen, ihre Verbindung zu einer geordneten Weltauffassung und die Rückwirkung des Willens geknüpft ist, verhindert uns, in ihnen einen Reichtum des Seelenlebens zu vermuten, durch den sie auf gleichem Wege mit uns sich zum Selbstbewusstsein entwickeln könnten. Je mehr wir endlich von den zusammengesetzteren Gebilden zu den einfachen Elementen zurückgehen, umso mehr verschwindet der Schein einer unberechenbaren Freiheit des Handelns, umso deutlicher zeigt sich jede Natur an eine einförmige und unter ähnlichen Bedingungen stets ähnlich wiederkehrende Weise des Wirkens gebunden, ohne Anzeichen innerer Fortbildung, ohne jene Aufsammlung und Verarbeitung der Eindrücke, durch die jede einzelne Seele im Laufe ihres Lebens zu einer unvergleichbaren Eigentümlichkeit entwickelt wird. Durch solche Erfahrungen geleitet, spricht die neue Auffassung, die wir der mythologischen Weltansicht gegenüberstellen, nicht mehr von lebendigen Seelen, welche die Elemente treiben, sondern von lebendigen Trieben, welche sie beseelen. Aber indem sie so den Glauben an persönliche Naturgeister fallen lässt, büßt sie mehr ein, als sie zunächst durch ihren neuen Begriff des Triebes wieder ersetzt.
Denn vor Allem ist uns völlig klar doch nur das volle bewusste geistige Leben, das wir in uns selbst erfahren; klar auch der entgegengesetzte Gedanke einer gänzlich blinden Notwendigkeit, wenigstens in sofern, als wir nicht mehr den Anspruch machen, uns in dies völlige Gegenteil unseres eigenen Wesens hinein zu empfinden. Aber die Vorstellung ewig sich gleicher, in die Natur der Dinge eingeprägter Notwendigkeiten kann uns nur genügen, solange wir die Ereignisse des Naturlaufs nicht verstehen, sondern nur zur Befriedigung unserer Bedürfnisse berechnen und beherrschen wollen. Die Sehnsucht dagegen, sich in das Innere der Dinge zu versehen, kann sich nicht an ihr genügen lassen. In dem Namen der Triebe meinen wir daher dies mit auszusprechen, dass nicht ein fremder Zwang mit äußerlicher Notwendigkeit die Dinge zu ihren Wirkungen dränge; vielmehr wie dieser Zwang in ihrer eigenen Natur liegt, so soll er auch von ihnen als der ihrige gewusst, genossen, von ihnen gewollt und beständig von ihnen in sich selbst wieder erzeugt werden, oder auf welche Weise man sonst das Verlangen ausdrücken will, ihn als die eigene lebendige Natur der Dinge zu fassen. Anstatt der klaren Sonne des persönlichen Bewusstseins, das in den Gestalten der Mythologie glänzte, hat man daher stets wenigstens das Mondlicht einer unbewussten Vernunft in den Dingen wieder aufgehen lassen, damit das, was sie leisten, nicht nur für uns von ihnen auszugehen scheine, sondern in irgendeiner Weise auch für sie selbst vorhanden sei und von ihnen als ihr eigenes Leben gewollt und gefühlt werde.
Zwischen zwei klare Extreme, den Glauben an persönliche Naturgeister und den Gedanken einer blinden Naturnotwendigkeit, tritt so die Vorstellung von einer unbewussten Vernunft unklar in die Mitte. Aber eine entschiedene Hinneigung pflegt doch das menschliche Gemüt in den mannigfachsten Wendungen der Auffassung immer wieder zu dieser Vorstellung zurückzuführen, die also doch wohl einem tieferen Bedürfnis des Geistes entsprechen muss.
Und in der Tat schon im täglichen Leben wollen wir nicht jede geringfügige Handlung den erneuerten Einfluss des bewussten und abwägenden Willens verraten sehen. Es gilt uns als Aufgabe der Erziehung, dass alle jene Gebärden und Bewegungen, zu denen die gewöhnlichen Vorkommnisse des Lebens anregen, als unwillkürliche Äußerungen einer schönen Natur erscheinen, ohne den schwerfälligen Ernst der Absichtlichkeit, und darum auch ohne alle Erinnerung an die Möglichkeit ihres Andersseins. Und mit der äußern Anmut des Benehmens beruht auch der Reiz des geistigen Verkehrs auf derselben Voraussetzung. Nicht jedes Wort der Äußerung soll als Ergebnis eines absichtlich geleiteten Gedankenlaufs erscheinen; wir freuen uns vielmehr der Unmittelbarkeit, mit der aus den unbewussten Tiefen der Seele der Ausdruck ihres natürlichen Lebens unbewacht und ungeleitet hervorbricht. Auch die Mythologie verstand es nicht anders, wenn sie Erscheinungen der Natur aus geistigen Beweggründen deutete. Nicht jedem Sonnenaufgang geht ein erneuerter Entschluss des Gottes voran; der ursprüngliche Wille wirkt, wie in dämmernde Ferne zurücktretend, mit der unbewussten Macht einer anmutigen Gewohnheit fort. Dadurch eben gibt die Natur sich als Natur, dass sie unter dem Einfluss von Beweggründen sich zu regen scheint, deren Bewusstsein in ihr selbst verklungen ist, und deren Macht nur noch traumhaft als ein zurückgebliebener unwillkürlicher Zug empfunden wird.
So sind wir also keineswegs geneigt, überall in unserem Inneren die Macht einer sich selbst gestaltenden Freiheit geltend zu machen. Nur wo wir in sittlicher Selbstbeurteilung Wert oder Unwert einer Handlung auf uns zu nehmen haben, erscheinen wir uns als Geschöpfe unserer eigenen Willkür; aber überall, wo wir unbefangener auf die Beobachtung unseres Inneren zurückkommen, verleugnen wir die Gegenwart einer unbewusst wirkenden Natur in uns nicht, sondern heben mit Vorliebe ihre beständige stille Tätigkeit hervor. Kaum sind uns die Gründe klar, die uns in dieser Auffassung leiten. Ein gemischter Reiz des Selbstgefühls und der Demut scheint von der Wahrnehmung auszugehen, dass unser eigenes Innere eine Welt verbirgt, deren Gestalt wir nur unvollkommen ergründen, und deren Wirken, wo es in einzelnen Zügen zu unserm Bewusstsein kommt, uns mit Ahnungen von einer unbekannten Tiefe unseres eigenen Wesens überrascht. Mit jener seltsamen Einigungskraft für Widersprechendes, die unsere Anschauungen überall durchdringt, zählen wir dieses Dunkle in uns ebenso wohl zu unserer eigenen Persönlichkeit, die sich so für uns bis zu der Größe einer Welt erweitert, in der uns selbst noch Entdeckungen zu machen sind, und ebenso wohl erkennen wir es als Etwas, das in uns selbst doch nicht wir selbst ist. Dann treten wir befangen vor diesem Kern unseres eigenen Daseins zurück, in welchem wir nun jenes Unendliche zu sehen glauben, das in allen endlichen Erscheinungen die ewige Grundlage ihres Wesens bildet. Und diese beiden Gedanken durchdringen sich so in uns, dass keiner der Zweifel, die sich an sie knüpfen, den gleichzeitigen Genuss beider schmälert; die Unklarheit ihres gegenseitigen Verhältnisses erscheint uns nur wie der unmittelbare Ausdruck eines wirklichen Ineinanderseins, in welches Bewusstsein und Natur verfließen.
Und wie wir in unserm Inneren die Gegenwart eines mittätigen Unbewussten nicht leugnen, so stellen wir noch weniger nach außen unsere geistige Persönlichkeit in einen scharfen Gegensatz gegen ihr leibliches Dasein. Fast nur wo die Erscheinung des Todes Gedanken an die fernere Zukunft rege macht, denken wir daran, den Körper als die wieder abzubrechende Hülle zu betrachten, in die der Geist sich wohl einwohnt, ohne doch mit ihr zu verschmelzen. Aber das unbefangene Leben kennt diese Vorstellung sehr wenig, und selbst wo unser Nachdenken sie festhält, wird es uns doch nie gelingen, sie aus einer mittelbaren Überzeugung bis zur Klarheit eines unmittelbaren Lebensgefühls zu steigern. Immer wird Hand und Fuß, wenn unsere Absicht sie bewegt, immer das sehende Auge und die druckempfindende Oberfläche unseres Körpers uns als ein Teil unseres eigenen Wesens erscheinen und keineswegs als ein benachbartes Gebiet der Außenwelt, über welches die Herrschaft der Seele sich nur unmittelbarer als über entlegenere Teile derselben erstreckte. Überall begegnen wir vielmehr einem bestimmten Widerstreben des Gemüts, jene Vorstellung einer innigen Einheit zwischen Geist und Körper aufzugeben, die aus der Verkettung unserer Organisation unvermeidlich uns Allen als eine freundliche Täuschung entspringt. Denn erst dann scheint der Geist seine Bestimmung zu erfüllen, wenn er nicht eine fremde Masse von außen bezwingt, sondern in sie hinein sich tätig fortsetzt; dann erst scheint uns auch der Stoff eine volle Berechtigung seines Daseins zu besitzen, wenn er nicht allein als verwendbare Sache dem Geiste gegenübersteht, sondern von der Wärme desselben innerlich durchdrungen wird.
Diese leichten Bemerkungen machen nicht den Anspruch, die Verwicklung der Gedanken aufzulösen, die in solchen Meinungen einander gegenseitig drängen; nur an die Tatsache sollen sie erinnern, dass unvermeidlich in unserm Gemüte sich starke und schwer zu beseitigende Beweggründe ausbilden, die uns stets mit Vorliebe zu diesen doch schwierig aufzuklärenden Ansichten zurückführen. Es ist in der Tat der künstlerische Geist, das ästhetische Bedürfnis, das hier in uns mächtig wird. Wie wir in aller Schönheit eine unaussprechliche Einheit des Geistes und der Natur, der idealen Welt und ihrer realen Erscheinung suchen, so verlangen wir vor Allem die beseelte Gestalt auch von der Wissenschaft in dem Zauber ihrer Ganzheit anerkannt zu sehen, mit dem sie uns im Leben als die sichtliche Erfüllung jener Sehnsucht nach Einheit vorschwebt. Lieber als unverstandene Wirklichkeit wollen wir sie bewundern, als zugeben, dass das Verständnis sie auflöse. Auf diesem lebhaften Gefühl beruht das große Übergewicht, das für jedes ästhetisch angeregte Gemüt jederzeit die Vorstellungen von einer unbewussten Vernunft, von einer träumenden Weltseele, von lebendig wirkenden Trieben besitzen, die Alles durchdringend in einzelnen Gipfeln der Wirklichkeit sich zu vollem Bewusstsein entwickeln. Aber wie sehr wir dieses Gefühl teilen mögen, so werden wir doch fragen müssen, ob seine Befriedigung nicht durch andere Vorstellungsweisen gleich möglich ist. Denn indem wir uns auf die lebendige Erfahrung eines unbewussten geistigen Wirkens in uns selbst berufen, berufen wir uns auf das, was in unserm eigenen Wesen der aufklärenden Untersuchung eben am meisten bedarf. Und wenn wir die schwankenden Anschauungen, die uns diese Selbstbeobachtung gewährt, auf die Welt außer uns übertragen, so ist es in der Tat nur das Interesse für die Dunkelheit des Rätsels, aber nicht die größere Klarheit seiner Lösung, wodurch unsere Weltauffassung sich vor den widerlegten Träumen der Mythologie auszeichnen wird.
Und auch in einer anderen Rücksicht würden wir Mühe haben, von diesem Standpunkt aus einen Gewinn wieder zu erzeugen, welchen die mythologische Weltansicht von Anfang an besaß. Denn die große Befriedigung, mit der wir dieser stets von Neuem wieder in ihre Deutungen der Natur folgen, beruht großenteils darauf, dass sie die Erscheinungen auf Beweggründe zurückführt, deren Wert dem Gemüte unmittelbar verständlich ist. Wenn Helios Tag für Tag den Sonnenwagen über den Himmel führt, so ist es nicht die dumpfe Naturnotwendigkeit eines unbegreiflichen Instinktes, die ihn antreibt, sondern, damit er den Unsterblichen leuchte," wiederholt er das einförmige Tagwerk als seinen Beitrag zu der seligen Ordnung der Götterwelt. Und wie häufig sonst erscheinen in den Sagen der verschiedensten Völker die Bewegungen der Gestirne, ihr gegenseitiges Suchen und Fliehen, als Folgen von Taten und Schicksalen, aus denen für die Fortdauer dieses monotonen Spieles überall anmutige Beweggründe der Liebe, der Pflicht, der Sehnsucht oder Erinnerung entspringen! So gestaltet sich in Wahrheit die Natur zu dem Widerschein einer geistigen Welt; die äußerlichen Wirksamkeiten der Dinge haben nicht größeren Wert als die Gebärden des Lebendigen: nicht um ihrer selbst willen vorhanden, deuten sie vielmehr nur auf ein Inneres zurück, das in ihnen sich äußert, ohne in ihnen sich zu erschöpfen. Geben wir den Glauben an persönliche Naturgeister auf, so wird diese Anknüpfung der Natur an den Rückhalt einer geistigen Welt zunächst nur geschmälert. Mag immerhin auch jetzt noch das äußere Gebaren der Dinge aus einem traumhaften Trieb ihres Inneren entspringen, so leitet doch keine Analogie uns an, uns eine Vorstellung zu bilden von dem weitern Hintergrunde ihres Seelenlebens, aus dem dieser Traum und die einzelne Wirksamkeit, die er anregt, eben als einzelne zufällig angeregte Äußerung hervorgehen könnte. Ein einziger Trieb, unmittelbar auf eine begrenzte Art des Wirkens gerichtet, ist das ganze Innere der Dinge, ihr Ein und Alles geworden, und sie erscheinen gezwungen zur Ausübung einer Gebärde, ohne das Größere in sich zu erleben, als dessen Ausdruck allein diese gerechtfertigt wäre. Die gegenseitige Anziehung der Stoffe würde die Mythologie, ebenso wie sie die Wendung der Blume nach der Sonne erklärt, auf eine geistige Sehnsucht zurückgeführt, und diese Sehnsucht selbst aus der Geschichte vergangener Schicksale begründet haben. Die räumliche Bewegung würde ihr so als der augenblickliche Ausdruck eines mannigfachen und in seiner Mannigfaltigkeit verständlichen inneren Lebens erschienen sein, das, weil es mit dem Reichtum seines Inhalts weit über diese einzelne Äußerung hinausreicht, eben diese einzelne wahrhaft aus sich zu motivieren vermag. Ein Trieb der Anziehung dagegen, den wir in der Natur der Stoffe zu finden meinen, wiederholt uns eigentlich nur die unverstandene Tatsache der Bewegung und fügt anstatt des erklärenden Beweggrundes nur den Gedanken einer gleich unverständlichen Notwendigkeit hinzu, welche die Dinge nötige, sie auszuführen. In der Tat, so erscheinen uns die Naturereignisse nur wie die stummen Gestikulationen von Gestalten, deren Bilder sich gegen den Horizont abgrenzen, während ihre Worte uns die Entfernung verschlingt.
Das war es aber doch nicht, was jene Reflexion wollte; zu allen Zeiten finden wir sie daher bemüht, durch eine weitere Ausbildung ihrer Ansicht dieser Verkümmerung der Naturauffassung zu begegnen. Auf einen zusammenfassenden Weltgrund, eine unendliche Vernunft führte sie vor Allem die zersplitterte Vielheit der Erscheinungen zurück; in das Innere dieser träumenden und schaffenden Weltseele verlegte sie sinnvolle Urtriebe, die in unerschöpflicher Mannigfaltigkeit der Formen sich ausgestaltend, diese Wirklichkeit begründen. In einzelnen Geschöpfen zu vollem Selbstbewusstsein hindurchdringend, wird diese ewige Kraft doch auch in jenen Gebilden, in denen sie nur träumend und unbewusst sich regt, von denselben Beweggründen ihres Handelns geleitet, und jedes einzelne Erzeugnis der Natur drückt in anschaulicher Verkörperung einen jener Gedanken aus, in welche der lebendige Inhalt des Höchsten sich auseinanderlegt. Diese Gedanken, aus demselben Urgrunde entsprungen und in ihm zu dem Ganzen einer unerschöpflichen Idee zusammenstimmend, stiften zwischen den Dingen, deren beseelende Triebe sie sind, eine durchdringende Verknüpfung des Sinnes und der Wesensgemeinschaft. Und an dieser Gemeinschaft ihres Grundes und ihres Zieles, von welcher vielleicht eine dunkle Erinnerung ihnen geblieben ist, gewinnen die Dinge jenen tieferen Rückhalt ihres Wesens wieder, den wir vermissten. Die Äußerungen, denen das Einzelne nach der Notwendigkeit seines Triebes sich überlässt, geschehen nicht mehr um ihrer selbst willen; sie sind das, was jedem an seinem Orte als sein Beitrag zu der Verwirklichung des allgemeinen Sinnes der Welt zu leisten obliegt. Und wenn die Geschöpfe in veränderlicher Entwicklung eine Reihe von Zuständen durchlaufen, oder in wechselnden Formen auf äußere Anlässe zurückwirken, so sind sie auch dazu nicht durch eine zusammenhanglose Mehrheit vereinzelter Anstöße gezwungen. Aus der Einheit der Idee vielmehr, die ihr beseelender Trieb ist, entspringen wie mit der poetischen Notwendigkeit eines Gedichtes alle die mannigfaltigen Formen des Daseins und Benehmens, die wir an ihnen beobachten. So ist jedes Einzelne eine lebendige geschlossene Einheit, und hat doch jedes zugleich an dem großen Ganzen den erklärenden Hintergrund des besonderen Traumes, von dem es bewegt wird.
Um der Wahrheit willen, welche sie unstreitig einschließt, wird diese Auffassung ihren Eindruck auf das menschliche Gemüt nie verfehlen; aber vielfache Schwierigkeiten treten ihr doch entgegen, wenn sie ernstlich an die Deutung der Erscheinungen geht. Für jenen unendlich hohen Inhalt der Weltseele, dessen einzelne Ausstrahlungen die Geschöpfe der Natur sind, hat noch Niemand einen Ausdruck gefunden, der den angeregten Erwartungen genügen, oder uns für die verständliche Lebendigkeit entschädigen könnte, mit der die Mythologie die Natur erfüllt hatte. Denn alle jene Strebungen nach Entwicklung und Entfaltung, nach Vielheit in der Einheit und Einheit in der Vielheit, nach Gegensätzlichkeit und Versöhnung der Gegensätze, sie alle, durch die man das Innere der Weltseele zu bezeichnen suchte, können doch dem unbefangenen Gemüt nur als nichtige, kümmerliche Aufgaben erscheinen, kaum der spielenden Tätigkeit des kindlichen Geistes würdig, am wenigsten geeignet, die ernsten Schöpfungstriebe des Weltgrundes auszudrücken. Ginge in solchen Bestrebungen die Fülle seines Inhaltes auf, so könnten wir nicht leugnen, dass jeder zufällig herausgegriffene Augenblick aus dem Leben eines menschlichen Herzens unendlich seelenvoller sei als die Tiefe der Weltseele. Indessen würde die Unvollkommenheit unserer Versuche, diese Tiefe zu ermessen, nicht gegen die Wahrheit der Ansicht selbst beweisen; auch wenn jenes Höchste uns beständig nur in unaussprechbarer Ahnung vorschweben sollte, könnte es doch ein Gewinn sein, wenigstens durch Festhaltung dieser Ahnung die Lebendigkeit unserer Naturanschauung zu sichern. Aber eben gegen dies Ganze der Ansicht selbst erhebt sich der gleiche Widerspruch, den schon die Mythologie nicht bezwungen hatte. Denn auch diese neue Wendung des Gedankens, so ausdrücklich sie die ganze Natur zu umfassen verspricht, hat wirklich doch nur das organische Leben und einige jener großen Umrisse des Naturlaufes im Sinne, auf welche schon die mythologische Phantasie sich beschränkte; sie vernachlässigt, wie diese, die Fülle der kleinen gemeinen Wirklichkeit, die weniger poetisch, aber desto unabweisbarer sich rings um uns her ausbreitet. In der Regsamkeit des Tierkörpers, in dem Wachsen und Blühen der Pflanze und noch in der Kristallform des Festen oder in dem Umlauf der Gestirne mögen wir leicht einen Widerschein der Ideen finden, die wir in dem Inneren der Weltseele voraussetzen. Aber die Gesetze des Gleichgewichts und des Stoßes, des Hebels und der Schraube liegen weit ab von dem Entwickelungsgange des Unendlichen. Die freie landschaftliche Schönheit der Natur mag jene begeisterten Phantasien begünstigen; die häusliche Geschäftigkeit unserer Technik führt uns zu Betrachtungen anderer Art. Und die genaue Beobachtung des Lebendigen selbst schließt sich zuletzt den Einwürfen an, durch welche die Lehre von den schöpferischen seelenvollen Naturtrieben unvermeidlich einer andern Ansicht zu weichen genötigt wird, der letzten von denen, die im Großen die Geschichte der menschlichen Gedanken beherrscht haben.
Wenn jedes einzelne Gebilde der Natur sich völlig aus sich selbst entwickelte, ohne einer äußeren Welt zu bedürfen, oder für ihre Eingriffe zugänglich zu sein, dann wäre es möglich, die Vorstellung einer einzigen beseelenden Idee festzuhalten, die in ihm wirksam jede Einzelheit der künftigen Entfaltung mit vorbedenkender sinniger Konsequenz aus sich entliehe. So mag eine Melodie von Tönen, aus sich selbst sich fortspinnend und von keiner Welt des Widerstandes beengt, sich frei in das offene Blau ergießen. Aber alle jene wirklichen Gestalten, deren bedeutungsvolle Schönheit wir bewundern, stehen in unablässigem Wechselverkehr mit der gemeinsamen Außenwelt, die sie umfasst, und sie erwarten von ihr die mannigfaltigsten Antriebe ihrer Entwicklung. Nicht ohne Licht und Luft gedeiht die Pflanze, nicht ohne die verschiedenartigste Einwirkung des Äußeren das innere Leben der beseelten Geschöpfe. Aber keines von ihnen könnte von dieser Außenwelt leiden oder Vorteil ziehen, wäre nicht sein eigenes Wesen vergleichbar mit der Natur der Eindrücke, von denen es erregt werden soll. Denn nur das wirkt aufeinander, was innerhalb einer gemeinsamen Sphäre der Verwandtschaft gleich oder verschieden oder entgegengesetzt ist. Jeder Verkehr verlangt diese gegenseitige Ergreifbarkeit des Verkehrenden für einander und setzt notwendig das Dasein allgemeiner Gesetze voraus, die für alle Teile verbindlich, Größe und Form der Wirkung bestimmen, welche sie im Angriff austauschen sollen. Nun ist es der einzelnen bedeutsamen Erscheinung nicht mehr möglich, sich als eine unteilbar geschlossene, nur aus sich selbst verständliche Einheit zu benehmen; was sie leistet und wie sie sich entfaltet, das ist nicht mehr die unberechenbare Erfindung ihres eigenen Genius, sondern außer ihr ist darüber von Ewigkeit her entschieden, und jede Wirkung ist ihr durch die allgemeinen Gesche des Weltverkehrs und durch die besonderen Umstände zugemessen, unter denen sie von ihm erfasst wird.
Auch diese Ansicht meint das Ganze der Natur zu umschließen, und in der Tat betrachtet sie es von einem Gesichtspunkt aus, der ebenso bedeutungsvoll für die Auffassung der geistigen Welt ist. So lange wir die Wirklichkeit als ein ruhendes Bild ansehen, können wir wohl jede einzelne Gestalt dieses Gemäldes auf dem einen Triebe beruhend denken, durch den sie neben anderen aus dem schöpferischen Grunde hervorging; erkennen wir aber die Wirklichkeit für das was sie ist, für ein bewegtes Bild, dessen einzelne Teile nicht nur nebeneinander sind, sondern in beständiger Wechselwirkung ein rastloses Leben führen, so müssen wir auch aufmerksam auf die Bedingungen werden, an denen die Möglichkeit dieser Wirkung des einen auf das andere hängt. Was sich selbst genug ist, kann abgeschlossen auf der Einheit seines Lebenstriebes beruhen und aus ihm sich entwickeln; Alles dagegen, was Bedürfnisse hat und Bedingungen seiner Entwicklung, das wird in seinem Tun und Lassen sich den allgemeinen Gesetzen eines Welthaushaltes unterwerfen müssen, der allein ihm die Befriedigung seiner Bedürfnisse zuführen kann. Nicht seine ganze Entwickelung zwar wird ihm von außen nur angetan werden, sondern die Natur seines eigenen Wesens wird die Gestalt der Zustände mitbestimmen, die es unter dem Einfluss äußerer Bedingungen erfährt; aber auch diese Mitbestimmung selbst ist keine Tat seiner eigenwilligen Freiheit, sondern auch ihre Möglichkeit beruht auf dem Zusammenhange allgemeiner Gesetze, die es gestatten, dass ein solches Wesen auf solche, und ein anderes auf andere Weise gegen die Eindrücke des Äußeren zurückwirke.
Die nächste Anwendung dieser Vorstellungen galt jedoch der Natur, und in ihr den lebendigen Geschöpfen. Tiere und Pflanzen erzeugen weder aus sich selbst noch aus Nichts die Stoffe, durch deren Anlagerung ihre Gestalt wächst; sie entlehnen sie aus dem allgemeinen Vorrat der Natur. In beständigem Kreislauf überliefert die Erdrinde und das Luftmeer dem Pflanzenreich und dieses der Tierwelt jene unzerstörbaren Elemente, die bald dieser bald jener Form des Lebens dienen und zeitweise in das formlose Dasein unorganischer Körper zurücktreten, zu Allem benutzbar, aber aus eigenem Antrieb weder für die eine noch für die andere Form ihrer Verwendung begeistert. Diese Notwendigkeit, aus dem allgemeinen Vorrat zu schöpfen und die gesuchten Elemente erst aus schon bestehenden Verbindungen zu lösen, um sie zu dem eigenen Dienst zu zwingen, setzt dem freien Schwunge der Lebenskraft in jedem Geschöpf enge Grenzen. Gern vielleicht würde diese Kraft, den ganzen Lauf der künftigen Entwicklung vorbedenkend, mit einem Griff und aus der Einheit einer Absicht heraus die Entfaltung des Lebens lenken, ihrerseits geneigt, jene Gesche zu überspringen, welche der übrigen Welt gelten. Aber die unentbehrlichen Stoffe, deren sie bedarf, werden nicht die gleiche Neigung teilen; sie werden unerbittlich verlangen, nach denselben Gesetzen auch hier gerichtet zu werden, denen ihre Natur in allen anderen Fällen unterworfen ist. Niemals wird die Pflanze die Kohlensäure des Luftkreises zersetzen, ohne der chemischen Verwandtschaft, die deren Teile zusammenhält, eine andere in bestimmtem Maße überwiegende Verwandtschaft entgegengesetzt zu haben, und nie wird die Kohlensäure die trennende Kraft einer anderen Anziehung anerkennen als einer solchen, die an ein bestimmtes Maß einer körperlichen Masse gebunden ist. Und wo das gewonnene Material im Inneren des lebendigen Körpers in die Formen zu bringen ist, welche der Plan der Organisation verlangt, da wird es ebenso wenig freiwillig sich dieser Gestaltung fügen. Wie jede zu bewegende Last wird es vielmehr erwarten, durch bestimmte Größen bewegender Kräfte, von bestimmten Massen ausgeübt, seine Teilchen in die verlangte Lage geschoben zu sehen, nach denselben Gesetzen einer allgemeinen Mechanik, nach denen auch außerhalb des Lebendigen alle Bewegungen der Stoffe erfolgen.
Welcher lebendige Trieb daher auch das Innere der Geschöpfe beseelen mag: nicht ihm verdanken sie doch ihr Bestehen gegen die Angriffe des Äußern und die Verwirklichung ihrer beabsichtigten Leistungen; sie verdanken beides in jedem Augenblicke den ursprünglichen Kräften ihrer elementaren Teilchen, die in Berührung mit der Außenwelt tretend Reize aufzunehmen und auf sie wirksam zu antworten verstehen. Und welche sinnreiche Aufeinanderfolge die Lebenserscheinungen eines Geschöpfes zu dem Ganzen einer zusammenhängenden Entwicklung verknüpfen mag: auch sie wird ihm nur gewährt durch die ursprünglich vorhandene Anordnung seiner Teile, die dem Gesamterfolg der einzelnen Wirkungen bestimmte Gestalten gibt, so wie durch die fortschreitende Veränderung, die diese Teile selbst sich im Laufe ihrer Tätigkeit bereiten.
So lange die Naturforschung von der Einheit jenes lebendigen Triebes ausging und in ihm die hinreichende Erklärungsquelle für die veränderliche Entwicklung eines Geschöpfes suchte, ist sie wenig glücklich in der Aufhellung der Erscheinungen gewesen. Sie nahm den lebhaftesten Ausschwung, seitdem sie die Tätigkeit der kleinsten Teile ins Auge fasste, und von Punkt zu Punkt die einzelnen Wirkungen zusammensehend, die Entstehung des Ganzen aus der vereinigten Anstrengung unzähliger Elemente verfolgte. Noch ließ sie eine Zeit lang jenes Innere, die eine Lebenskraft jedes Geschöpfes, mit hergebrachter Verehrung in der Meinung der Menschen bestehen, und sie gab theoretisch zu, dass die Idee des Ganzen der Wirksamkeit der Teile vorhergehe, während sie praktisch sich längst darauf eingerichtet hatte, alle wirklich fruchtbringende Erklärung nur in dem Zusammenwirken der Teile zu suchen. Diese letzte Scheu hat die Gegenwart überwunden, und müde, ein Inneres zu verehren, das doch nie werktätig sich äußerte, hat sie die klare und bestimmte Auffassungsweise der mechanischen Naturwissenschaft ebenso zum Vorteil der Forschung wie unleugbar zur Beunruhigung des Gemütes über alle Gegenstände unserer Naturkenntnis ausgedehnt.
An die Stelle des lebendigen Tricbes, der als Ein Hauch das Ganze zusammengesetzter Bildungen beseelte, setzte sie die einfachen und unzerstörbaren Kräfte, welche den Elementen beständig anhaften. Mit veränderlicher Tätigkeit hatte der Trieb bald diese bald jene Wirkungsweise entfaltet, hier zurückhaltend mit seinem Vermögen, dort mit Anstrengung seine Äußerung beschleunigend; ausgleichend und ergänzend, wo es Not tat, war er nicht durch ein immer gleiches Gesetz seines Handelns eingeengt, sondern nur durch die Rücksicht auf das Endziel bestimmt, zu dem alle Einzelheiten der Entwicklung zusammenlaufen sollten, Mit unveränderlicher stets gleicher Wirkungsweise haftet dagegen die Kraft an den Elementen der Masse, in jedem Augenblicke Alles mit Notwendigkeit leistend, was nach allgemeinen Gesetzen die vorhandenen Umstände gebieten, und weder im Stande, von ihrer möglichen Wirkung etwas zurückzuhalten, noch zu ergänzen, was die Ungunst der Umstände ihr versagt. Von keinem Ziele geleitet, das vor ihr schwebte, sondern nur durch die Gewalt des Naturlaufes, der hinter ihr steht, vorwärts getrieben, strebt sie nicht von selbst der Verwirklichung eines Planes zu, sondern jede zusammenhängende Ordnung mannigfacher Wirkungen beruht auf den eigentümlichen Bedingungen, unter welchen zahlreiche Elemente durch die einmal vorhandene Form ihrer Verknüpfung zusammenzuwirken gezwungen sind.
Indem so die Naturwissenschaft die Einheit der belebenden Macht in die Zersplitterung unbestimmt vieler Elementarkräfte auflöst und von der Verbindungsweise dieser die endliche Gestalt der Geschöpfe begründet denkt, lässt sie die Frage nach dem Ursprunge dieser Anordnungen übrig, die so glücklich gewählt sich finden, dass das Schönste und Bedeutsamste der Natur sich als ihre notwendige Folge entwickeln muss. Nur darauf gerichtet, die Erhaltung der einmal bestehenden Welt zu erklären, darf sie in der Tat diese Frage aus dem engeren Gebiet ihrer Untersuchungen ausschließen. Ist sie zuweilen geneigt, den Ursprung dieser Ordnung einem Zufall zuzurechnen, für den besondere Gründe aufzusuchen unnötig sei, so ist es ihr doch eben so möglich, die erste Stiftung derselben von der Weisheit eines göttlichen Geistes abzuleiten. Aber allerdings wird sie, vielleicht mit Überschreitung ihrer Befugnis, behaupten, dass von der schöpferischen Freiheit dieses Geistes kein Hauch in das Geschaffene übergegangen ist, und dass die Natur, einmal vorhanden, sich wie jedes Kunsterzeugnis nach jenen unbeugsamen Gesehen forterhält, deren Unveränderlichkeit die Weisheit des Urhebers ebenso sehr wie die völlige Selbstlosigkeit des Geschöpfes bezeugt.
Und in diesem wunderbaren Automat der Natur, dessen rastloser Gang uns überall umgibt, welche Stellung nehmen wir selbst ein? Wir, die wir einst verwandte Göttergestalten hinter der Hülle der Erscheinungen zu erkennen glaubten; wir, in denen die allgemeine Vernunft der Weltseele wenigstens traumhaft sich großer Zwecke und eines ewigen Triebes bewusst wurde, der uns mit der Natur zu einem gemeinsamen großen Weltbau zusammenschließt? Mit den Ahnungen unseres Gemütes, mit den Forderungen unseres sittlichen Wesens, mit der ganzen Wärme unseres inneren Lebens fühlen wir uns fremd in diesem Reich der Sachen, das kein Inneres kennt. Doch vielleicht ist auch dieses Gefühl des Zwiespalts nur der Rest eines Irrtums, den wir abtun müssen.
Denn nicht allein die Ansichten der Natur haben im Laufe der Zeit die geschilderten Wandelungen erfahren; mit ihnen hat zugleich unsere Selbsterkenntnis neue Gestalten angenommen. Arglos konnte das Bewusstsein der jugendlichen Menschheit sich seiner Lebendigkeit erfreuen, die gleich der Pflanze Alles aus eigenem Keim hervortreibend und von keinem Gefühl fremden Zwanges bedrückt, auch das Bedürfnis einer Anerkennung ihrer Freiheit nicht empfand. Die fortschreitende Erfahrung und die allmählich sich erweiternden Übersichten des menschlichen Daseins zeigten auch die Entwicklung des geistigen Lebens an allgemeine, für Alle gültige Gesetze gebunden und dem eigenen Verdienst des Einzelnen mehr und mehr entzogen. Mit Beruhigung unterwarf sich das Gemüt dieser Notwendigkeit, so lange es in ihr die still zwingende Gewalt der einen ewigen Idee sah, in der wir leben und sind; es fühlte den Druck, als an die Stelle dieser auch hier die zerstreute Vielheit der bedingenden und gestaltenden Kräfte trat. Wie Vieles von dem, was wir zu der unantastbarsten Eigenheit unseres persönlichen Wesens zählten, zeigte sich als das Erzeugnis von Einflüssen, die sich an uns kreuzen, unterstützen und bekämpfen! Immer mehr schmolz die Fülle dessen zusammen, was wir an uns selbst unser wahres Eigentum nennen durften; einen Teil nahmen die körperlichen Werkzeuge als Geschenk ihrer Organisation in Anspruch, ein anderer fiel den allgemeinen Kräften des Seelenlebens zu, die verdienstlos in allen Einzelnen nach gleichen Gesetzen tätig sind; ein kleines Gebiet allein, das, welches die Freiheit unseres sittlichen Handelns beherrscht und gestaltet, schien den Zufluchtsort dessen zu bilden, was wir selbst sind. Auch diesem letzten Punkte wahrhafter Innerlichkeit ließ die Wissenschaft, als einem möglichen Gegenstande des Glaubens; ein zweifelhaftes Bestehen; auch ihn scheint sie im Begriff völlig aufzugeben. Nachdem wir wissen, dass der allgemeine Haushalt der Welt eine gewisse jährliche Summe der Verbrechen ebenso zu erfordern scheint, wie eine gewisse Größe der Temperatur: seitdem liegt es nahe, auch in dem geistigen Leben den ununterbrochenen Zusammenhang eines blinden Mechanismus zu sehen. Gleich dem beständigen Wechsel des Äußeren wird auch unsere innere Regsamkeit nur noch ein Wirbel von Bewegungen sein, den die ungezählten Atome unseres Nervengebäudes durch unablässige Wechselwirkung unterhalten. Weit über die unbefangene Kindlichkeit mythologischer Weltauffassung sind wir hinausgekommen; wir haben nicht allein die persönlichen Naturgeister aufgegeben, sondern die Möglichkeit eines persönlichen Daseins überhaupt zu dem dunkelsten Rätsel gemacht. Eingeschlossen in das große Automat der Natur steht das kleinere des menschlichen Geistes; künstlicher als jedes andere, da es seine eigenen Regungen fühlt und die des anderen Spielzeugs bewundert; aber zuletzt zerführen seine Bestandteile doch auch, und der Ernst und der Scherz, die Liebe und der Hass, die dieses seltsame Wesen bewegten, wären dahin.
Auch diese letzten Konsequenzen sind gezogen worden, hier mit Jubel, dort mit verzweifelndem Gemüt. Aber auch sie sind nicht allgemein gezogen worden; an den verschiedensten Punkten des Weges zu ihnen haben Unzählige angehalten und nach verschiedenen Richtungen hin dem unerwünschten Ziele zu entgehen versucht. Und durch alle Umwandelungen der Ansichten hindurch hat doch auch ein einfacherer Glaube sich ungestört erhalten, der Glaube an einen ewigen Urheber, der dem Reich der Geister lebendige Freiheit zum Streben nach einem heiligen Ziele verlieh und sie dem Reiche der Sachen versagte, damit es in blinder Notwendigkeit Schauplatz und Mittel für die Tätigkeit des Strebenden sei. Mit dieser klaren Teilung gewann das Gemüt die Möglichkeit, in dem Kreise der Dinge sich einzurichten, bauend auf ihre unwandelbare Gesetzlichkeit und seine eigene Freiheit. Aber zu erringen, würde ihm noch die andere Möglichkeit bleiben, die zahlreichen Fragen über die gegenseitige Begrenzung der beiden Gebiete des Freien und des Notwendigen zu beantworten, zu denen die aufmerksame Beobachtung der Einzelheiten des Naturlaufes anregt.
Von solchen Rätseln fühlen wir uns umstrickt; nicht als ob sie nicht zu jeder Zeit vorhanden gewesen und empfunden worden wären; aber mehr als je hat sie jetzt die wachsende Verbreitung der Naturkenntnis in den Vordergrund unserer Betrachtungen gerückt. Zu lange hat ohne Zweifel der menschliche Geist in der Ausbildung seiner Weltansicht jenes dunkle, starre Element der Notwendigkeit, das Reich der Sachen, übersehen; mit steigender Macht ist es im