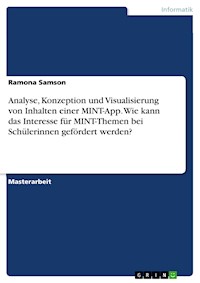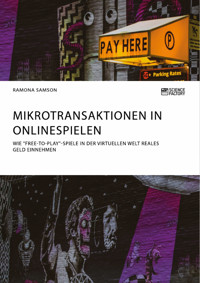
Mikrotransaktionen in Onlinespielen. Wie "Free-to-Play"-Spiele in der virtuellen Welt reales Geld einnehmen E-Book
Ramona Samson
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Free-to-Play" – dieses Angebot für Onlinespiele erlaubt Nutzern einen einfachen und kostenlosen Einstieg in die virtuelle Spielewelt. Auch wenn es so überflüssig geworden ist, ein Spiel vor Spielbeginn zu kaufen, wurde der Handel "Geld gegen Spielfreude" dennoch nicht ganz abgeschafft. Er wurde einfach ins Spiel selbst verlegt, indem Nutzer die Möglichkeit bekommen, durch Mikrotransaktionen während eines Spiels zusätzliche Inhalte zu kaufen. Ramona Samson untersucht dieses Erlösmodell und geht der Frage nach, welche Methoden die Hersteller anwenden, um höhere Umsätze zu generieren und welche Motivationsfaktoren die Spieler zum Kauf virtueller Items anregen. Aus dem Inhalt: - Free-to-Play-Spiele; - Onlinespiele; - Mikrotransaktionen; - Massively Multiplayer Online Games; - Flow-Prinzip
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Onlinespiele: Begriffsdefinition und Entwicklung
2.1 Virtuelle Welt und MMOGs
2.2 Virtuelle Items und Währungen
2.3 Free-to-Play und Mikrotransaktionen
2.4 Spieleralter und psychologische Entwicklung
3 Motivationsfaktoren
3.1 Verkaufsstrategien
3.2 Selbstverwirklichung, Peer- und Community-Effekt
3.3 Das Flow-Prinzip und der magische Kreis
4 Risiken
4.1 Risiken für das Spielerlebnis
4.2 Risiken für den Spielbegriff
4.3 Risiken für die Spieler - Glücksspielinhalte in Onlinespielen
5 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Onlinespiele erfreuen sich bedingt durch das steigende und vielfältige Spielangebot im Internet einer immer größeren Beliebtheit unter den Spielern. Wie aus den Daten des BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V.) hervorgeht, wurden für das Jahr 2014 allein in Deutschland 17,4 Millionen Nutzer digitaler Spiele verzeichnet, im Jahr 2013 sollen es 16,3 Millionen Spieler gewesen sein. Zu bemerken ist die annähernd gleichmäßige Verteilung der Nutzenden über die Altersspanne von 10 bis 50 Jahren bei einem Durchschnittsalter von 34,5 Jahren.[1] Laut den Veröffentlichungen des BIU gibt es 40% weibliche und 60% männliche Onlinespieler.[2] Hieraus wird ersichtlich, dass Onlinespiele für eine heterogene Gruppe von Spielern interessant sind.
Die sogenannten Free-to-Play-Spiele leisten hierbei einen wichtigen Beitrag für die steigende Attraktivität der Onlinespiele, da sie den Spielern einen kostenlosen Zugang zum Spiel bieten. Dabei besteht für die Spieler die Möglichkeit, zusätzliche Inhalte für das Spiel zu kaufen. Die Entscheidung zu solchen Käufen ist den Spielern jedoch freigestellt. Dieses Erlösmodell hört sich zunächst nach einer risikoreichen Einnahmequelle an, generiert allerdings einen hohen Umsatz, welches später noch genauer erläutert wird. Daraus leiten sich vorerst die Fragen ab, welche Umstände zur Entwicklung dieses Erlösmodell führten und welche Methoden die Hersteller anwenden, um höhere Umsätze zu generieren? Im Hinblick auf den Erfolg dieses Modells kann zudem eine zweite Frage nach den Motivationsfaktoren der Spieler formuliert werden: Was motiviert die Spieler dazu, diese weder physisch existenten, noch knappen Güter mit realem Geld zu erwerben?
Auf der Gegenseite treten Free-to-Play-Spiele wegen dieser kostenpflichtigen Zusatzleistungen, unter Bezugnahme auf Jugendschutzbedingungen und exzessivem Spielverhalten, in den Medien häufig negativ in Erscheinung. Den Herstellern der kostenlosen Spiele wird vorgeworfen, dass sie die Spieler nicht ausreichend über
das Erlöskonzept informieren würden und so einige Spieler im Endeffekt mehr Geld zahlen, als mit einer festgelegten Nutzungsgebühr.[3] Die Gefahr für junge Spieler in Bezug auf Internetsucht und Realitätsflucht in Onlinespielen wurde schon häufig thematisiert und wird mit den Free-to-Play-Spielen wieder in das Licht gerückt. Dabei führen die kontroversen Haltungen von Kritikern gegenüber des mittlerweile auf dem Markt etablierten Free-to-Play-Konzepts zu einem Dilemma: Das Spielkonzept und die damit einhergehende kostenlose Zugänglichkeit kann nur garantiert werden, wenn Spieler für die zusätzlichen Inhalte im Spiel zahlen.
Während eines Auslandssemesters in Portugal besuchte ich ein Seminar zu den neuen Medien, in welchem die virtuelle Welt der Onlinespiele und die verschiedenen Erlösmodelle behandelt wurden. Daraufhin entschied ich mich dazu, meine Bachelorarbeit in diesem Themengebiet anzusiedeln, da die Finanzierungsmodelle der Onlinespiele und damit auch die Auswirkungen auf den Spieler, einem stetigen Wandel unterworfen sind. Diese Bachelorarbeit wird sich schließlich mit der Frage beschäftigen, inwiefern Mikrotransaktionen ein potentielles Risiko für das Spielerlebnis, den Spielbegriff und die Spieler darstellen können?
Hierzu soll zunächst ein Überblick über die Begriffsdefinition von Onlinespielen, deren Entstehung und ihrer Klassifizierung gegeben werden. Daraufhin werden die Besonderheiten der Massively Multiplayer Online Games (MMOGs) wie ihrer virtuellen Umgebung dargestellt und anhand des Onlinespiels League of Legends
2 Onlinespiele: Begriffsdefinition und Entwicklung
Hinsichtlich der begrifflichen Beziehung von Onlinespielen zum Internet oder Spiel weisen viele Definitionen Ungenauigkeiten auf, da es keine einheitliche Begriffserklärung gibt. Trotzdem soll ein Definitionsversuch unternommen werden, indem der ursprüngliche Spielbegriff zunächst behandelt wird, um ein Verständnis für Onlinespiele zu entwickeln und die durch das Onlinespiel verursachten Veränderungen zu erfassen. So definiert der Kulturhistoriker Huizinga in seinem Werk „Homo Ludens“ das Spielkonzept wie folgt:
„[P]lay is a voluntary activity or occupation executed within certain fixed limits of time and place, according to rules freely accepted but absolutely binding, having its aim in itself and accompanied by a feeling of tension, joy and the consciousness that it is ‘different’ from ‘ordinary life’.”[4]
Der Autor Aufenanger hebt in Anlehnung an Huizinga einen weiteren Punkt zur Kennzeichnung von Spiel hervor: „Spielen ist von Arbeiten unterschieden. Es verfolgt keinen Zweck, jedenfalls keinen Zweck außerhalb des Spielens. Mit dem Spielen möchte ich nichts erreichen.“[5] Die wichtigsten Aspekte für die Definition des Spielbegriffs seien nach Aufenanger: Freiheit, Regel und Regellosigkeit, Unendlichkeit und Geschlossenheit, Fiktion und Realität.[6] Hier lassen sich Widersprüche erkennen, die mit dem Onlinespiel noch deutlicher werden und im vierten Kapitel weiter behandelt werden sollen.
Im engeren Sinne bezeichnet der Begriff Onlinespiel eine breite Masse an digitalen Spielen, „die mit Hilfe des oder über das Internet spielbar sind.“[7] Onlinespiele sind mit Hilfe des Internets zugänglich, wenn sie einen virtuellen Raum beschreiben, welcher von Dreyer, Lampert und Schmidt als „Spielort“ bezeichnet wird, den „die Spielteilnehmer (technisch vermittelt) einzeln oder gemeinsam aufsuchen, um sich zu messen.“[8] Dagegen werden Onlinespiele über das Internet gespielt, wenn das Internet als Kanal dient, um „spielrelevante Botschaften, Züge, Handlungen auszutauschen.“[9] Im weiteren Sinne können beispielsweise die Spiele, die aus dem Internet heruntergeladen werden, für die Spielnutzung jedoch keinen Internetzugang benötigen, ebenso als Onlinespiele bezeichnet werden.[10] Der Zutritt zu den Onlinespielen kann über den Computer, aber auch mit anderen technischen Hilfsmitteln wie Konsolen, Smartphones oder Tablets erfolgen.[11] Im Folgenden soll nur auf Onlinespiele eingegangen werden, welche unter die engere Definition fallen und über den Computer zugänglich sind, da sie häufig eine komplexere Spielwelt darstellen.
Die ersten Onlinespiele wurden in den 1970er Jahren entwickelt und konnten über das Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) gespielt werden. Im Jahr 1993 wurde das erste kommerziell erfolgreiche Onlinespiel Doom veröffentlicht, welches ebenfalls zum ersten Mal die Vernetzung zwischen Onlinespielern in einem Computerspiel ermöglichte.[12] Die Onlinespiele ergänzten oder ersetzten in einigen Fällen das traditionelle Geschäftsmodell der Computerspielindustrie, bei dem die Spiele mit CD-ROM Produkten verkauft wurden.[13] Darüber hinaus trugen die weitflächige Verbreitung von Internetzugängen und das aufkommende Angebot an Onlinespielen dazu bei, dass sich Onlinespiele in der Computerspielindustrie etablieren konnten.[14]
Onlinespiele werden häufig im Hinblick auf gewaltsame Inhalte oder Suchtpotenzial kontrovers diskutiert. Zeitgleich gibt es Institutionen, die prüfen, „ob und in welcher Form Onlinespiele als ‚seriousgames‘ bzw. ‚educationalgames‘ dazu beitragen können, Wissen über komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln.“[15] Dass Onlinespiele sehr heterogene Einsatzmöglichkeiten haben, zeigt sich an den verschiedenartigen Genres wie Action, Jump-and-Run, Rollenspielen und vielen mehr. Für die Onlinespiele konnten sich verschiedene Erlösmodelle wie Abonnement, Pay-to-Play oder Free-to-Play etablieren, welche im dritten Kapitel weiter differenziert werden sollen. Onlinespiele lassen sich nach Jöckel und Schumann in drei Kategorien einteilen: Den traditionellen Computer- und Videospielen mit Online-Modus, den clientbasierten und den browserbasierten Onlinespielen. Die Computer-und Videospiele können mit dem Online-Modus nicht nur offline, sondern auch wie andere Onlinespiele über das Internet genutzt werden. Ihre Spielmodi reichen von kompetitiv (wettkampforientiert) zu kooperativ (gemeinschaftsorientiert).
Die zweite Kategorie bilden die Massively Multiplayer Online Games (MMOGs), welche zwar eine Software auf dem Computer benötigen, also clientbasiert arbeiten, allerdings ausschließlich über das Internet gespielt werden. Die kompetitiven und kooperativen Spielmodi in MMOGs ermöglichen mehreren tausend Spielern gleichzeitig am Spiel teilzunehmen.