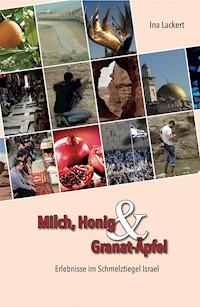
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lichtzeichen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Granatäpfel, köstlich und nahrhaft, heißen auf Hebräisch Rimonim. Dasselbe Wort verwenden Israelis auch, wenn von Handgranaten die Rede ist. Die deutsche Übersetzung könnte also passender nicht sein. Es ist, als hätte der Granatapfel zwei untrennbar miteinander verknüpfte Seiten: „Apfel“ auf der einen, „Granate“ auf der anderen – Leben und Tod vereint im selben Begriff. Oft habe ich miterlebt, wie plötzlich und unerwartet etwas Schönes in etwas Tragisches zersplittert. Ich durfte aber auch staunen, welch unerwartete Schönheit, ja welch ein Segen aus einer tragischen Situation hervorgehen kann. In Israel liegen Freude und Trauer, Jubel und Verzweiflung, Tod und Leben nah beieinander. Wie nah, das habe ich manchmal kaum fassen können. Dieses Buch lädt ein, in den Jahren meines Dienstes in Israel zu stöbern und dem Herzschlag der Menschen dort auf die Spur zu kommen. Es ist die Annäherung an ein Israel, das mehr ist, als politisch unlösbar, theologisch kontrovers oder in aktuellen Berichterstattungen schwer nachvollziehbar. Vor allem aber ist dieses Buch eine Einladung, zwischen den Zeilen zu lesen und die eigene Entdeckungsreise anzutreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ina Lackert
Milch, Honig und Granat-Äpfel
Erlebnisse im Schmelztiegel Israel
Ina Lackert
Milch, Honig und Granat-Äpfel
Erlebnisse im Schmelztiegel Israel
1.Auflage 2016
© Lichtzeichen Verlag GmbH, Lage
Lektorat: Esther Keith, Dr.Harald Goebel
Korrektur: Vera Lotz
Coverfotos: Ina Lackert, Daniel Kirchhevel
Autorenfoto: S.Hauptmann
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-86954-827-2
Bestell-Nr.: 548827
ISBN Printausgabe: 978-3-86954-260-7
Danksagung
Freunde sind ein kostbarer Schatz! Eure Begleitung hat meine Jahre in Israel ermöglicht. Ihr inspiriert mich auf Eure ganz persönliche Art. Wo auch immer Ihr jetzt seid – Danke für die Spuren in meinem Herzen!
Gertraud & Rainer – Euer Impuls war der Startschuss zu diesem Buch.
Esther, Harald, Vera – Danke für die vielen Stunden, die Ihr investiert habt, um den Rohdiamanten zu schleifen und zu polieren. Schaut, wie er glänzt!
Friedrich & Brigitte, Adam & Regina – Ihr seid ein Segen, der sich nicht in Worte fassen lässt.
Über allem: soli Deo gloria!
Inhalt
Prolog
Kapitel 1 – 2000: Alles wird anders. Ganz anders!
Kapitel 2 – 2001: Erschütternd neue Realitäten
Kapitel 3 – 2002: Oh Gott! Bewahre!
Kapitel 4 – 2003: Von Puzzleteilen und Bruchstücken
Kapitel 5 – 2004: Grenzüberschreitungen
Kapitel 6 – 2005: Setzlinge und Entwurzelungen
Kapitel 7 – 2006: Wettervorhersage: Raketenhagel
Kapitel 8 – 2007: Trauen und Vertrauen
Kapitel 9 – 2008: Wenn Sekunden entscheidend sind
Kapitel 10 – 2009: Horizonterweiterungen
Kapitel 11 – 2010: Held oder Heuschrecke?
Kapitel 12 – 2011: 18 heißt: Lebe!
Kapitel 13 – 2012: Abschied
Epilog
Quellennachweis
Prolog
Es gibt eine treffende Lebensweisheit von Søren Kierkegaard: Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden.1 Dieses Buch ist beides – Rückblick und Ausblick. Alles, was wir erleben, prägt und verändert uns, manchmal deutlich spürbar und offensichtlich, manchmal kaum merklich. Das Leben ist eine Reise. Eine Reise im klassischen Sinn hier auf der Erde, also Fortbewegung und Neuentdeckung, aber auch eine Reise durch unser eigenes Ich, das wir unterwegs immer besser kennenlernen – jedenfalls dann, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Eine Reise, die die Lebenswege anderer kreuzt. Diese Begegnungen hinterlassen Spuren, sowohl bei uns als auch bei anderen, und manche dieser Spuren bleiben unvergesslich.
Der Reiseabschnitt, von dem dieses Buch erzählt, beginnt im Frühling des Jahres 2000. Ein neues Millennium hat begonnen. Y2K, der weltweit angekündigte, breitflächige Kollaps von Technologie und Computersystemen zur Jahrtausendwende, hat sich als Nicht-Ereignis entpuppt. Der Alltagstrott hat die Menschheit wieder – auch diejenigen, die sich durch so manches Apokalypsen-Szenario aus dem Tritt haben bringen lassen. Wir schreiben ein neues Jahrtausend und für mich beginnt ein vollständig neuer Lebensabschnitt. Ich werde die Sicherheit und Bodenständigkeit, die wir Deutschen so lieben, hinter mir lassen und in ein fernes Land ziehen. Fern? Das kommt auf den Blickwinkel an. Ich werde mich auf den Weg in den Nahen Osten, genauer gesagt nach Israel, machen. Zwischen Deutschland und Israel liegen tatsächlich ein paar Tausend Kilometer, doch in mancherlei Hinsicht stehen sich beide Länder viel näher als man denken mag. Die Schicksale beider Nationen und ihrer Menschen sind miteinander verwoben. Auf beiden Seiten brauchen viele Familien nur wenige Generationen zurückzuschauen, um diese Berührungspunkte zu finden. So auch ich.
Ausgangspunkt Braunschweig
Geboren und aufgewachsen in Braunschweig, Tochter von Eltern, die es als Jugendliche nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs und der nachfolgenden Teilung Deutschlands dorthin verschlug; die sich als Erwachsene begegneten, heirateten und dann irgendwann mich in den Armen hielten. Wie jeder Mensch machte ich meine eigenen Wirren durch; suchte mich, fand mich, fand das Leben. Ein Leben, das ich möglichst Sinn-voll und Sinn-stiftend leben möchte.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich bereits als Jugendliche erstaunt war, wie oft in den Nachrichten aus oder über Israel berichtet wurde. Als hinge das Heil der ganzen Welt vom Geschehen in jenem Land ab (was es in gewisser Weise auch tut). Oft genug, eigentlich fast ausschließlich, ging es um kriegsähnliche Auseinandersetzungen, Sprengstoffattentate, Steine-Werfen und Molotow-Cocktails. Verstehen konnte ich diese Auseinandersetzungen, die so weit weg geschahen, kaum oder gar nicht, dennoch gingen sie mir nach. Im Geschichtsunterricht lernte ich natürlich auch vieles über den Zweiten Weltkrieg. Wie jeder Schüler sah ich Bilder von Leichenbergen und von ausgemergelten, fast verhungerten Menschen in Konzentrationslagern mit tieftraurigen Augen. Augen, die still um Hilfe schreien und in denen doch noch ein Funken Hoffnung, klein wie ein Staubkorn, zu finden ist, wenn man sich die Zeit nimmt, genau hinzuschauen, und den Mut aufbringt, dem schmerzend-kläglichen Blick standzuhalten. Diese Bilder haben mich immer tief berührt und alles in mir schrie „Unrecht“. Unfassbares Leid, Trauma, Horror, und das millionenfach, auf der einen Seite – und auf der anderen? Eine wie geschmiert laufende, industrialisierte Tötungsmaschinerie „Made in Germany“, inszeniert von einem Psychopathen, umgesetzt von seinen wie Marionetten funktionierenden „Organen“, die entweder feige und willenlos oder von Machthunger und Geltungssucht getrieben agierten, und eine breite Masse, die vorgab, von all dem Unrecht, das vor ihren Augen geschah, nichts mitbekommen zu haben.
Wie konnte so etwas passieren?
Dem Bösen etwas entgegensetzen
Irgendwann begriff ich, dass die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen war, diesem unbeschreiblichen Unheil Tür und Tor geöffnet hatte. In Braunschweig wurde Hitler zu einem deutschen Staatsbürger gemacht – Grundvoraussetzung für die Aufstellung zur Wahl zum Reichskanzler. Und dann wurde mir klar, dass ich, klein und unscheinbar wie ich auch sein mag, diesem schrecklichen, nicht wiedergutzumachenden Tiefpunkt der Geschichte etwas Positives, Heilendes, Versöhnendes entgegensetzen möchte.
Ein Jahr Freiwilligendienst in Israel, das war mein Plan. Ich wollte ein Jahr meines Lebens meine eigenen Wünsche und Ziele zurückstellen und diejenigen in den Mittelpunkt stellen, denen meine Stadt (durch die einst gewährte Gefälligkeit) und mein Land so ziemlich alles genommen hatte: ihre Habseligkeiten, ihre Würde, ihre Träume, ihre Gesundheit, ihr Leben. Freund sein – ein richtig echter, verlässlicher Freund, in guten wie in schlechten Zeiten – das wollte ich. Und das durfte ich werden!
Heute blicke ich auf zwölf Jahre Freiwilligendienst in Israel zurück. WOW – Wunder, oh Wunder! Wenn mir das jemand im Frühjahr 2000 gesagt hätte, hätte ich ihn für übergeschnappt gehalten. Oft genug in diesen zwölf Jahren habe ich vor Staunen inne gehalten und konnte es kaum fassen, dass ich bereits einen so langen Zeitraum in Israel lebe. Während dieser Jahre arbeitete ich mit einer internationalen christlichen humanitären Organisation, Bridges for Peace (BFP), die sich zum Ziel gesetzt hat, Wege der Versöhnung zwischen Christen und Juden sowohl zu suchen als auch zu gehen. Etwas, das mir aus dem Herzen sprach und von dem ich spürte, dass es ein passender Ansatzpunkt für mich war.
Doch unser Leben besteht nicht nur aus Arbeit, jedenfalls sollte das nicht so sein. Und so wusste ich, dass mir jeder Tag neben der Arbeit noch weitere Möglichkeiten bieten würde, Menschen zu begegnen, worauf ich mich vielleicht noch mehr freute. In dieses Jahr, das ich im Sinn hatte, wollte ich möglichst viel hineinpacken und alles mitnehmen, was sich mir anbot. Manches kam anders und in vielerlei Hinsicht war es abenteuerlich, manchmal aber auch alles andere als leicht.
Heute lebe ich wieder in Deutschland und bin nicht mehr die Person, die im Jahr 2000 nach Israel gegangen ist. Ich schaue auf meine mannigfaltige Entdeckungsreise zurück wie auf ein Puzzle, das sich zusammengefügt hat und ein harmonisches Bild ergibt. Und ich schaue nach vorne auf einen neuen Lebensabschnitt, für den ich aus dieser Entdeckungsreise einige Puzzleteile mitgebracht habe, für die ich nun den ihnen angemessenen Platz suche. Leben eben. Live und in Farbe. Spannend und einzigartig. Wunder-schön!
Grundlage für dieses Buch ist eine Kollektion von Briefen, die ich in den zwölf Jahren an mein deutschsprachiges Netzwerk verschickt habe. Es soll eine Art Entdeckungsreise durch Land und Leute darstellen. Eine Reise, die Fragen aufwerfen und zum Nachdenken anregen soll. Eine Reise durch mein eigenes Leben, durch meine Gedanken, meine Fragen, mein Suchen, mein Tun, mein Erleben, authentisch und ehrlich.
Noch ein Wort zum Titel dieses Buches: Wenn man sich mit Israel beschäftigt, begegnet einem früher oder später die Bezeichnung „das Land, in dem Milch und Honig fließen“. Ich habe mich oft gefragt, wieso. Viele Reportagen zeichnen eher ein Bild, das von Auseinandersetzung, Anfeindung, Waffengewalt und Terror geprägt ist; Milch und Honig sind da kaum zu entdecken. So hatte auch ich Israel viele Jahre lang wahrgenommen – als eine konfliktdurchsetzte Region, in der es stets brodelt und immer mal wieder überkocht. Während meiner Jahre in Israel durfte ich jedoch auch diese vielzitierten Attribute, also die Milch und den Honig, wahrnehmen und kosten. Israel ist ein Land, das nicht nur facetten- und abwechslungsreich ist, sondern auch ein Land, das nährt, stärkt und mit seiner Süße überrascht. Milch und Honig sind also markante, symbolische Begriffe für Israel, denen ich, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, einen weiteren hinzufügen möchte: Das Land von Milch, Honig und Granat-Äpfeln.
Granatäpfel? Wieso das? Wir kennen diese Frucht saisonbedingt aus dem Supermarkt. Herrlich, köstlich, erfrischend, gesund. Wenn man sie öffnet trägt man besser eine Schürze oder dunkle Kleidung, denn sie brechen auf, einer Zersplitterung gleich, und Hunderte von saftigen Kernen geizen nicht damit, ihr kostbares Gut zu verspritzen. Ob als Saft, im Salat oder auf Eis – Granatäpfel sind einzigartig. Es existiert sogar der Mythos, dass jeder Granatapfel exakt 613 saftige Kerne enthält – ein Symbol für die 613 zu beachtenden Gebote in der jüdischen Religion. Ich habe es geprüft – es stimmt NICHT! Auch das ist etwas, das Granatäpfel mit Israel verbindet – Mythos und Realität.
Auf Hebräisch heißen sie „Rimonim“, in der Einzahl „Rimon“, und die deutsche Übersetzung könnte passender nicht sein. Es ist ein Wort, das außerhalb der Agrarwirtschaft in einem ganz anderen Kontext genutzt wird. Denn: „Rimonim“, das sind nicht nur Granatäpfel, nein, das sind auch Handgranaten. Und so wandelt sich der Begriff für eine köstliche, nahrhafte Frucht plötzlich und unerwartet auch in einen Begriff, der Kampf und Zerstörung, Leben und Tod, Angriff und Verteidigung bedeutet. Es ist, als hätte der Granat-Apfel zwei Seiten: Im einen Kontext liegt die Betonung auf „Apfel“, im anderen auf „Granate“. Ich habe oft miterlebt, wie rasch etwas Schönes in etwas Tragisches zersplittern kann. Ich durfte aber auch staunen, welch unerwartete Schönheit oder welch ein Segen aus einer tragischen Situation hervorging. In Israel liegen Freude und Trauer, Jubel und Verzweiflung, Tod und Leben nie weit auseinander. Wie nah Dinge wie diese beieinander liegen, habe ich manchmal kaum fassen können.
Dieses Buch ist eine Einladung, mich auf meiner Reise zu begleiten und den Herzschlag der Menschen in Israel wahrzunehmen. Vor allem aber ist es eine Einladung, zwischen den Zeilen zu lesen und die eigene Entdeckungsreise anzutreten.
Kapitel 1 – 2000
Alles wird anders. Ganz anders!
Mein Start ins Abenteuer. Israel blühte und florierte, es erlebte einen Touristenrummel wie noch nie zuvor. Das hatte vielfältige Gründe. Zum einen weil vor rund 2000Jahren Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, zum anderen hatte Papst Johannes Paul II. Israel bereist – der zweite Papst erst, der je seinen Fuß in dieses Land setzte. Millionen von Katholiken spürten nun eine neue Freiheit, die Wiege des Christentums zu besuchen. Etwa vier Jahre zuvor wurde die zweite Stufe des Oslo-Friedensprozesses ratifiziert und es war in Bezug auf Terroranschläge stiller in Israel geworden – auch wenn so manchem sicher klar war, dass dieser Friede trügerisch und zerbrechlich war.
Die ersten drei Monate des Jahres, ehe ich ins Flugzeug stieg, verbrachte ich damit, meine Abreise aus Deutschland vorzubereiten, meinen Haushalt aufzulösen, meine Stelle als Erzieherin zu übergeben, allerlei notwendige Bürokratie zu bewältigen und mich von vielen Menschen, die mir lieb und wichtig waren, zu verabschieden. Auch auf Israel hatte ich mich vorbereitet. Nicht genau wissend, was mich erwarten würde, einem weniger komfortablen Lebensstandard entgegenblickend, traf ich Vorsorge – so wie wir Deutschen das gern tun. Alles in allem waren es sehr beanspruchende drei Monate, erfüllt von großer Vorfreude auf den Schritt aus meiner Wohlfühlzone heraus in ein Abenteuer hinein.
Die ersten Monate in Israel waren davon geprägt, mich zurechtzufinden. Vieles war Neuland: Ein Bürojob statt Sozialarbeit, Leben in einer Wohngemeinschaft, Englisch als Hauptsprache, Hebräisch bröckchenweise als Nebensprache, einen Freundeskreis aufbauen, und all das inmitten einer Lebenskultur, die ein Patchwork aus vielerlei Elementen ist.
Es war eine spannende, eine aufgrund der vorprogrammierten Missverständnisse oftmals urkomische Zeit. Aber es war auch eine tragische Zeit. Drei Wochen nach meiner Abreise erkrankte meine Mutter urplötzlich und unvorhergesehen an einer Lungenentzündung und starb zwölf Tage später. Sie starb in der Nacht zum israelischen Unabhängigkeitstag, den die Nation jährlich ausgelassen feiert; eine Nacht in der der Nachthimmel von fröhlichen Feuerwerken erhellt wird. Eine Nacht der krassen Gegensätze für mich. Etwas, das ich in meinen Jahren in Israel noch oft erleben sollte.
Somit reiste ich zunächst nach Deutschland zurück, verabschiedete mich von meiner Mutter, bettete sie in Kissen und in Erde und übergab sie einem besseren Leben in der Ewigkeit.
Und dann, Ende September 2000, brach die Zweite Intifada aus. Intifada heißt übersetzt so viel wie „sich erheben, loswerden, abschütteln“. Eine erneute Terrorwelle erschütterte Israel und ich war mittendrin. Unvorhergesehen spürte ich hautnah, was Terror bedeutet und wie er sich im Alltag auswirkt – auf jedes Menschenleben, zu jeder Tageszeit. Ein Ende war nicht abzusehen. Das florierende Leben in Israel verwandelte sich ins Gegenteil und glich einem Luftballon, aus dem langsam, aber stetig die Luft entweicht. Auch ich brauchte einige Zeit, bis ich diese veränderte Alltagsrealität begriff. Wie „integriert“ man solch einen Irrsinn ins tägliche Leben? Und wie schützt man sich, innerlich und äußerlich? Fragen, die ich mir bis dahin so nicht stellen musste, doch nun platzten sie plötzlich, fordernd und erbarmungslos in mein Leben hinein.
>>>>>>>>>> • <<<<<<<<<<
Ankunft in der neuen Heimat
Da bin ich nun. Israel ist greifbare Realität. Die Tage seit meiner Ankunft waren aufregend – vor allem deshalb, weil ich noch immer dabei bin, mich zu akklimatisieren und zurechtzufinden und zu begreifen, dass ich hier nicht nur Urlaub mache.
Man hat mir einen warmen und herzlichen Empfang bereitet. Direkt nach meiner Ankunft begleitete mich einer der Mitarbeiter zu meiner Wohnung im Süden Jerusalems. Es ist eine ruhige und angenehme Wohngegend und ich habe es nicht weit zur „Haas-Promenade“ – einem wunderschönen Aussichtspunkt, von dem man die Altstadt und den berühmten Ölberg überblicken kann.
Die Wohnung, in der die Organisation mich untergebracht hat, ist gut ausgestattet. Ich muss gestehen, dass ich weit weniger Komfort erwartet habe. Diese Wohnung teile ich mir derzeit mit einer knapp siebzigjährigen Texanerin. Eine weitere Person soll in absehbarer Zeit dazukommen, dann ist die Dreier-WG komplett.
An meinem offiziellen Begrüßungstag lernte ich Leiterschaft und Mitarbeiter der Organisation kennen. Die Herzlichkeit und Hingabe sind beeindruckend. Gemeinsam mit zwei anderen „Neuen“ gingen wir auf Orientierungstour, durch die wir einen Überblick über das Riesenunternehmen erhielten. Es war ziemlich überwältigend. Im Lebensmittelverteilzentrum werden täglich zwei Tonnen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Diese Nahrungsmittel werden frisch eingekauft, es sind keine Überbleibsel, wie wir es von den Tafeln in Deutschland kennen. Die Menschen, die in ihrer Not zu uns kommen, leben größtenteils in schrecklich demütigenden Verhältnissen, sodass Bridges for Peace ihnen mit dieser Geste auch Wertschätzung und aufrichtige Liebe entgegenbringen möchte. Etwa fünfundzwanzig Volontäre bewältigen die Aufgabe der Lebensmittelportionierung und -verteilung. Da das Passahfest bevorsteht, werden in dieser Zeit zusätzlich zu den üblichen Lebensmittelpaketen täglich zwischen 400 und 500 „Passahpakete“ an jüdische Familien verteilt. Darin ist alles enthalten, was für ein traditionelles Passahfest notwendig ist. Viele der jüdisch-orthodoxen Familien leben unterhalb der Armutsgrenze und sollen dadurch Verständnis und Achtung erfahren. Auch Neueinwanderern möchten wir das Feiern ihres ersten Passahfestes in Israel mit dieser Gabe ermöglichen. Diese Geste baut eine Brücke zwischen Judentum und Christentum, denn oft genug wurden im Namen des Christentums in den vergangenen Jahrhunderten Juden und ihre Feste verunglimpft, wurden sie ihrer Identität und Glaubensausübung beraubt.
Preise zum Abgewöhnen
Einkaufen ist ein Unterfangen aus „Versuch und Irrtum“, ein Orientieren an Bildern und dem Kontext des Lebensmittelregals. Wie unterscheidet man Joghurt von Schmand von Schlagsahne, wenn die Sprachbarriere einen hindert, das Gedruckte zu verstehen und sich die Becher ähneln? Momentan findet sich dann und wann unfreiwillig etwas auf meinem Speiseplan, das eigentlich etwas anderes hätte sein sollen.
Beim Einkauf für meinen persönlichen Bedarf mache ich an der Kasse manchmal sehr große Augen, denn die Preise haben es im Vergleich zu Deutschland in sich. Ich begreife, wie schwer es sein muss, hier eine Familie zu ernähren, wenn auch nur ein Elternteil von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Es gibt keine so umfangreiche „Sozialhilfe“ wie in Deutschland. Zur Verdeutlichung einige Beispiele:
•Im Vergleich zu Deutschland kostet ein Liter Milch das Zweieinhalbfache, ein Becher Naturjoghurt das Fünffache;
•ein Paket Cornflakes kostet das Vierfache und ein Glas Nutella oder ein simples Toastbrot das Sechsfache;
•Deodorant kostet den achtfachen Preis, Shampoo etwa den sechsfachen.
An meinem zweiten Tag wurde ich in meinen Arbeitsbereich eingeführt. Ich bin dafür zuständig, täglich mindestens einmal die Webseite zu aktualisieren und neue Artikel hochzuladen. Außerdem fallen diverse Büro- und Sekretariatstätigkeiten an und eine vielfältige Datenerfassung will auch auf dem Laufenden gehalten werden. Weiterhin ist angedacht, dass ich verschiedene Publikationen ins Deutsche übersetze. Es ist viel Verwaltungs- und Computerarbeit, doch jeder von uns hat auch regelmäßig die Gelegenheit, im Lebensmittelverteilzentrum mitzuhelfen. Das wird in der ersten Zeit für mich nicht möglich sein, weil der Administrationsbereich zur Zeit unterbesetzt ist und ich ein Intensivtraining durchlaufe, denn in zwei Monaten werde ich bereits die „Dienstälteste“ sein. Die anderen beiden Kollegen dieses Bereichs befinden sich im Heimaturlaub oder beenden ihren Dienst in naher Zukunft.
Zwischen Trauern und Entrümpeln
Die letzten Wochen waren sehr ereignisreich für mich. Da ist so viel Neues, das auf mich einströmt und in dem ich mich zurechtfinden muss. Mitten dorthinein platzte die Nachricht, dass meine Mutter plötzlich an einer sehr schweren Lungenentzündung erkrankte. Zwölf Tage lag sie im Koma und schwebte zwischen Leben und Tod. Dann starb sie.
In Worte zu fassen, was in mir vorgeht, nachdem meine Mutter heimgegangen ist, wie ich all das zu bewältigen versuche, was mich in der Zeit ihres Krankenhausaufenthalts beschäftigt hat, fällt schwer. Ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich mich da durchgewühlt habe. Trotzdem kann ich in dieser Situation sagen: Ich fühle mich total von Gott getragen und in seinem Frieden geborgen, auch wenn ich mich jetzt manchmal nackt und schutzlos fühle, weil meine Mutter nicht mehr da ist. Sie war ein Stück von mir – oder besser gesagt ich von ihr – und das fehlt mir nun auf dieser Seite des Lebens.
Ich bin unendlich dankbar für die letzten Jahre, die ich mit meiner Mutter erleben durfte. Durch viele Gespräche mit den verschiedenen Ärzten nach ihrem Tod habe ich herausgefunden, dass es medizinisch betrachtet ein unerklärliches Wunder ist, dass meine Mutter überhaupt so lange gelebt hat. Als sie 34Jahre alt war, erlitt sie einen Schlaganfall, den ein Blutpfropfen, der durch ihre dysfunktionale Herzklappe durchgeschwemmt wurde, ausgelöst hat. Ihr Herzklappenfehler wurde jahrzehntelang nicht festgestellt, geschweige denn behandelt. Man hat ihrem Körper angesehen, dass er viel kämpfen musste, und eigentlich hätte sie ihre schwere Herzoperation vor sechseinhalb Jahren gar nicht überleben dürfen. Aber letztlich entscheiden nicht Ärzte über Leben und Tod, sondern Gott. In diesem Licht betrachtet kann ich mehr als dankbar sein, denn in diesen Jahren konnten meine Mutter und ich viele Dinge aufarbeiten, die uns in der Vergangenheit tief verwundet haben. Wir konnten einander Vergebung zusprechen und in Versöhnung weitergehen. Es war kein leichtes Leben, das ihr beschert worden war, ganz im Gegenteil. Das, was sie „packen“ musste, ging in jedweder Hinsicht an die Substanz, manchmal gar bis zu einem Punkt, der sie fast das Leben gekostet hätte.
In diesen geschenkten Jahren hat sich meine Mutter mit Gott ausgesöhnt. Und obwohl ich ihr für sie, sicher aber auch für mich, noch ein paar schöne, friedvolle Jahre hier auf Erden gewünscht hätte, gönne ich ihr von Herzen diese wunderbare Herrlichkeit des Himmels, die sie nun erleben darf. Und ich? Ich stehe inmitten aller Trauer in Ehrfurcht und staunender Dankbarkeit vor Gott. Er hat mich nicht nur getröstet und getragen, sondern obendrein die perfekte Lösung für alle Dinge geschenkt: Die Wohnung meiner Mutter konnte ich möbliert weitervermieten. Alle Papiere kamen rechtzeitig zusammen. Alle Rechnungen konnten bezahlt werden. Das Beerdigungsinstitut war mehr als sorgfältig und sensibel. Es konnte genau die Beerdigungsform gefunden werden, die sich meine Mutter gewünscht hatte. Innerhalb von zwei Wochen habe ich das irdische Dasein meiner Mutter „abgewickelt“. Es war manchmal wirklich kaum zu fassen, dass alles so parallel abläuft: Trauern, Papierkram, Vermissen, Entrümpeln, Gefühle verarbeiten, Organisieren … Und hautnah ist mir klargeworden, dass im Prinzip nichts von uns übrig bleibt in dieser Welt, wenn wir einmal gegangen sind: Unser Leben verschwindet in Kisten und Säcken oder auf dem Sperrmüll, Fotos und Erinnerungen verblassen … Was bleibt? Es bleibt nur das, was wir in die Herzen der Menschen hineingelegt haben. Unsere Spuren in ihren Herzen, in ihrer Seele und in ihrem Geist. Das, was Gott durch meine Mutter in mich hineingelegt hat, wird weiterleben. Es sind Dinge, die ich nie verlieren oder vergessen werde: Standfestigkeit, Lebensfreude, immerwährende Hoffnung auf das Licht am Ende des Tunnels, Durchhaltevermögen, Vergebungsbereitschaft, Kampfeswille, Mut und ihre bedingungslose Liebe, die sie an die Menschen um sie herum großherzig verschenkt hat – selbst wenn sie teilweise Ablehnung oder gar Schlimmeres dafür geerntet hat.
Durch diese Erfahrungen verschieben sich (erneut) die Prioritäten in meinem Leben. Das, was wirklich wichtig ist, ist nicht immer das, was auf den ersten Blick wichtig erscheint. Manche Minute der Gemeinschaft mit jemandem anderen kann mehr bewirken in dieser Welt als ein scheinbar wichtiger Auftrag.
Die letzten Wochen vor meiner Abreise nach Israel waren ein bewusstes Abschiednehmen für meine Mutter und mich gewesen. Es war eine schöne Zeit und wir haben sie sehr genossen, obwohl ich mir im Nachhinein manchmal gewünscht habe, ich hätte diesen Abschied noch intensiver gestaltet. Weder sie noch ich ahnten damals, dass wir uns für eine so lange Zeit würden verabschieden müssen, deshalb blieb unser Alltag in gewissem Sinne normal. Ich bin dankbar dafür, dass mir die letzten Leidensbilder erspart geblieben sind, denn von ihnen gab es bereits zu viele. So kann ich mit all den schönen Erinnerungen weitergehen, bis wir uns wiedersehen und ungetrübt die Herrlichkeit der Ewigkeit gemeinsam genießen dürfen.
Rückzug aus dem Libanon
Meine Arbeitskollegen haben viel dazu beigetragen, dass ich diese emotional sehr fordernde Situation bis hierher schaffen konnte. Gott hat mich wirklich an einen sehr guten Platz gestellt. Immer waren und sind Gesprächspartner auffindbar und praktische Hilfe greifbar. Es ist ein bisschen wie Familie: spürbar, nahbar, füreinander da sein in jeder Situation.
Mittlerweile bin ich allein in der Verwaltung und werde es auch für die nächsten zwei bis drei Monate bleiben. Erst dann werden Volontäre an- oder wiederkommen, die mir unter die Arme greifen werden. In „meine“ Wohnung sind neue Mitbewohnerinnen eingezogen: Eine 24-jährige Brasilianerin sowie eine 72-jährige „little old lady“ aus Kalifornien. Hut ab! Ich hoffe, dass ich, wenn ich im Rentenalter bin, noch ebenso energiegeladen und abenteuerlustig sein werde. Es ist ein bereicherndes Zusammenleben: drei Generationen und Kulturen unter einem Dach. Jeder von uns hat andere Vorzüge und Ideen, die man mal mehr, mal weniger nachvollziehen kann.
Israel hat sich aus dem Südlibanon zurückgezogen. Viele Mitglieder der Südlibanesischen Armee sind während des Rückzugs nach Israel geflohen. Die Mehrheit von ihnen sind Christen, die an der Seite der israelischen Sicherheitskräfte über viele Jahre gegen die im Libanon agierenden Terrorgruppen gekämpft haben. In Israel sind derzeit etwa 6500 Menschen angekommen. Einige versuchen auch jetzt noch, die Grenze zu überqueren, was kaum möglich ist; andere sind mutig genug, in den Libanon zurückzukehren und glauben den Versprechungen der islamischen Hisbollah, die nun den Südlibanon kontrolliert, dass sie keine Repressalien zu fürchten hätten.
Bridges for Peace hat prompt reagiert. An den vergangenen beiden Wochenenden sind einige Mitarbeiter in den Norden gefahren, um Hilfsgüter, Hygieneartikel und auch Bibeln weiterzugeben. Viele Christen waren überaus dankbar, endlich wieder eine Bibel in der Hand zu halten, denn sie konnten kaum mehr mitnehmen als das, was sie am Leib trugen. Die Aussichten, dass sich all diese Menschen in Israel gut integrieren, sind recht gut, denn viele von ihnen sind bereits vorher saisonal über die Grenze gekommen, um Geld für ihren Lebensunterhalt in Israel zu verdienen. Viele sprechen fließend Hebräisch und haben sich ein soziales Netzwerk aufgebaut.
Metulla, eine Stadt an der Grenze zum Libanon, die fast ausschließlich vom Tourismus lebt, ist nun allerdings zur Militärzone geworden, über die der Ausnahmezustand verhängt worden ist. Der Tourismus wird wohl nicht so rasch wieder aufleben, und die Bewohner stehen größtenteils entweder vor dem geschäftlichen Aus oder sehen herben finanziellen Verlusten ins Auge. Zukunftsperspektiven erscheinen nicht gerade rosig; viele Familien müssen sich mit einer gravierend veränderten Realität arrangieren. Wir reagieren spontan auf die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Regelmäßig werden kleine Teams in den Norden fahren, Hilfsgüter verteilen und vor allen Dingen Zeit mit den Menschen verbringen, sie ermutigen und ihnen helfen, wo es geht.
Eine Million Juden sind seit dem Fall des Eisernen Vorhangs aus den ehemaligen GUS-Staaten nach Israel ausgewandert. Die Bilder ihrer Ankunft in Israel berühren mich immer sehr. Ihre Minen spiegeln auf vielfältige Weise das Gefühl von „endlich zuhause!“ wider. Wie gut fühlt es sich an, wenn man nach einer anstrengenden Zeit sein Zuhause erreicht und aller Stress, aller Kampf, alle Furcht, aller Lärm, alle Anfeindungen von einem abfallen. Wir alle kennen diese Momente und das tiefe Durchatmen, das damit einhergeht. Zuhause – dieser Begriff bedeutet so viel. Zuhause, das tut gut! Welche Verhöhnungen, Anfeindungen und Verluste viele dieser Ankömmlinge, ebenso wie jene aus anderen Ländern, überwinden mussten bis sie hier ankamen, kann wohl niemand so recht einschätzen. Die Erleichterung steht ihnen jedoch ins Gesicht geschrieben, obwohl sie wissen, dass ihnen eine Zeit voll neuer Herausforderungen bevorsteht. Der amtierende Ministerpräsident Ehud Barak begrüßte den millionsten Heimkehrer am Flughafen unter dem Jubel der ganzen Nation. Das, wovon bereits im Alten Testament die Rede ist, erfüllt sich in unseren Tagen.
Wassernotstand, Visumslotterie und Gipfeltreffen
Während ich aus Deutschland fast nur Schlechtwetter-Meldungen erfahre, durchlebe ich in Israel das andere Extrem – eine ordentliche Hitzewelle. Das ist aufgrund des Wassermangels nicht übermäßig erfreulich. Der Wasserspiegel des Sees Genezareth ist auf einen noch nicht dagewesenen Tiefpunkt gesunken. Dieser See ist die wichtigste Trinkwasserquelle des Landes und muss genau beobachtet werden. Das Tiefenwasser des Sees ist Salzwasser, das lediglich von einer Süßwasserschicht bedeckt wird. Mit sinkendem Pegel fällt der Gegendruck ab, wodurch aus salzigen Tiefenquellen weiteres Salzwasser in den See gelangen kann. Durch den Grundwasserdruck des Mittelmeeres kann ebenso Salzwasser in den See gelangen. Sinkt der Wasserspiegel zu sehr ab und wird somit die Süßwasserschicht zu dünn, könnte der See Genezareth kippen und komplett versalzen, was drastische ökologische und ökonomische Folgen hätte.
Die Regierung hat eine „Wasserpolizei“ organisiert. Diese SoKo patrouilliert und beglückt notorische Wasserverschwender mit Belehrung und Bußgeld. Nach allem, was ich selbst beobachten kann, finde ich diese Maßnahme gar nicht so schlecht, denn man sollte meinen, dass die Israelis, die ja im Grunde genommen ständig von diesem Wassernotstand betroffen sind, bedachter mit dem kostbaren Gut umgehen. Aber vielleicht ist dies mein „deutscher“ Hintergrund, denn Recycling, Umweltschutz und sorgsamer Umgang mit Ressourcen sind Dinge, die uns Deutschen ja in besonderem Maße eingebläut werden.
Ich habe mein Visum für die nächsten sechs Monate erhalten. Es gab keine Schwierigkeiten beim Innenministerium, wenn auch die Visumsbeantragung für Volontäre einer Art Lotterie gleicht. Vielleicht sind es lediglich die sprachlichen und kulturellen Unterschiede, die es manchmal schwer machen, die Schlüssigkeit einer Entscheidung nachzuvollziehen. Doch selbst in meinen wenigen Monaten hier hat sich bereits der Eindruck verfestigt, dass oftmals die Qualität des Morgenkaffees, ein verbrannter Toast oder ein verpasster Bus Auswirkungen auf die Erteilung oder Verweigerung der begehrten Stempel in unseren Pässen haben.
Weltweit hat man Camp David II, das Treffen zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Bill Clinton, Ministerpräsidenten Ehud Barak und PLO-Chef Jassir Arafat aufmerksam beobachtet. Die Stimmung in Israel war ziemlich angespannt. In den Wochen zuvor und während dieses Treffens haben unzählige Menschen täglich demonstriert, ihre Befürchtungen kundgetan und ihren Mangel an Vertrauen in die Regierung verlauten lassen. Friedlich, aber bestimmt. Dass das Treffen ohne Ergebnis endete, erzeugte in der Bevölkerung einen Seufzer der Erleichterung. Der Schock über Ehud Baraks Bereitschaft, Jerusalem zu teilen, mit dem entsprechenden Angebot an Jassir Arafat, ist den Menschen mächtig in die Glieder gefahren. Viele Araber, die in Gebieten unter israelischer Regierung leben, haben neu oder tiefer begriffen, dass sie zukünftig und vielleicht schneller als ihnen lieb ist, unter einer palästinensischen Regierung leben müssten. Sie haben begonnen, ihre Wasser-, Strom- und Grundsteuerzahlungen gegenüber Israel zu begleichen, und erscheinen seitdem vermehrt im Innenministerium, um ihren Pass zu erneuern oder einen solchen zu beantragen – ein Dokument, das ihren Status in Israel sichert bzw. untermauert. Immer mehr Araber erheben deutlich ihre Stimmen und sagen öffentlich, dass sie unter israelischer Regierung weiterleben wollen. „Die Hölle Israels ist immer noch besser als die Versprechungen Arafats“ ist ein beliebter Slogan und sagt viel aus über den politischen Führer, unter dessen Herrschaft man lebt.
Arafat wurde in den palästinensischen Autonomiegebieten von seinen Anhängern und den islamistischen Fundamentalisten als der Held, der nicht nachgegeben hat, gefeiert und dementsprechend medienwirksam empfangen. Hisbollah-Angehörige (Hisbollah ist eine Terrororganisation) haben während der gesamten Camp David II-Zeit aufgestockt: Waffen, Munition, Lebensmittelvorräte, Trinkwasser. Nun sehen sie sich darin bestätigt, dass Jerusalem, oder wie sie es nennen Al-Quds, nur durch Krieg befreit werden kann. Auch der Tagesablauf sämtlicher Ferienlager für palästinensische Kinder und Jugendliche (Mädchen wie Jungen) besteht zum großen Teil daraus, in diversen Workshops die Handhabung von Waffen zu trainieren und Krieg „zu spielen“.
Ehud Barak hingegen steht vor einer zerfallenen Regierung. Einige Minister haben ihr Amt quittiert und Barak ist dabei, die Scherben zusammenzukleben. Bisher hat noch kein Misstrauensvotum, das den Weg für Neuwahlen frei machen würde, erfolgreich das Parlament passiert. Daher schwankt Israel eher orientierungslos auf dem Ozean der Weltpolitik umher. Nach Camp David II machte Benjamin Netanjahu deutlich, dass er „gern“ in das Amt des Ministerpräsidenten zurückkehren würde. Er genießt nach den aktuellen Geschehnissen eine immense Gunst beim Volk, denn er ist als Hardliner bekannt, und somit hofft man, dass Jerusalem unter seiner Hand nicht geteilt werden würde.
Zwischen den Fronten
Die Flüchtlinge der Südlibanesischen Armee (SLA) haben in Israel recht gut Fuß gefasst. Einige haben die Reise in ein anderes Land angetreten. Es hat mich sehr gefreut, dass auch Deutschland ein paar dieser Menschen aufgenommen hat. Etwa dreihundert von ihnen sind in den Libanon zurückgekehrt, meist deshalb, weil ihre Familien auseinandergerissen wurden. Manch einem mag es ähnlich ergehen wie damals in Deutschland den Berlinern, als über Nacht plötzlich eine Mauer vor ihren ungläubigen Augen hochgezogen wurde, trotz der lautstarken Aussage Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!2
Als Organisation sind wir noch immer kräftig dabei, diesen Menschen zu helfen. Sie sind prinzipiell gut versorgt, doch es fehlt zumeist an Toilettenartikeln und Babynahrung. Den Menschen ist es jedoch oftmals wichtiger, dass sich jemand Zeit für sie nimmt und ihnen einfach zuhört. Man merkt, wie sehr der Schmerz sie zerreißt, denn jeder von ihnen hat Freunde oder Familienangehörige in dieser ungewissen Situation im Libanon zurücklassen müssen. Es ist fast unmöglich zu telefonieren, denn sobald jemand im Libanon Anrufe aus Israel erhält, kann er damit rechnen, des Hochverrats angeklagt zu werden und nicht einschätzbaren Konsequenzen ins Auge zu sehen. Die einzelnen Schicksale sind oft kaum zu erfassen, doch hier ein Beispiel, dessen Tragik wir hautnah miterlebten:
Eine schwangere Frau hatte wenige Tage vor dem Rückzug ihren Sohn zur Welt gebracht. Es war eine komplizierte Geburt und direkt danach stellten libanesische Ärzte fest, dass der Junge an einem schweren Herzfehler litt, der eine Operation erforderte. In Haifa befindet sich die bestausgestattetste Herzchirurgie der Region. Der Vater, ein Mitglied der SLA, konnte durch seine Verbindungen dafür sorgen, dass sein Sohn nach Haifa geflogen wurde, und übernachtete bei Verwandten dort. Die Operation wurde am vierten Lebenstag des Kindes durchgeführt und war den Umständen entsprechend erfolgreich. Der Vater kehrte für einige Tage in den Libanon zu seiner geschwächten Frau zurück, die sich im Krankenhaus von den Folgen der Geburt erholte. Genau zu diesem Zeitpunkt fand der Rückzug statt und die Grenzen wurden geschlossen. Das Baby befindet sich nun bei den israelischen Verwandten, die frischgebackenen Eltern im Libanon. Sie hegten die Hoffnung, im Zuge des Rückzugs nach Israel umsiedeln zu können. Nun jedoch sitzen beide Elternteile im Südlibanon fest während die libanesischen Behörden sich weigern, das Baby hineinzulassen, denn durch den Notfall und die sich überschlagenden Ereignisse wurden keine Geburtspapiere ausgestellt und das Baby gilt nun formalrechtlich als staatenlos und obendrein als „israelischer“ Feind. Welch eine verzwickte Situation durchlebt die Familie!
5000-mal Starthilfe
Eine weitere, eher „schnöde“, aber dennoch bemerkenswerte Tatsache hat sich in meiner Verwaltungsarbeit ergeben. Ich verarbeite die Daten von Neueinwanderern, damit ihnen durch unsere Organisation angemessen geholfen werden kann, denn wir legen den Schwerpunkt auf Starthilfe in Israel. Viele kommen verarmt oder krank an, schauen einem völlig neuen Umfeld entgegen, müssen Sprache, Land, Kultur und Politik erst kennenlernen, Arbeit, Wohnung, Freunde und eine Schule für ihre Kinder finden. Immense Herausforderungen! Langer Rede, kurzer Sinn: Wir haben die Zahl 5000 überschritten. Das heißt, in den letzten zwei Jahren, hauptsächlich aber im Laufe diesen Jahres, gelang es uns, in Zusammenarbeit mit sieben anderen Organisationen 5000 Juden aus den ehemaligen GUS-Staaten nach Israel zu bringen.
Wenn diese Menschen hier ankommen, erhalten sie zunächst einmal eine Haushalts-Erstausstattung (Geschirr, Handtücher, Bettwäsche, Decken etc.). Dann wird eine Bestandsaufnahme gemacht und festgestellt, welche individuelle Hilfe benötigt wird. Manche sind so arm, dass sie kaum etwas zu essen auf den Tisch bekommen (das israelische Sozialnetz ist nicht in der Lage, diese Nöte aufzufangen). Sie werden dann in unser Adoptionsprogramm aufgenommen, was bedeutet, dass sie zweimal monatlich ein ordentliches Nahrungsmittelpaket und eine Monatskarte für den Bus erhalten, um Arbeit und Wohnung zu suchen. Die Kinder erhalten eine Schulausstattung und ebenso die Fahrkarten für den Schulweg. Das ist die Basishilfe. Sollte darüber hinaus Unterstützung erforderlich sein, so versuchen wir, Wege zu finden, auch diesen Nöten zu begegnen. Haben sie eine Wohnung gefunden, die vor dem Einzug eine Renovierung notwendig macht (was in Israel keine Seltenheit ist, denn der Standard von Mietwohnungen ist mit deutschem Standard nicht zu vergleichen), tritt unser Handwerkerteam in Aktion. In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen vor Ort werden dann Gebrauchtmöbel beschafft, damit die Familie ein Zuhause einrichten kann. Bei all dem hilft die neu eingewanderte Familie aktiv mit. Dadurch lernen sie, in ihrem neuen Umfeld Eigenverantwortung zu übernehmen, ohne die die Integration in das neue Umfeld kaum zu schaffen ist.
Not-Lösung
Welch plötzliche und tragische Wendungen ein Lebensweg nehmen kann, das zeigt folgende Geschichte. Es ist eine von vielen Geschichten, die mir hier tagtäglich begegnen, so wie sie das Leben schreibt:
Galina ist 53Jahre alt, gelernte Ingenieurin und hat eine dreizehnjährige Tochter, Anna. Die beiden sind vor knapp zwei Jahren nach Israel gekommen, um ihre kranke Schwester und Tante, der eine Krebsoperation bevorstand, zu besuchen. Die Schwester verstarb im Krankenhaus und hinterließ eine geistig behinderte Tochter mit einem ebenfalls geistig behinderten Baby.
Galina und Anna entschieden sich, ihren Aufenthalt zu verlängern und ihrer verwaisten Nichte und dem Baby zu helfen. Der Tod ihrer Mutter hat Galinas Nichte leider derart tief getroffen, dass sie mehrfach stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden musste und bis heute die Klinik nur zu kurzfristigen Besuchen verlassen kann. Galina sorgte für das Baby, weil ihre Nichte nur sehr begrenzt dazu fähig war und ist. Nun ist das Kind zweieinhalb Jahre alt und besucht eine Ganztagsvorschule für geistig behinderte Kinder. Galina kann diese rundum tragische Situation nur schwer verkraften.
Während dieser Zeit ließ sich Galinas Ehemann, der in Russland geblieben war, unerwartet scheiden. Da sie und Anna nun kein Zuhause mehr hatten, zu dem sie zurückkehren konnten, entschieden sie sich, nach Israel einzuwandern und neu zu beginnen. Da sie eigentlich nur ein paar Wochen hatten bleiben wollen, brachten sie nur sehr wenige Habseligkeiten mit sich und waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, in Israel zu leben.
Die Ingenieurin reinigt nun Treppenhäuser und lernt Hebräisch. Anna besucht die Schule, spielt Klavier und Violine und möchte gern ihre Fähigkeiten im Singen und Theaterspielen erweitern. Seit einiger Zeit erhalten sie von uns Unterstützung.
Es ist eine unbeschreibliche Belohnung, die angerührten Gesichter zu sehen. Menschen, die aus ihrer Not keinen Ausweg sahen, sehen nun das Licht am Ende des Tunnels, wie auch das Licht der Liebe. Für viele von ihnen ist es immer noch unfassbar, dass Christen ihnen unter die Arme greifen. Ja, diejenigen, die sie über Jahrtausende hindurch verfolgt, getötet, gequält und ihres Glaubens beraubt haben, helfen nun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Egal wo diese Menschen herkommen, der Zweifel, dass Christen es je gut mit ihnen meinen könnten, sitzt unermesslich tief, besonders weil Judenverfolgung auch heute noch existiert. Immer wieder berichten Medien von antisemitischen Übergriffen. Wir alle wissen um die Wirkung von Lob und Kritik und wie vorsichtig Kritik geäußert werden sollte, um Lob nicht unwirksam zu machen. Wie viele Liebesbotschaften müssen wohl vermittelt werden, ehe die Wunden der Judenverfolgung, die ja immer wieder aufreißen, heilen werden?
Zahnärzte im Einsatz
Zur Zeit haben wir ein Zahnärzteteam aus den USA hier. Das sind Zahnärzte, die sich quer durch die USA zusammengefunden haben, weil es ihnen ein Herzensanliegen ist, bedürftigen Menschen zu helfen. Sie haben die Reise auf eigene Kosten angetreten und in den Monaten zuvor Unterstützung mobilisiert, um die komplette Praxisausstattung sowie Medikamente zu finanzieren. Auch Bridges for Peace hat sich daran beteiligt. Beladen wie Packesel sind sie hier angereist und es ist reine Gnade, dass sie mit all dem medizinischen Gut den Zoll passieren konnten, ohne Einfuhrgebühren bezahlen zu müssen. Welch ein Segen!
Nachdem sie alles eingerichtet hatten, haben sie im Hauptbüro von BFP ihre Praxis eröffnet und behandeln seitdem etwa vierzig Patienten am Tag. Es ist gar nicht so einfach, den Patienten zu erklären, was getan werden muss, wissen wir doch alle, dass ein Besuch beim Zahnarzt zu den eher weniger angenehmen Dingen im Leben gehört. Also stehen den Ärzten Übersetzer zur Seite. Viele der Patienten haben schon lange keinen Zahnarzt mehr gesehen und somit muss reichlich gebohrt, gefüllt, gezogen und operiert werden. Die israelische Krankenversicherung deckt Zahnbehandlungskosten nur sehr eingeschränkt, daher ist eine angemessene Behandlung für viele unserer Klienten unerschwinglich. In ihren Gesichtern kann man lesen, dass sie trotz des Schmerzes, den sie fürchten, sehr dankbar sind, von ständig nagendem Zahnschmerz oder anderen Problemen befreit zu werden. Die Zahnärzte scheinen einen sehr guten Job zu machen, denn ihre Praxis befindet sich direkt unter meinen Bürofenster und ich habe bisher kein Schreien vernommen!
Ich selbst bin noch immer dabei, den Verlust meiner Mutter zu verarbeiten, was sicherlich noch eine Weile dauern wird. Ich habe einen dreimonatigen Hebräischkurs begonnen. Zunächst absolvierte ich einen Test, um zu sehen, auf welchem Niveau ich mit meinen Vorkenntnissen einsteigen sollte. Nun nehme ich dreimal wöchentlich für jeweils drei Stunden an einem Abendkurs teil, stopfe mich zwischendurch beim Busfahren mit Vokabeln voll und genieße das gemeinsame Straucheln und Stottern im Klassenraum. Wir sind eine Gruppe von fünfzehn Studenten, die sich aus Neueinwanderern, Arabern (die ihr Straßenhebräisch mit Grammatik untermauern möchten) und Internationalen, die hier entweder arbeiten oder einen Hilfsdienst ableisten, zusammensetzt. Oftmals raucht und rauscht mir der Kopf, denn darin verwirren sich drei Sprachen und irgendwie bin ich ständig am Übersetzen (wenn auch manchmal nur für mich). Auf jeden Fall ist es mir wichtig, die Sprache zu erlernen, sodass ich besseren Kontakt mit Land und Leuten aufnehmen kann.
Gefährliche Realitäten
Einige Monate sind vergangen und die Situation im Land hat sich schlagartig verändert. Ich stehe inmitten einer Realität, die ich in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Da gibt es keinen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen könnte. Es hat angefangen zu brodeln hier in Israel. Die Lage ist ernst. Ernst, aber ruhig – momentan. Palästinensische Führer haben die kommenden Freitage jeweils zu Tagen des Zorns deklariert und werden sich in großen Massen auf dem Tempelberg versammeln. Deswegen, und auch um die Situation generell unter Kontrolle zu bekommen, mobilisiert Israel ein erhöhtes Kontingent an Sicherheitskräften. Die Altstadt Jerusalems ist seit gestern für Touristen und Zivilisten gesperrt. Die Autonomiegebiete sind abgeriegelt. All das begann so:
Ariel Scharon, Oppositionspolitiker, der Ambitionen hat, Israels nächster Ministerpräsident zu werden, besuchte am 28. September 2000 den Jerusalemer Tempelberg, der unter arabischer Verwaltung steht. Begleitet wurde er von bewaffnetem Personenschutz und etwa eintausend Polizisten, die eventuelle (gewaltsame) Ausschreitungen unter Kontrolle halten sollten. Der palästinensische Sicherheitschef hatte sein Einverständnis für Scharons Besuch gegeben – unter der Bedingung, dass dieser keine Moschee betreten würde, was Scharon auch nicht vorhatte. Scharons Bestreben war es natürlich, bewusst ein politisches Gegenzeichen zu setzen, nachdem die Camp David II-Verhandlungen, die der israelischen Bevölkerung einen ziemlichen Schock versetzt hatten, gescheitert waren.
Es gab am Besuchstag von Scharon auf dem Tempelberg kleine Demonstrationen, die friedlich verliefen. Am darauffolgenden Tag und in den Folgetagen schlugen sie jedoch mehr und mehr in Gewalt um und wurden durch die israelische Polizei unter anderem mit Waffeneinsatz unter Kontrolle gebracht. Nach offiziellen Angaben wurden vier Personen getötet und etwa zweihundert verletzt. Im Gazastreifen und im Westjordanland entwickelten sich daraufhin bewaffnete Ausschreitungen gegen israelisches Sicherheitspersonal, woraufhin religiöse und politische palästinensische Führer zur Zweiten Intifada, einem gewaltsamen Aufstand gegen Israel, aufriefen. Nach ersten Analysen ist es unklar, ob der Aufstand spontan oder auf Befehl der palästinensischen Führung begann.
Doch: Wenn man das alles nicht wüsste, könnte man meinen, es wäre nichts weiter passiert als ein wenig Unruhe in der Altstadt Jerusalems. Das tägliche Leben geht ganz normal weiter und dort, wo wir uns aufhalten, bemerkt man kaum einen Unterschied.
Göttlicher Schutz
Wie drastisch Gewalt und Frieden, Normalität und Ausnahmezustand aufeinander treffen, soll ein Erlebnis am letzten Schabbat verdeutlichen. Schabbat ist (wenn auch nicht ganz) vergleichbar mit „unserem“ Sonntag. Öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht, Autos bleiben weitestgehend geparkt, und die Geschäfte bleiben (bis auf sehr wenige Ausnahmen) geschlossen. Besitzt man kein Auto und möchte sich fortbewegen, ist man auf seine Füße oder wenige Taxis angewiesen. Insbesondere werden religiöse Stadtviertel für Durchgangsverkehr gesperrt. Die Nation atmet durch und pausiert vom hektischen Alltag. Menschen tauchen bewusst in die Ruhe ein, entspannen zuhause oder machen einen Ausflug. Es ist eine besondere Atmosphäre. Schabbat wird herbeigesehnt und willkommen geheißen wie eine Braut, die dem wartenden Bräutigam entgegengeht.
Gemeinsam mit fünf weiteren Volontären hatte ich die Möglichkeit, an einer Führung rund um die Jerusalemer Altstadt und den Ölberg teilzunehmen. Ich freute mich sehr, denn auf der Liste der zu besichtigenden Orte stand einiges, was ich noch nicht kannte. Wie wir aus den lokalen Medien erfuhren, gab es aufgrund von Scharons Besuch auf dem Tempelberg „ein wenig Unruhe“, die aber nicht eskalierte. Unser versierter Reiseführer, der seit vielen Jahren in Jerusalem lebt und einige Konflikte miterlebt hat, beschloss, sich kurz vor Beginn unseres Ausflugs erneut zu informieren. Nachdem er sich rückversichert hatte, dass alles ruhig sei, machten wir uns auf den Weg – zu Fuß. Nach einem etwa eineinhalbstündigen Fußmarsch erreichten wir die Altstadt. Dort wanderten wir umher, durchschlenderten das Hinnom- und Kidrontal und lernten viel über die Orte, die wir besichtigten. Schließlich gelangten wir zum Garten Gethsemane, am Fuße des Ölbergs, und nahmen danach ein arabisches Sammeltaxi zum Gartengrab in Ostjerusalem, ein wenig außerhalb des Damaskustores. Unsere Füße wollten uns einfach nicht mehr tragen und uns war auch bewusst, dass wir am Ende unserer Tour nochmal eineinhalb Stunden Fußweg nach Hause zurücklegen mussten.
Als wir im Gartengrab ankamen, wurden wir von den dortigen Mitarbeitern ganz aufgelöst begrüßt. „Ist alles in Ordnung? Ist euch nichts zugestoßen?“ Das waren die Fragen, die sie uns stellten. Kurz vor uns war eine Gruppe amerikanischer Touristen dort angekommen. Sie hatten den Weg vom Garten Gethsemane zum Gartengrab zu Fuß zurückgelegt und waren unterwegs in die Schusslinie arabischer Steinewerfer geraten. Es gab einige Gruppenmitglieder, die medizinisch behandelt werden mussten, was die Mitarbeiter vom Gartengrab in die Wege leiteten. Ebenso sorgten sie dafür, dass die Gruppe sicher das Hotel, in dem sie sich einquartiert hatte, erreichte.
Uns fuhr schon ein wenig der Schreck in die Glieder. Da waren wir mittendrin im eskalierenden Konflikt, sozusagen im Auge des Sturms, und hatten überhaupt nichts Ungewohntes oder Außergewöhnliches feststellen können, während andere, die lediglich Minuten vor uns am selben Ort waren, die Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes zu spüren bekamen.
Gerade in den letzten Tagen haben sich meine Gebete um Gottes Schutz verstärkt. Sie sind irgendwie realer geworden. Und auch die Antwort auf diese Gebete hat eine tatsächlichere und realistischere Dimension angenommen. In Deutschland musste ich mir nur selten Sorgen um meine Sicherheit machen, doch jetzt und hier bietet sich mir eine andere Realität.
Lynchmord in Ramallah
Es ist der 12. Oktober 2000. Ein schrecklicher Tag. Ich glaube, ich befinde mich in einer Art Schockzustand. Es fällt mir schwer, die Geschehnisse des heutigen Tages in Worte zu fassen.
Heute wurden zwei israelische Reservisten von Polizisten der palästinensischen Autonomiebehörde festgenommen, weil sie irrtümlich auf einer Straße falsch abgebogen waren und dadurch nach Ramallah fuhren. Sie wurden zunächst auf das Polizeirevier gebracht und dort verhört. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich innerhalb von Ramallah das Gerücht, dass die festgenommenen Israelis Undercover-Agenten der israelischen Armee seien. Ein aufgewühlter Mob von über eintausend Männern machte sich auf den Weg zum Polizeirevier. Es gibt Augenzeugenberichte, die aussagen, dass ein Teil der Sicherheitskräfte den Mob zurückzuhalten versuchte, doch konnten sie eine Gruppe von zehn bis fünfzehn mit Messern und Metallstangen bewaffneten Männern nicht aufhalten. Diese verschafften sich Zugang zum Polizeirevier, stachen auf die Soldaten ein, schlugen sie und rissen ihnen Augen und innere Organe heraus. Es wird berichtet, dass sich an diesem Lynchmord einige der Polizisten beteiligten. Einer der Mörder trat ans Fenster des Polizeireviers und präsentierte seine blutverschmierten Hände dem Rest des Mobs, der ihm fanatisch zujubelte. Ein italienisches Fernsehteam, das sich vor Ort aufhielt, filmte, wie der leblose Körper des einen Soldaten aus dem Fenster des Polizeireviers geworfen wurde und der Mob sogleich fanatisch auf den Toten einschlug, ihn trat und förmlich zerstampfte. Der Körper des anderen Soldaten wurde angezündet und durch die Straßen geschleift. Schließlich wurden die Körper der zwei toten Soldaten (oder das, was noch von ihnen übrig war) in der Nähe eines israelischen Checkpoints abgeladen.
Ehrlich gesagt, schreibe ich diese Worte und begreife sie nicht. Diese Worte und auch die Bilder, die unaufhörlich in den lokalen Medien gezeigt werden, drehen mir den Magen um und lassen mich zittern. Ich glaube, ich werde mein Leben lang nicht die um Hilfe und Gnade flehenden Augen des einen Soldaten vergessen.
Israel reagierte auf diesen Lynchmord und beschoss mit Kampfhubschraubern diverse strategisch relevante Ziele im Westjordanland, darunter auch das Polizeirevier in Ramallah, sowie ein Gebäude nahe des Regierungssitzes Arafats im Gazastreifen. Telefonleitungen und Mobilfunk wurden für eine gewisse Zeit außer Kraft gesetzt. Zeitweilig waren die Netze überlastet, zeitweilig wurden die Kommunikationswege bewusst von israelischen Sicherheitsbehörden unterbrochen. Damit nimmt der brodelnde Konflikt eine andere Dimension an. Die Zeichen stehen mehr als auf Sturm.
Wir sind bis ins Innerste geschockt, doch uns geht es gut. Erneut wurde von palästinensischer Seite der kommende Freitag zu einem Tag des Zorns deklariert. Daher wurde in unserer Organisation beschlossen, an dem Tag nicht zu arbeiten, und uns wurde empfohlen, uns am Wochenende von öffentlichen Plätzen fernzuhalten. Es steht außer Frage, dass sich der Konflikt ausweiten und verschärfen wird.
Trügerische Ruhe
Während sich Deutschland auf Weihnachten vorbereitet und der Winter Einzug hält, sieht es hier in Israel ganz anders aus. Von Weihnachtsstimmung ist rein gar nichts zu spüren – wofür es zweierlei Gründe gibt. Einerseits spielt das Fest der Geburt Jesu weder im Judentum noch im Islam eine Rolle. Andererseits überschatten die innenpolitischen Probleme und der zunehmende Terror das tägliche Leben in Israel.
Noch immer steckt mir der Schock über den Lynchmord vom 12. Oktober diesen Jahres in den Knochen und die Bilder verblassen nur sehr langsam. Ich bin auf die Aussage eines britischen Pressefotografen gestoßen, die das, was in mir vorgeht, nicht besser beschreiben könnte. Er befand sich zur Zeit der Tat in Ramallah und versuchte – so sagte er – die Geschehnisse zu fotografieren. Doch einige der Männer des fanatischen Mobs drohten ihm und zerstörten seine Kamera. Wenige Tage später schrieb er im Sunday Telegraph (übersetzt): „Dies war das Schlimmste, was ich je gesehen habe, und ich habe aus dem Kongo, dem Kosovo und von vielen anderen schlimmen Orten berichtet. […] Ich weiß, sie [die Palästinenser] sind nicht alle wie jene und ich bin eine sehr vergebungsbereite Person, aber das werde ich nie vergessen. Es war ein Mord der barbarischsten Art. Wenn ich darüber nachsinne, sehe ich den Kopf des Mannes – zerschmettert. Ich weiß, ich werde bis an mein Lebensende Albträume haben.“3
Mir selbst reichen die gefilterten, blutigen, flehenden Bilder aus den Medien. Es sind Eindrücke, die ich ebenfalls nie vergessen werde.
Auch wenn auf den ersten Blick inzwischen Ruhe eingekehrt zu sein scheint (soll heißen, dass die vielen „kleinen“ Zwischenfälle nur selten Erwähnung in den Weltnachrichten finden), so brodelt es doch kräftig unter der friedlich wirkenden Oberfläche. In den palästinensischen Autonomiegebieten ist, seitdem die israelischen Reservisten in Ramallah gelyncht wurden, keine Ruhe eingekehrt. Ebenso wird seither täglich von Bethlehem und Beit Jala aus auf die südlichen Vororte Jerusalems geschossen. Die Checkpoints an den Grenzen zwischen den PA-Gebieten und Israel werden darüber hinaus massiv attackiert, und das nicht nur mit Steinen. Jederzeit kann die Situation erneut eskalieren und Israels Sicherheitskräfte sind in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. In den arabischen Medien ruft Jassir Arafat unaufhörlich zur bewaffneten Intifada auf und sagt, er will Blut sehen (Intifada kommt aus dem Arabischen und heißt übersetzt in etwa „sich erheben, loswerden, abschütteln“). Am 13. November 2000 hat er dies erstmals vor internationalem Publikum in der Gegenwart des amtierenden UN-Generalsekretärs Kofi Annan ausgesprochen. Die geistlichen Führer des Islam fungieren als sein Echo und rufen in den Moscheen dazu auf, sich zum bewaffneten Kampf zu rüsten.
Gefahr von Terroranschlägen
Die größte Gefahr sind jedoch nicht die offen ausgetragenen Auseinandersetzungen, sondern die Terroranschläge innerhalb Israels. Die palästinensische Autonomiebehörde hat alle sich in ihren Gefängnissen befindlichen Terroristen freigelassen und somit auch ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass das ohnehin fragile friedliche Abkommen aufgekündigt ist. Verhaftet wurden seinerzeit – aufgrund des Oslo-Friedensabkommens, das diesen Schritt vorsah und festschrieb – die als Terroristen identifizierten Personen. Weltpolitisch betrachtet hat Arafat sehr viel Boden verloren, sowohl in den Beziehungen zu den USA und den westlichen Ländern als auch zu einigen arabischen Nationen. Allerdings ist der Zusammenhalt, wenn es gegen den gemeinsamen Feind Israel geht, außerordentlich stark. Aufgrund der Gefahr terroristischer Angriffe ist die Anspannung im Alltag enorm hoch, man kann sie förmlich spüren. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo ein Sprengsatz gefunden wird oder so mancher eben auch in die Luft fliegt. Das Erstaunliche an solchen Situationen ist, wie sehr Gott sein Volk schützt und sorgfältig geplante Aktionen vereitelt. Anders kann man es kaum erklären. In der Nähe des jüdischen Marktplatzes Mahaneh Yehuda in Jerusalem explodierte am 2. November 2000 eine kräftige Autobombe. „Nur“ zwei Menschen starben und „nur“ elf wurden verletzt. Eigentlich hätte die Sprengkraft viel größeren Schaden und Leid anrichten müssen.
Es war ermutigend für mich zu verfolgen, was der amtierende Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seinem Besuch in Israel gesagt hat: „Ich bin gekommen, um zu zeigen, das Israel in Deutschland einen Freund hat.“ „Wir haben die Verantwortung, uns zu Israel zu stellen.“ Freundschaft ist besonders in schweren Zeiten das wohl größte Gut, das ein Mensch, ein Volk, eine Nation sich wünschen können.
Die letzten zwei Wochen waren für BFP sehr ereignisreich. Der Direktor der Organisation wohnt in Gilo (einem Viertel im Süden Jerusalems, das täglich unter palästinensischem Beschuss steht) und wurde mehrfach gebeten, Interviews zu geben, die auch über die Grenzen Israels hinaus in Presse, Rundfunk und TV veröffentlicht wurden. Dadurch haben sich für uns viele Türen geöffnet, sowohl auf israelischer als auch auf internationaler Ebene. Vor einigen Tagen wurde er zu einem Treffen mit Repräsentanten des Büros des Ministerpräsidenten eingeladen und konnte dort detailliert die Arbeit der Organisation vorstellen. Die Regierung war erstaunt, wie positiv Christen sich zu Israel stellen, nicht nur mit Worten, sondern auch durch jahrelange Taten, und wie deutlich sie das auch in dieser konfliktreichen Zeit tun. Es berührt mich sehr zu beobachten, wie positiv diese Aussagen aufgenommen werden – gerade und besonders weil Christen hier in Israel oftmals misstrauisch beäugt werden und das Wort „Missionar“ als Schimpfwort einzustufen ist.
Die fortgesetzte Unterstützung spricht Bände
Jeden Tag kommen hilfsbedürftige Menschen in unser Verteilzentrum und meistens sind sie sehr erstaunt darüber, dass wir immer noch hier sind und unverändert unsere Hilfe leisten. So manch einer hat zum Ausdruck gebracht, dass er nicht so recht wusste, ob er sich überhaupt auf den Weg machen sollte, weil er annahm, dass wir „unseren Laden sicher dichtgemacht haben“. Unsere Anwesenheit und unveränderte Unterstützung ist eine Botschaft, die lauter spricht als Worte und die Menschen tief berührt. Ihre Dankbarkeit ist stärker als je zuvor. Sie sind überaus froh, dass sie in einer so heiklen Situation nicht einfach im Stich gelassen werden, und umso wichtiger ist es für uns, gerade jetzt hier zu sein.
Durch die veränderte Situation sind einige Volontäre allerdings abgereist. Die Arbeit hingegen hat in allen Bereichen stark zugenommen, wie man sich vorstellen kann. Seien es Anfragen zur aktuellen Situation, der Bedarf nach Hintergrundinformationen oder auch die ständige Ausweitung unserer Hilfsmaßnahmen. Die Zahl der Empfänger des wöchentlichen Nachrichtenupdates, das BFP aussendet, ist im letzten Monat förmlich explodiert, was nicht unerhebliche Mehrarbeit in der Verwaltung zur Folge hat. Auch die Zahl der jüdischen Rückkehrer, denen BFP geholfen hat, ist auf mehr als 6000 angestiegen und damit natürlich auch die Anzahl der Menschen, die bei der Integration Unterstützung benötigen. Das alles ist mit reduziertem Personal nur bedingt zu bewältigen. Es ist allerdings ermutigend zu sehen, dass Volontäre, deren Ankunft in dieser unruhigen Zeit geplant ist, auch tatsächlich kommen und ihren Einsatz nicht absagen oder verschieben.
Generell kann man sagen, dass wir alle sicher und geborgen sind. Logischerweise ist die Situation anders als in Deutschland, allerdings auch nicht so schlimm, wie es oftmals in den Nachrichten dargestellt wird. BFP hat viele Maßnahmen getroffen, um uns abzusichern, soweit es möglich ist. Ich weiß, dass Gott meine Schritte lenkt, und ich fühle mich von ihm beschützt.
Worum geht es beim Chanukkafest?
Während man sich in Deutschland auf die bevorstehende Weihnachtszeit vorbereitet, abends bei Kerzenschein, Lebkuchen und vielleicht auch Glühwein die Adventszeit genießt, gibt es hier keinerlei Anzeichen für den Winter. Es hat nur einmal kräftig geregnet, die Temperaturen sind für die Jahreszeit zu hoch und auch der Wasserspiegel des Sees Genezareth sinkt beharrlich. Genau zur selben Zeit, in der Christen gemütlich unter dem Weihnachtsbaum sitzen werden, feiern Juden Chanukka – das Lichterfest, an dem auch Jesus einst teilgenommen hat (Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 22). Die Geschichte von Chanukka ist sehr interessant und ausführlich in den Makkabäerbüchern beschrieben. Es ist ein wunderbares Zeugnis dafür, wie Gott sich zu seinem Volk stellt. In Kurzform:
Im zweiten Jahrhundert vor Christus musste Israel unter der schrecklichen Herrschaft der Griechen leiden. Ständig neue Gebote und Gesetze machten den Juden das Leben schwer. Man verbot ihnen sogar, ihre Religion auszuüben. Von nun an sollten die griechischen Götzen, die auch im Tempel aufgestellt wurden, angebetet werden. Einige Frauen und Männer wehrten sich jedoch gegen diese Gesetze, denn für sie gab es nur einen Herrn – den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Unter der Führung von Judas Makkabäus und seinen vier Brüdern besiegten sie die syrisch-griechische Dynastie der Seleukiden im Jahr 165v.Chr. im sogenannten Makkabäeraufstand. Ein Jahr später wurde auch der Tempel erobert, gereinigt, von griechischen Götzenbildnissen befreit und schließlich neu geweiht. Das Wort Chanukka heißt deshalb auch soviel wie „Neueinweihung“. Es wird überliefert, dass es damals nur noch eine winzige Menge geweihtes Öl gab, das gerade gereicht hätte, den siebenarmigen Leuchter im Tempelinneren, also das Ewige Licht, das niemals ausgehen soll, einen Tag lang brennen zu lassen. Der Prozess, um neues, geweihtes Öl herzustellen, dauerte acht Tage. Zur großen Verwunderung aller brannte das Licht mit dem wenigen vorhandenen Öl genau diese acht Tage lang.
Chanukka beginnt dieses Jahr am 22. Dezember und dauert acht Tage. Man stellt einen neunarmigen Leuchter auf. Jeder Arm repräsentiert einen Tag, an dem das vorhandene Öl im Tempelleuchter brannte. Der zusätzliche neunte Arm trägt die Dienerkerze. Am ersten Tag des Festes brennen die Dienerkerze und die erste Kerze. Jeden Tag wird dann eine weitere Kerze mit der Dienerkerze angezündet, bis alle neun Kerzen brennen. Es werden Geschenke verteilt und der Dreidl (Kreisel) gedreht, ein beliebtes Familienspiel. Die Seiten dieses Kreisels sind mit den hebräischen Anfangsbuchstaben des Satzes Ein großes Wunder ist hier geschehen verziert. Während der Feiertage isst man traditionell in Fett gebackene Lebensmittel (z.B. Berliner, Krapfen oder Kartoffelpuffer).
Das Volk Israel hat inmitten der widerwärtigsten Umstände überwunden. Die Botschaft von Chanukka lautet: Egal wie die Umstände auch aussehen – Gott vermag alles und kein Plan ist für ihn unausführbar (Hiob, Kapitel 42). Möge dieses Bewusstsein auch uns, auch heute noch Inspiration sein.
Kapitel 2 – 2001
Erschütternd neue Realitäten
2001 ist wohl vielen Menschen weltweit als das Jahr, in dem Terror eine völlig neue Dimension annahm, in Erinnerung geblieben. Plötzlich war Terror überall und nicht nur regional auf einige paraislamisch-fundamentalistische Brutstätten beschränkt. Niemand wird die Bilder des Anschlags auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 vergessen. Auch ich nicht. In Afghanistan wurden Mitarbeiter der christlichen Hilfsorganisation Shelter Now von den Taliban entführt. Unter den Entführten waren vier Deutsche, die entweder aus Braunschweig stammten oder gute Verbindung dorthin hatten; wir kannten uns persönlich. 103Tage wurden sie gefangen gehalten, ehe sie befreit werden konnten. Das sind nur zwei der Ereignisse, die mir damals tief ins Mark gefahren sind. Ich erlebte sie während meines ersten Heimataufenthaltes.
Auch in Israel wurde der Terror immer heftiger, forderte Verletzte und Tote, schlug erbarmungslos zu. Bilder, Berichte und Schicksale buchstäblich zerfetzter Menschenleben reihten sich in unvorhersehbarer Reihenfolge aneinander wie Perlen auf einer Schnur. Jede Perle eine Sammlung vergossener Tränen. Auch meiner Tränen. Hilf- und Machtlosigkeit, Angst und dann wieder innere Stärke, Gottvertrauen und Zuversicht, Freude und Leid – der ganz normale Alltag mit immer wieder heraufziehendem Terror und der Suche nach Möglichkeiten, ein sichtbares Zeichen der Freundschaft zu setzen – schärften meine Sinne und meine Intuition. Meine Augen scannten bei jedem Gang und jeder Busfahrt Gesichter und Gepäck. Meine Ohren achteten auf Länge, Entfernung und Anzahl eilig-eilender Sirenen von Rettungsfahrzeugen. Meine Intuition ließ mich Umwege gehen, Busse verpassen oder Orte verlassen, was mir möglicherweise das eine oder andere Mal das Leben gerettet hat. Plötzlich lebte ich in einer Realität, in der Terror allgegenwärtig war und geriet einige Male in Situationen, die mir vorkamen wie Inferno-Szenen aus einem Hollywood-Spielfilm. Nur – diesmal saß ich nicht im Kino und schaute mir die Actionhelden an, nein, diesmal sah, spürte und erlebte ich die Szenen leibhaftig und unmittelbar. Terror beeinflusste meine Arbeit, mein Leben, meinen Alltag, meine Freunde und Nachbarn und meine Freizeitgestaltung. Israel ist ein Land, in dem Gegensätze aufeinanderprallen. Freud und Leid, Normalität und Ausnahmezustand existieren unmittelbar nebeneinander. Ich stellte fest, dass es möglich ist, entspannt und fröhlich, aber gleichzeitig auch in Alarmbereitschaft zu sein. Inmitten des Leids ist es möglich, das Leben zu zelebrieren, zu hoffen, Hoffnung und Trost zu spenden.
Als ich Ende September von meinem Heimaturlaub nach Israel zurückgekehrt war, war dies ein anderes, ein viel schwereres Ankommen gewesen. Ich weiß noch wie heute, dass ich im Flugzeug auf der Landebahn in Tel Aviv gesessen und gedacht hatte: „Ina, du bist doch verrückt! Du riskierst hier dein Leben und deine Gesundheit! Das ist doch der blanke Wahnsinn, dreh einfach um!“ Aber das war nur die eine Stimme. Die andere sagte mir, dass es auf dem gesamten Planeten keinen wirklich sicheren Ort gibt, keinen Ort, an dem Terror und Leid nicht zuschlagen könnten, sondern dass ich im Vertrauen auf Gott durchs Leben gehen sollte. Gott ist Zuflucht und Schutz in allen Lebenslagen, an jedem Ort, in allen Dingen. Da wusste ich mit Gewissheit, dass meine Zeit und mein Dienst in Israel noch nicht zu Ende waren, sondern dass ich gerade erst am Anfang stand, Spuren der Liebe, der Barmherzigkeit und der Freundschaft im Leben anderer zu hinterlassen. Und so stieg ich aus.
>>>>>>>>>> • <<<<<<<<<<
Eine Bombe im Hausmüll
11. Januar 2001. Gegen 10





























