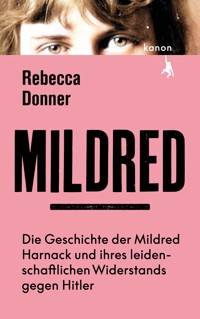
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Passion des Widerstands1929 verlässt Mildred Harnack ihre Heimat Wisconsin und zieht mit ihrem Mann Arvid, einem Cousin Dietrich Bonhoeffers, nach Berlin. Hautnah erlebt sie den Aufstieg der Nazis mit. Sie rekrutiert Arbeiter, Künstlerinnen oder Studentinnen und organisiert gemeinsam mit ihrem Mann den größten Widerstandskreis im Berliner Untergrund. Hitler verurteilt sie 1943 eigenmächtig zum Tod durch die Guillotine. Ihr letzter Trost ist ein Band mit Goethe-Gedichten, den sie in ihrer Zelle übersetzt – human und nobel bis zum Ende. Rebecca Donner verwebt Briefe, Tagebucheinträge, Augenzeugenberichte und kürzlich freigegebene Geheimdienstdokumente zu einer fulminanten und ergreifenden Erzählung des Widerstehens.Die preisgekrönte Hommage an eine mutige und fast vergessene Frau: Spannend und voller Zuneigung erzählt Rebecca Donner von ihrer Urgroßtante Mildred Harnack, die als junge Frau nach Berlin kam und leidenschaftlich gegen die Nazis kämpfte. Ihr Buch ist eine Würdigung und eine immense, eine weibliche Chronik des Widerstands.Mit zahlreichen schwarz-weißen-Dokumenten, -Abbildungen und -Fotos.• New York Times-Bestseller• Pen/Jacqueline Bograd Weld Award for Biography 2022 (Gewinner)• National Book Critics Circle Award for Biography 2022 (Gewinner)• Los Angeles Times Book Award 2022 (Finalist)• Plutarch Award 2022 (Finalist)• The Chautauqua Prize (Gewinner)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rebecca Donner
MILDRED
Die Geschichte der Mildred Harnack und ihres leidenschaftlichen Widerstands gegen Hitler
Aus dem Englischen von Laura Su Bischoff, Sabine Franke und Erich Ammereller
kanon verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2021unter dem Titel All the Frequent Troubles of Our Daysbei Little, Brown and Company, New York.
Der Verlag dankt dem Canada Council for the Arts für die Förderung der Übersetzung.
ISBN 978-3-98568-047-4
eISBN 978-3-98568-048-1
1. Auflage 2022
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2022
ALL THE FREQUENT TROUBLES OF OUR DAYS
© Rebecca Donner, 2021
First published by Little, Brown and Company
Translation rights arranged by The Clegg Agency, Inc., USA
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
Unter Verwendung eines Fotos aus Privatbesitz.
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
www.kanon-verlag.de
Für Mildred und Don
Inhalt
Anmerkung der Autorin
Fragment
Einleitung
Der Junge mit dem blauen Ranzen
MILDRED
I
Wir müssen diese Verhältnisse so schnell wie möglich ändern
Yankee Doodle Dandy
Guten Morgen, Sonne
Das BAG
II
Fragment
Reichskanzler Hitler
Zwei Nazi-Minister
Ein Flüstern, ein Nicken
Der Volksempfänger
Der Reichstagsbrand
Ein Sabotageakt
Mildreds Rekruten
Sie fallen wie die Dominosteine
Abgefackelt
Dietrich im Kampf gegen den »Arierparagraphen«
Arvid verbrennt seine eigenen Bücher
DER JUNGE
III
Amerikaner in Berlin
Nicht trödeln!
MILDRED
IV
Wie unsere Kakteen gepflegt werden müssen
Hell strahlend durchscheinend
Zwei unterschiedliche Feiern
Verwanzt
Esthonia und andere Fantasiefrauen
Arvid erhält eine Anstellung
Diebe, Betrüger, Lügner, Verräter
Rudolf Ditzen, auch bekannt als Hans Fallada
Die Nacht der langen Messer
DER JUNGE
V
Ein Molekül und andere kleine Dinge
Die Kansas-Jack-Gang
MILDRED
VI
Fragment
Eine neue Strategie
Bye-bye, Vertrag von Versailles
Tommy
Affentheater
Rindersteak-Nazi
Ein alter Kumpel aus der ARPLAN
Spione unter uns
Es wird wieder geköpft
Widerstand
Ernst und Ernst
Identitätskrise
VII
Heimkehr
Georginas große und kleine Erschütterungen
Jane ist verliebt
Mein kleines Mädchen
Ein Kreis in einem Kreis
Beinahe ein Kind
Stalin und der Zwerg
Boris’ letzter Brief
Auf der Suche nach Verbündeten
DER JUNGE
VIII
Morgenthaus Mann
Vergnügungsfahrt
Mittagessen vor der ›Kristallnacht‹
Eine ziemliche Verbesserung
Eine schicksalhafte Entscheidung
Luftangriff
Louise Heaths Tagebuch
Mamsell und Mildred und Mole
MILDRED
IX
Fragment
Foreign Excellent Trench Coats
»Korse« lässt eine Bombe platzen
Libs und Mildred zwischen Geschirr und Besteck
AGIS und andere Agitationen
Soja Iwanowna Rybkinas elfseitige Aufstellung
Stalin greift zu Obszönitäten
Hans Coppis erste Nachricht
Anatoli Gurewitsch, auch bekannt als Kent, auch bekannt als Vincente Sierra, auch bekannt als Viktor Sukulow
Alarmstufe Rot
Ein einziger Fehler
Gollnow
Ein Leid unter so vielen
Öl im Kaukasus
X
Fragment
Verhaftung
Das Fotoalbum der Gestapo
Klopf-klopf
Falk tut, was er kann
Wolfgangs siebtes Verhör
Kassiber
Die Rote Kapelle ist weder vollkommen rot noch besonders musikalisch
Anneliese und Hexenknochen
Hitlers Bluthund
Die erste von vielen Verhandlungen
Mildreds Zellengenossin
Das größte Unglück
Die Armbinde, die sie trug
Die Mannhardt-Guillotine
Zu unsres Lebens oft getrübten Tagen
Stieves Liste
Die Endlösung
Gertrud
XI
Harriettes Zorn
Walküre
Rekrutiert
Durch einen Zufall
Arvids Brief
DER JUNGE
XII
Don kehrt zurück
Danksagung
Anmerkungen
Bibliografie
Abbildungsnachweise
Register
Anmerkung der Autorin
Das Folgende habe ich mir nicht ausgedacht.
Alles, was in Anführungszeichen steht, stammt aus einem Brief, einer Postkarte, einer Autobiografie, einer handgeschriebenen Notiz, einem freigegebenen Geheimdienstbericht oder anderen von mir in einer Sammlung oder einem Nachlass aufgespürten Dokumenten.
Mildred taucht in Büchern, Zeitungsartikeln und Archivunterlagen abwechselnd als Mildred Harnack, Mildred Fish-Harnack und Mildred Harnack-Fish auf. Dieses Durcheinander geht auf Mildred selbst zurück. In den Vereinigten Staaten von Amerika nannte sie sich Mildred Fish-Harnack, in Deutschland wählte sie Mildred Harnack-Fish. Der Einfachheit halber bezeichne ich sie auf den folgenden Seiten als Mildred Harnack.
Mildred war vielen als eine Frau bekannt, die ihre Worte mit Bedacht wählte. »Über das, was wirklich ihr Herz bewegte, sprach sie wenig«, erinnerte sich eine Deutsche, und »[i]hre Äußerungen waren spröde, oft von einer überraschenden Klarheit«. »Sie hörte ruhig zu«, entsann sich eine Amerikanerin. »Wenn sie dann etwas sagte, verlangte sie Aufmerksamkeit.« Am Ende dieses Bandes finden Sie die Quellen zu diesen Äußerungen. Zur Kennzeichnung meiner Nachweise habe ich mich in diesem Werk für Endnoten statt Fußnoten entschieden.
Dieses Buch folgt zwei Erzählungen: Die eine berichtet von Mildred, die andere von einem Jungen namens Don. In Dons Kapiteln verwende ich Kursivschrift statt Zitationszeichen, um Gedanken und Gespräche zu markieren, an die er sich aus jener Zeit erinnerte. Im Zweiten Weltkrieg wurde Don im Alter von elf Jahren zu Mildreds Kurier.
Der Originaltitel dieses Werks, All the frequent troubles of our days – »Zu unsres Lebens oft getrübten Tagen« – stammt aus einem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, das Mildred in ihrer Gefängniszelle übersetzte. Es ist durchaus strittig, ob am Ende des Wortes trouble in Mildreds handschriftlicher Übersetzung ein »s« erkennbar ist oder nicht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Übersetzen eine Kunst und keine Wissenschaft ist, Mildreds Übertragungen waren oft recht locker und weniger wortwörtlich als die akademischen Bearbeitungen von Goethes Gedichten, auf die man so stoßen mag. Außerdem sollten wir bedenken, dass Mildred diese Zeilen mit einem Bleistiftstummel in einer feuchten Gefängniszelle niedergeschrieben hat.
Harald Poelchau erinnerte sich an den Anblick Mildreds, über den Band mit Goethe-Gedichten gebeugt, den Stiftstummel in der Hand, als er sie in ihrer Zelle besuchte. Poelchau war als Gefängnispfarrer tätig und als Mitglied einer geheimen Widerstandsgruppe aktiv, die in der ländlichen Ortschaft Kreisau in Schlesien gegründet worden war. Wir haben es Poelchau zu verdanken, dass uns Mildreds Goethe-Übersetzungen vorliegen. Am 16. Februar 1943 ließ er das Buch in die Falten seines Gewands gleiten und schmuggelte es hinaus.
Fragment
Fragebogen
Strafanstalt Berlin-Plötzensee
16. Februar 1943
Familienname
Harnack geb. Fish
Sämtliche Vornamen
Mildred
Tag, Monat und Jahr der Geburt
16.09.02
Geburtsort
Milwaukee, USA
Haben Sie Vermögen? Wieviel ist es und worin besteht es?
8.47 in der Tasche
1 Schiffskarte (Contract ticket) United States Lines
$127 (in Mark eingezahlt – in meiner Handtasche)
etwas Geld in der Deutschen Bank
die Wohnungseinrichtung, vor allem die Einrichtung der beiden Vorderzimmer Woyrschstr. 16, Berlin W 35, mit zwei orientalischen Teppichen, einem hellen und einem dunklen mit ungleichmäßigen Sternen und Farben
Weshalb sind Sie jetzt bestraft? Gestehen Sie die Ihnen zur Last gelegte Tat? Unter welchen Umständen und aus welcher Veranlassung haben Sie die Tat begangen?
Beihilfe zum Hochverrat
Einleitung
Ihr Ziel war Selbstauslöschung. Je unsichtbarer sie war, desto größer waren ihre Überlebenschancen. In ihrem Tagebuch zeichnete sie auf, was sie aß, dachte, las. Das Erstgenannte war harmlos. Das Zweit- und Drittgenannte waren es nicht. Deshalb versteckte sie das Journal. Als sie den Verdacht hegte, dass die Gestapo ihr dicht auf den Fersen war, vernichtete sie es. Wahrscheinlich verbrannte sie es.
Sie stand auf erschütternde Weise im Zentrum des deutschen Widerstandes, doch war sie keine Deutsche und auch keine Polin oder Französin. Sie war Amerikanerin – auffällig amerikanisch. Die von ihr angeworbenen Männer erhielten Decknamen: »Einarmiger«, »Funker«, »Arbeiter«. Sie operierte ohne eine solche Tarnung. Dennoch war sie schwer fassbar. Das Wesen ihrer Arbeit bedurfte strikter Geheimhaltung. Sie getraute sich nicht, ihrer Familie davon zu erzählen, die verstreut in den Ortschaften und auf den Milchviehbauernhöfen des Mittleren Westens lebte. Es blieb ihren Angehörigen vollkommen unbegreiflich, dass ausgerechnet sie mit sechsundzwanzig Jahren an Bord eines Dampfschiffes gestiegen war und den Atlantik überquert hatte, um all ihre Lieben zurückzulassen.
Ihre Familie ist meine Familie. Uns trennen drei Generationen. Sie bevorzugte die Anonymität, weshalb ich ihren Namen flüstern werde: Mildred Harnack.
1932 hielt sie ihr erstes Treffen in ihrer Wohnung ab – dort versammelte sich eine kleine Gruppe aus politisch Interessierter, die bis zum Ende des Jahrzehnts zur größten geheimen Widerstandsorganisation Berlins anwachsen sollte. Im Zweiten Weltkrieg kollaborierte ihr Kreis mit einem sowjetischen Spionagenetzwerk, das einen Komplott schmiedete, um Adolf Hitler zu besiegen, und dafür Agenten und Genossen in Paris, Genf, Brüssel und Berlin beschäftigte. Im Herbst 1942 schlug die Gestapo zu. Mildred wurde ins Gefängnis geworfen. Ihre Mitverschwörer ebenfalls. Während einer hastig einberufenen Verhandlung vor dem Reichskriegsgericht hämmerte ein Staatsanwalt, der sich den Spitznamen »Hitlers Bluthund« erworben hatte, mit Fragen auf sie ein.
Sie saß auf einem Holzstuhl im hinteren Teil des Gerichtssaals. Auf anderen Stühlen hatten hohe Nazifunktionäre Platz genommen. In der Mitte des Raumes thronte ein Gremium aus fünf Richtern. Bis auf Mildred waren alle Deutsche.
Als sie an der Reihe war, ging sie auf den Zeugenstand zu. Sie war ausgemergelt, ihre Lungen von der Tuberkulose angegriffen, die sie sich im Gefängnis zugezogen hatte. Wie lange sie dort stand, weiß man bis heute nicht, erhaltene Dokumente nennen den Zeitpunkt nicht, an dem der Staatsanwalt ihre Befragung begann oder zu dem er sie beendete. Bekannt ist Folgendes: Ihre Antworten waren Lügen, faustdicke Lügen.
Die Richter glaubten ihr. Sie erhielt eine verhältnismäßig milde Strafe: sechs Jahre Zwangsarbeit in einem Zuchthaus. Zwei Tage später setzte Hitler das Urteil außer Kraft und ordnete ihre Hinrichtung an. Am 16. Februar 1943 wurde sie unter ein Fallbeil geschnallt und geköpft.
Nach dem Krieg leitete das Spionageabwehrkorps der U.S. Army eine Ermittlung ein. »Mildred Harnacks Taten sind lobenswert«, merkte ein Beamter des Abwehrkorps 1946 an und wies auf die »recht ausführliche Akte« hin, die der Nachrichtendienst über sie besaß. »Es ist durchaus wahrscheinlich, dass eine Ermittlung ein Kriegsverbrechen enthüllen wird«, schrieb ein anderer. Ein Kollege höheren Ranges rügte die beiden später in einem knappen Memo: »Dieser Fall wird als S/R [secret/restricted – »Geheim/Nur für den Dienstgebrauch«] eingestuft und hätte nicht zur Ermittlung herangezogen werden dürfen. Entfernen Sie den Fall aus der Einheit ›D‹ und setzen Sie die Ermittlung nicht fort.«
Und so begrub das Spionageabwehrkorps Mildreds Fall. Der Grund dafür kam erst über fünfzig Jahre später ans Licht.
Dennoch sickerte Kunde darüber an die Öffentlichkeit durch. Am 1. Dezember 1947 erschien in der New York Times ein Artikel mit der Schlagzeile HITLER LÄSST 1943 AMERIKANERIN AUS POLITISCHER VERGELTUNG KÖPFEN. »Mit umfassendem Wissen über den untergetauchten deutschen Widerstand ausgestattet, bot Mildred Harnack mutig der Folter durch die Gestapo die Stirn und verriet gar nichts«, hieß es dort. Später in derselben Woche lobte die Washington Post Mildred als »eine der Anführerinnen des gegen die Nazis tätigen Untergrunds«. Die Leser der New York Times und der Washington Post waren wahrscheinlich überrascht, dass es einen aktiven im Geheimen operierenden Widerstand in Deutschland überhaupt gegeben hatte.
Ein grundlegendes Problem für alle, die über Mildreds Gruppe schreiben wollten, waren die fehlenden dokumentarischen Belege. Erst 1989, als die Berliner Mauer fiel, kam eine Fundgrube an Unterlagen zum Vorschein, die in den ostdeutschen Archiven lagerten. Einige Jahre später gestattete Russland Historikern einen Blick in das Ausland betreffende Geheimdienstakten, während die CIA, das FBI und die U.S. Army 1998 unter dem Nazi War Crimes Disclosure Act mit der Freigabe einst streng vertraulicher Aufzeichnungen begannen – ein Vorgang, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Inzwischen verfügen wir über ein differenzierteres Verständnis des geheimen Widerstands in Deutschland, obwohl es weiterhin Ungenauigkeiten gibt. Informationen zu Mildred Harnack sind rar und häufig falsch. Die Asche ihrer Tagebücher kann nicht zur Korrektur dienen.
Trotz ihres Wunsches, unsichtbar zu bleiben, hinterließ sie für uns eine Spur.
Auf dieser Spur finden sich offizielle Dokumente – knöcheldicke britische, US-amerikanische und sowjetische Geheimdienstordner. Dann sind da die inoffiziellen Unterlagen, die tiefere Wahrheiten offenbaren: Die Briefe, die Mildred schrieb. Die Briefe, die andere an sie und über sie schrieben. Familie und Freunde hinterließen Notizen, Kalender, Tagebücher, Fotografien, Zeugnisse. Man kann nicht behaupten, dass Einigkeit über die Frau herrschte, die diese Menschen kannten oder die sie zu kennen meinten. Für viele war sie ein Rätsel, das eine Reihe widersprüchlicher Schlussfolgerungen über ihr Wesen und ihre Beweggründe zuließ.
So gut wie alle, die ihr vertraut waren, sind inzwischen verstorben. Wer noch lebt, ist mittlerweile weit über neunzig Jahre alt. Einen von ihnen wollte ich dringender finden als jeden sonst.
Er war noch ein Kind, als er Mildred kennenlernte, jung genug, um ihr Sohn zu sein. Ich spürte ihn auf und beschwor ihn: Was hat sie Ihnen erzählt? Wie betrat sie einen Raum? Haben Sie sie weinen gehört? Singen? Hat sie Ihnen vertraut?
Der Junge mit dem blauen Ranzen
1939
Schnee. Angst. Licht. Eines Morgens im Dezember 1939 springt ein elfjähriger Junge aus der mit einem gewölbten Sturz versehenen Vordertür eines Wohnhauses in Berlin und fragt sich, ob er wohl geschnappt werden wird. Auf seinem Rücken trägt er einen blauen Ranzen. Vor ihm erstreckt sich der schneebedeckte Stadtpark Schöneberg. Er schlottert. Er hat einen wollenen Mantel und eine schwarze Kappe an. Die Kappe lässt ihn wie einen deutschen Buben aussehen.
Vier Schritte, und er ist die Treppe hinab, vier weitere, und er überquert die Straße. Der Junge ist auf dem Weg zur U-Bahn-Station. Er hat es nicht weit. Zehn Minuten Fahrt bis zum Nollendorfplatz, ein kurzer Fußweg bis zur Woyrschstraße 16. Sein Vater hat es ihm vorgemacht. Er sagte: Pass gut auf! Und: Sprich mit niemandem!
Der Junge sieht einen hochgewachsenen Mann mit Kaiser-Wilhelm-Bart, eine Frau mit Fellmütze, zwei Knaben mit roten Fäustlingen und ein im Paradeschritt marschierendes Mädchen. Bald ist Weihnachten. An den Straßenrändern stehen Händler hinter ihren Karren und läuten Glocken. In einem der Karren geröstete Kastanien. Im nächsten welker Kohl. In einem dritten Steinzeug. In einem weiteren Trupps Marzipansoldaten. Irgendwo stehen Gebäude in Flammen und gehen Bomben in die Luft. Der Junge weiß, die Kämpfe sind weit weg, doch stellt er sich vor, er kann den Krieg riechen.
Verbrannt. Wie Röstkastanien.
In jenem Monat berichten Schlagzeilen auf den Seiten der Berliner Zeitungen in schwarzen Lettern ALLE ENGLISCHEN LUFTANGRIFFE WAREN ZUM SCHEITERN VERURTEILT, beklagen eine JUDENPLAGE IN BELGIEN und versprechen DER SIEG IST UNS GEWISS! Die Zeitungen sind voller Lügen. Das weiß der Junge von seinem Vater, der die meisten seiner wachen Stunden an seinem Schreibtisch verbringt und Geheimdienstberichte schreibt, die er als Telegramm nach Washington schickt, wenn sie vertraulich sind, und als Diplomatenpost, wenn sie streng vertraulich sind. Mehrmals begleitet der Junge seinen Vater nach Bremerhaven, eine Hafenstadt an der Nordsee, wo der Vater das Diplomatengepäck einem Mann im Auslandsdienst übergibt, der dann ein Dampfschiff besteigt. Manchmal ist der Bericht in der Post an den Finanzminister Henry Morgenthau adressiert, manchmal an den Außenminister Cordell Hull.
Der Junge hebt das Kinn, sucht den Himmel ab. Deutsche Bomber. Er sieht sie nicht, weiß aber dennoch, dass sie da oben sind. Ihr Donnern lässt seine Zähne klappern, aber vielleicht ist er auch nur nervös, weil er an seine Aufgabe denkt.
Eine wichtige Aufgabe, sagte sein Vater.
Wie deine?, fragte der Junge.
Wie meine, yessir, erklärte sein Vater, der in Kansas geboren worden war und zwei Posten bekleidet, einen an der US-amerikanischen Botschaft in Berlin und einen in den Reihen eines Amtes, das keine offizielle Bezeichnung oder organisatorische Struktur besitzt, obgleich es bald unter die Schirmherrschaft eines hastig zusammengestellten Kriegsgeheimdienstes namens Office of the Coordinator of Information gestellt werden wird, dem Vorläufer dessen, was später einmal – nach einigen Durchläufen, Umbrüchen und Turbulenzen – die Central Intelligence Agency (CIA) sein wird.
In der U-Bahn-Station wartet der Junge am Bahnsteig. Der Zug fährt ein, die Türen öffnen sich weit.
Er springt hinein, findet einen Platz. Nollendorfplatz. Nur zehn Minuten entfernt.
Vor gut dreieinhalb Monaten, kurz bevor die deutsche Luftwaffe 560 Tonnen scharfer Bomben auf Polen abwarf, drängte das Außenministerium alle Männer an der amerikanischen Botschaft in Berlin, ihre Frauen und Kinder zurück nach Hause in die Vereinigten Staaten zu schicken. Der Junge und seine Mutter gingen stattdessen nach Norwegen. Sie nahmen sich ein Zimmer in einem Osloer Hotel und warteten dort auf eine Nachricht vom Vater des Jungen.
Die Nachricht kam im November, früh am Morgen. Hastig packten sie ihre Sachen.
Wo gehen wir hin?, fragte der Junge.
Zurück nach Berlin, entgegnete seine Mutter.
Warum?, wollte der Junge wissen. Krieg war im Anmarsch. Eine Rückkehr nach Berlin ergab keinen Sinn.
Wir müssen ein paar Leuten helfen, lautete die Antwort seiner Mutter.
Sie bestiegen einen Dampfzug, der sie an Bauernhöfen und Feldern und zugefrorenen Seen vorbeitrug. Schneebedeckte Berge lagen zusammengedrängt da, als würden sie sich aneinanderschmiegen, um sich zu wärmen. Der Junge legte seine Stirn ans Fenster und schaute zu, wie alles an ihm vorbeisauste, während er sich fragte Wie helfen?
Nollendorfplatz.
Der Junge schultert seinen Ranzen und steigt aus der Bahn aus, indem er behände über den Spalt zwischen Tür und Bahnsteigkante springt. Er geht die Treppen hinauf und tritt aus einer Glastür hinaus. Sobald er die U-Bahn-Station hinter sich hat, zählt er seine Schritte auf Deutsch: eins, zwei, drei. Bei zwanzig bückt er sich. Seine Schnürsenkel sind zu, aber er tut so, als wären sie offen, und bindet sie wieder zu, damit er einen Blick über seine Schulter werfen kann. Zwei Männer. Einer hat eine Glatze, der andere trägt eine Nickelbrille. Er erinnert sich an die Worte seines Vaters: Pass auf, dass keiner dir folgt!
Er überquert die Straße. An der Ecke steht ein gewaltiges Kaufhaus, das Kaufhaus des Westens. Berliner nennen es KaDeWe. Er geht hinein.
Im KaDeWe riecht es nach Parfüm und Krapfen. Es gibt sieben Stockwerke. Bald wird bei einem Luftangriff ein amerikanischer Bomber in das Gebäude fliegen und eine spektakuläre Explosion auslösen, doch im Augenblick ist das Haus ebenso intakt wie einladend. Der perfekte Ort, weiß der Junge, um jemanden loszuwerden. Er überspringt jede zweite Stufe bis in den zweiten Stock, geht an einem Karussell mit Wintermänteln vorbei, huscht in einen Aufzug, der ihn bis ganz nach oben und dann zurück hinab ins Erdgeschoss bringt, wo er das Gebäude durch einen Seiteneingang verlässt. Draußen läuft er unvermittelt los, der Ranzen schlägt an seinen Rücken.
An diesem Tag folgt ihm keiner.
Aber nehmen wir einmal an, Sie wären ihm gefolgt. Sie hätten einen elfjährigen Jungen mit einem blauen Ranzen den ganzen Weg bis zur Woyrschstraße 16 rennen sehen, ein paar Häuserzüge südlich des Tiergartens. Hätten Sie ihn gefragt, warum er in die Woyrschstraße 16 unterwegs sei, hätte er Ihnen geantwortet, dass seine Lehrerin ihn dort unterrichte. Das ist nur die halbe Wahrheit.
Er betritt das Gebäude und rast die Treppen hinauf, sein Ranzen schwer mit Büchern beladen. Ganz oben öffnet eine junge Dame in einem schlichten, für Berliner Nazifrauen typischen Kleid die Tür. Ihr honigfarbenes Haar hat sie zu einem Knoten zusammengebunden.
Sie würden nicht ahnen, dass auch sie Amerikanerin ist. Ebenso würden Sie nicht darauf kommen, dass der Ranzen des Jungen etwas Wertvolleres als Bücher enthalten wird, sobald er die Wohnung eine Stunde später wieder verlässt.
Der Junge ist ihr Kurier, wie man in der Sprache der Spionage sagt. Ein elfjähriger Spion. Zweimal die Woche besucht er die Wohnung der Frau, wo die beiden nebeneinander auf einem Sofa mit hölzernen Armlehnen sitzen und über die Werke sprechen, deren Lektüre sie ihm aufträgt. Die Bücher sind unterschiedlich und unvorhersehbar: Klassiker und Schmöker, Shakespeare und Western. Sie befragt ihn zur Handlung, zu den Figuren, den Themen. Ihre Stimme ist tief und freundlich. Sie sagt: Erzähle mir, worum es in diesem Buch geht. Sie sagt: Erkläre mir, was du denkst, nicht, was du meinst, denken zu müssen. Sie ist anders als alle Lehrer, die er je hatte.
Eine Stunde dauert ihr Unterricht, manchmal auch zwei. Ist er vorüber, fragt sie ihn: Welchen Weg nimmst du heute nach Hause? Jedes Mal geht er eine andere Strecke – dafür sorgt sie.
Sie sieht dem Jungen in die Augen, ihr Blick fest und ernst, und bittet ihn, die Straßennamen zu wiederholen. Falls er abgelenkt ist, nimmt sie seinen Kopf in ihre Hände, so wie es seine Mutter tut, und fordert ihn auf, die Namen noch einmal zu nennen.
An der Tür hilft sie ihm in seinen Mantel und lässt ein Stück Papier in seinen Ranzen gleiten. Manchmal sieht das Papier aus wie eine Leseliste. Manchmal ähnelt es einem Rezept. Manchmal schaut es aus wie ein Brief, den sie mit Mildred oder einfach nur M. unterschreibt.
MILDRED
I
Wir müssen diese Verhältnisse so schnell wie möglich ändern
1932
1.
Am 29. Juli 1932 verlässt Mildred die U-Bahn-Station und geht auf der Friedrichstraße Richtung Norden, eine Ledermappe in der Hand. Heute ist Freitag. Sie ist auf dem Weg zur Universität Berlin, wo sie zweimal die Woche Vorlesungen hält.
Sie ist zügig unterwegs. Berlin ist geschäftig, die Gehwege sind voller Fußgänger, auf den Straßen drängen sich Autos, Straßenbahnen, Busse und Fahrräder. Überall, wo sie hinblickt, sieht sie Menschen, Junge und Alte, Arme und Reiche. Vor allem Arme. Sie betteln, schlafen, streiten, verkaufen Schnürsenkel oder alte Zeitungen und lassen aus der Gosse gefischte Zigarettenstummel herumgehen.
Vor zwei Jahren hat Mildred von der Universität Berlin den Lehrauftrag für einen Kurs namens Amerikanische Literaturgeschichte erhalten. Der Institutsleiter hatte möglicherweise die Erwartung, dass sie Vorlesungen über Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts halten würde, über Herman Melville oder Nathaniel Hawthorne oder James Fenimore Cooper, doch Mildred hat kein Interesse daran, Bücher über Seemänner, Ehebrecherinnen oder Grenzsiedler zu besprechen. Sie möchte über Werke reden, die von Menschen verfasst wurden, die jetzt leben, ganz besonders solche von Autorinnen und Autoren, die über die Armut schreiben. Sie steht vor einem Raum mit deutschen Studenten und will deren Wissen über die Unterdrückten vertiefen, und das zu einer Zeit, als so viele im eigenen Land unaufhörlich um das tägliche Brot kämpfen. Seit vier Semestern spricht sie nun also über amerikanische Farmer und Fabrikarbeiter und Einwanderer, über William Faulkner und John Dos Passos und Theodore Dreiser.
Ihre politischen Ansichten verbirgt sie nicht. In ihren Vorlesungen wechselt sie fließend von amerikanischen Romanen zur gewaltigen Armut in Deutschland und dem besorgniserregenden Aufstieg der Nationalsozialistischen Partei.
»Deutschland macht solch schwere Zeiten durch«, schrieb sie kürzlich in einem Brief an ihre Mutter. »Alle spüren die Bedrohung, aber viele stecken ihren Kopf in den Sand.«
Sie erreicht eine breite Prachtstraße: Unter den Linden. Sie wendet sich nach rechts.
Der Name der Straße stammt von den Lindenbäumen, die in Hülle und Fülle an ihren Rändern wachsen und im Augenblick voll erblüht sind. Kleine weiße Blüten ergießen sich in Kaskaden und erfüllen die Luft mit ihrem Duft. Aber all diese Schönheit vermag die Hässlichkeit hier nicht zu verbergen. Hakenkreuze, wohin man sieht: auf Plakaten an den Wänden der U-Bahn-Stationen, auf Flaggen, Bannern und Pamphleten. Ein weißhaariger Mann mit Schnauzer führt im Augenblick das Land, wenn auch nur notdürftig. Reichspräsident Paul von Hindenburg ist vierundachtzig Jahre alt und torkelt in die Senilität. Ein gerade einmal halb so alter Politiker wird immer beliebter – ein Schulabbrecher namens Adolf Hitler, der, so prognostiziert Mildred, »sehr viel mehr Elend und Unterdrückung« bringen wird.
Sie biegt nach links ab. Vor ihr liegt die Universität Berlin.
Sie geht hinein. In den Fluren drängeln sich die Studenten. Sie nähert sich der Tür eines Seminarraumes, wohlwissend, dass ihre heutige Vorlesung die letzte sein wird. Ein Mitarbeiter der Universität hat sie bereits darüber informiert, dass sie im nächsten Herbst nicht zurückgebeten werden wird. Mildred kann es kaum fassen. Die ganze Zeit hat sie es für selbstverständlich gehalten, ihre Meinung frei zu äußern.
2.
In den Briefen an ihre Mutter schreibt Mildred einfach und klar, da sie sehr genau weiß, dass die zehnjährige Schulbildung von Georgina Fish nicht für die Komplexität deutscher Politik ausreicht.
Es gibt hier eine große Menge Menschen, die ein Gespür für die Ungerechtigkeit der Lage haben – ihre eigene Armut oder die Gefahr, in Armut zu geraten – und deshalb zum Schluss kommen, dass es eine gute Idee wäre, wenn es wieder eine uneingeschränktere Regierungsform gäbe, weil die Dinge vorher besser waren.
Der offizielle Parteiname der Nazis lautet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), erklärt Mildred, »obwohl die Partei nichts mit Sozialismus am Hut hat und der Name an sich schon eine Lüge ist. Sie hält sich für höchst moralisch und macht wie der Ku Klux Klan aus dem Hass auf Juden eine Kampagne.«
Mildred verfasst die meisten dieser Briefe mit einem Füller und schwarzer Tinte. Manchmal schreibt sie einen Teil in der U-Bahn auf dem Weg zum Unterricht und beendet die Briefe zu Hause an ihrer Schreibmaschine. Manchmal ist es umgekehrt, zuerst tippt sie die Briefe, schreibt sie in der U-Bahn zu Ende und entschuldigt sich dann für ihre schlampige Handschrift.
Mildred erzählt ihrer Mutter nicht sofort, dass sie ihre Anstellung bei der Universität Berlin verloren hat. Sie wird ein Weilchen warten. Vielleicht eine Woche. Vielleicht zwei. Sie möchte Georgina Fish nicht in Sorge versetzen, die in einem kleinen, braun tapezierten Zimmer auf der anderen Seite des Atlantiks lebt und dazu neigt, sich Sorgen zu machen.
3.
Gefeuert. Rausgeschmissen. Vor die Tür gesetzt.
Welche Bezeichnung man auch wählt, das Ergebnis ändert sich nicht. Der übereifrige Verwaltungsbeamte wollte keinen Grund für die Entlassung nennen. Lehraufträge werden aus unterschiedlichen Gründen bei unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten nicht verlängert.
Mildred ist neunundzwanzig Jahre alt, immer noch Doktorandin und mit ihrer Dissertation halb fertig. Ihr Plan war, bis zur Erteilung der Doktorwürde als Lektorin für Amerikanische Literaturgeschichte zu arbeiten. Und nun? Sie darf an der Universität Berlin Seminare belegen, aber selbst keine mehr geben. Einige Studenten lassen eine Petition kreisen, die von der Universität verlangt, ihre Entscheidung zu überdenken. Es nützt allerdings nichts. Das geschäftige Treiben auf den Gängen, das Geräusch der Schritte auf den Fluren, der Türknauf in der Hand, das Gefühl kalten Metalls – das alles sind Andenken an ihre Zeit hier, die sich miteinander verschworen haben, um sie daran zu erinnern, dass sie nicht mehr zurückkehren darf.
Sie öffnet die Tür zum Seminarraum und geht mit großen Schritten hinein.
Ihre Studenten, die in den Reihen vor ihr sitzen, stehen auf. So ist es an deutschen Universitäten Brauch, als Zeichen des Respekts. Als Mildred sieht, was sie mit ihrem Pult gemacht haben, wird sie von ihren Gefühlen übermannt. Er ist mit Blumen bedeckt, lavendelund goldfarbene Blüten im Überfluss, ein ganzer Berg und wunderschön. Mit feuchten Augen macht sie einen unbeholfenen Scherz.
Das ist so hoch, ich kann Ihre Gesichter ja gar nicht sehen!
4.
Nur einen Katzensprung von der Universität Berlin entfernt liegt der Opernplatz, ein großer öffentlicher Platz. Studenten mit Ledermappen voll Büchern halten sich zwischen ihren Kursen hier auf und schlendern an den großen milchkaramellfarbenen Säulen der Staatsoper vorbei. Abends bevölkern wohlhabende Opernbesucher den Platz, während Bettler in schäbiger Kleidung neben ihnen herlaufen und ihnen geöffnete Hände entgegenstrecken. Auf dem Opernplatz findet sich die gesamte deutsche Gesellschaft in konzentrierter Form.
Nächstes Jahr werden die Mitglieder einer Nazi-Burschenschaft 25.000 Bücher dort in der Mitte des Platzes auf einen gewaltigen Scheiterhaufen werfen und zu Asche verwandeln. Die Studentenverbindung wird ähnliche Bücherverbrennungen an Universitäten in ganz Deutschland abhalten und Listen mit Autorinnen und Autoren zirkulieren lassen, die als entartet, nicht rein, »undeutsch« gelten. Diese Liste wird Nobelpreisträger und unbekanntere Schriftsteller ebenso enthalten wie Philosophen und Bühnenautoren, Romanschreiber und Physiker. Werke von Juden, Christen und Atheisten werden neben Bänden von Kommunisten, Sozialisten und Anarchisten geächtet. So gut wie jedes Buch, das Mildred in den zwei Jahren ihrer Lehre an der Universität Berlin durchgenommen hat, wird in den Flammen enden.
5.
Der Reichstag – Sitz des deutschen Parlaments – ist ein Grundpfeiler der Demokratie und dient zur Gewaltenteilung mit der Exekutivgewalt des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Das Parlament steht einem schwindelerregenden Spektrum politischer Parteien offen, von den etablierten bis hin zu denen am irrwitzigen äußersten Rand.
Im Jahr 1928 erhielten die Nazis bei der Reichstagswahl weniger als 3 Prozent der Stimmen.
Im Jahr 1930 erreichten sie 18 Prozent.
Und 1932? Der Faschismus ist in Deutschland auf dem Vormarsch, doch noch scheint ein Sieg gegen ihn möglich. Es gibt sehr viel mehr linke Politiker als Nazis.
Am 31. Juli 1932 – zwei Tage nachdem die Universität Berlin Mildred vor die Tür gesetzt hat – findet die nächste Wahl statt. Wenn Mildred durch Berlin geht, sieht sie überall dort, wo die Armen und Arbeitslosen sich sammeln, Nazipropaganda: auf Plätzen, in Parks, an Bahnhöfen, in öffentlichen Toiletten. Plakate mit Hakenkreuzen versprechen »Arbeit! Freiheit! Brot!«. Hitler nutzte dieselbe Parole, als er im März zur Präsidentschaftswahl antrat und verlor. Reichspräsident Hindenburg hat gerade seine zweite siebenjährige Amtszeit begonnen. Was Hitler als Nächstes tun wird, ist unklar.
Mildred erwartet die Ergebnisse der Reichstagswahl mit wachsender Sorge. Ihre Nachbarn warten ebenfalls und versammeln sich um die Zeitungsstände, die das Karree sprenkeln.
6.
Die NSDAP erhält 37 Prozent aller Stimmen. Zum ersten Mal in der Geschichte ist sie die stärkste Kraft im Reichstag. Die Sozialdemokratische Partei liegt mit 22 Prozent weit zurück. Die Kommunistische Partei ist mit 15 Prozent sogar noch weiter abgeschlagen. Die restlichen 26 Prozent der Stimmen verteilen sich auf einen zankenden Mischmasch aus Parteien. Jeder nur denkbare Standpunkt ist vertreten. Die Parteien tragen Namen wie »Radikaler Mittelstand« oder »Reichspartei des deutschen Mittelstandes« oder »Freiheitliche National-Soziale Deutsche Mittelstandsbewegung« oder »Deutsche Bauernpartei« oder »Christlich-Sozialer Volksdienst« oder »Gerechtigkeitsbewegung für Parteienverbot – gegen Lohn-, Gehaltsund Rentenkürzungen – für Arbeitsbeschaffung« oder »Höchstgehalt der Beamten 5000 M. Für die Arbeitslosen und bis jetzt abgewiesenen Kriegsbeschädigten«.
Kurz nach dem Sieg der Nazis verlangt Hitler von Reichspräsident Hindenburg, ihn zum Reichskanzler zu ernennen. Hindenburg weigert sich.
7.
Mildred liest Mein Kampf. Hitlers Buch ist in zwei Bänden erschienen, der erste 1925, der zweite 1926. Bis 1932 haben nicht viele in Deutschland das Werk gelesen – noch nicht. Eine englische Übersetzung steht bislang gleichfalls aus. Mildred befürchtet, dass die Amerikaner nicht begreifen, wie gefährlich Hitler ist.
Die Deutschen verstehen es auch nicht. Zu viele sind daran nicht interessiert. Die meisten großen deutschen Zeitungen lehnen es ab, zum Erscheinen von Mein Kampf Rezensionen zu drucken. Ein Blatt prophezeite, Hitlers politische Karriere sei nach der Lektüre seines Gefasels »vollends […] erledigt«. Eine andere zog über die »Verirrung dieses krausen Kopfes« her. Selbst Nazis und rechte Nationalisten konnten sich Seitenhiebe nicht verkneifen. Die den Nationalsozialisten zugeneigte Deutsche Zeitung verhöhnte Hitlers »unsachliches Schimpfen«. Das nationalistische Blatt Neue Preußische Zeitung schäumte: »Man sucht nach Geist und findet nur Arroganz, man sucht nach Anregung und erntet Langeweile, man sucht nach Liebe und Begeisterung und findet Phrasen, man sucht nach gesundem Haß und findet Schimpfworte […] Ist das das Buch der Deutschen? Schlimm wäre das!« Als Hitler prahlte, ganz Deutschland erwarte sein Werk, zog die antisemitische Zeitung Das Bayerische Vaterland über Hitlers Egomanie her. »[O] wie bescheiden! warum nicht vom gesamten Weltall?«
Karikaturen verspotteten Hitler hämisch. Die beliebte Zeitschrift Simplicissimus druckte auf dem Titelblatt ein verächtliches Schmähbild Hitlers, der Mein Kampf den desinteressierten Gästen eines Bierkellers feilbietet.
In einem solchen Bierkeller in München, dem Hofbräuhaus, hatte Hitler mit dreißig Jahren eine seiner ersten wichtigen Reden gehalten. Anlass war ein am 24. Februar 1920 stattfindendes Treffen der Deutschen Arbeiterpartei gewesen, einer unbedeutenden politischen Partei mit gerade einmal 190 Mitgliedern, darunter Hitler selbst. Hitler hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft und war noch für die Armee tätig, als V-Mann für die Reichswehr. Er hielt nicht viel vom Präsidium der Deutschen Arbeiterpartei, einem zankenden Haufen Mitläufer, die einen selbstgefälligen Doktor als Erstredner auswählten.
Als der Doktor fertig war, sprang Hitler auf einen der langen Tische inmitten der Menge. Sein rhetorischer Stil war provokativ, sein Ausdruck umgangssprachlich und zuweilen vulgär. Er brüllte Beleidigungen gegen Politiker, Kapitalisten und Juden. Er verurteilte den Reichsfinanzminister aufs Schärfste, weil der den Versailler Vertrag unterstützte, ein demütigendes Zugeständnis an die Gewinner des Krieges, das die Deutschen in die Knie zwingen werde, warnte Hitler, sollten sie nicht zurückschlagen. »Unsere Parole heißt nur Kampf«, rief Hitler. Die Gäste des Brauhauses, eine quirlige Mischung aus Männern der Arbeiter- und Mittelklasse, brachen in Jubel aus – manche klatschten, andere johlten. Hitlers kontroverse Reden trieben die Teilnehmerzahlen zukünftiger Zusammenkünfte der Deutschen Arbeiterpartei in die Höhe, die bis Ende 1921 auf 3.300 Mitglieder anwuchs. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Partei sich in »Nationalsozialistische Arbeiterpartei« umbenannt, deren Anhänger den Spitznamen »Nazi« erhielten. Die Partei hatte außerdem einen neuen Vorsitzenden, Hitler selbst, der sich einen neuen Titel gab: »Führer«.
Der Simplicissimus nahm den Führer als eine Nebenfigur auf der Bühne der deutschen Politik aufs Korn. Von 1921 bis 1932 erschien er in der Zeitschrift als harmloser Idiot. Eine Karikatur von 1930 verspottete ihn als tölpelhaften Schuljungen, der Passagen aus Das Kapital abschreibt, während der Geist von Karl Marx mit ihm schimpft: »Adolf, Adolf! Gib den Sozis meine Theorien wieder!«. Ein weiteres Bild zeigte zwei Polizisten, die den gähnend leeren Inhalt von Hitlers Schädel inspizieren und ein so winziges Gehirn darin entdecken, dass sie eine Pinzette benötigen, um es hervorzuziehen.
Die Münchener Post veröffentlichte über ein Jahrzehnt lang höhnische Tiraden gegen Hitler sowie seine Bande speichelleckender Kumpane und brachte sie mit Sexskandalen und Saufgelagen in Luxushotels in Verbindung. »Hitler«, prahlte das Blatt, »hat kein Geheimnis vor uns.« Hitler behauptete, die öffentliche Aufmerksamkeit zu genießen (»Ganz gleich, ob sie über uns lachen oder schimpfen«, schrieb er in Mein Kampf, »ob sie uns als Hanswurste oder als Verbrecher hinstellen; die Hauptsache ist, daß sie uns erwähnen«), doch verärgerte ihn das Gespött der Zeitung so sehr, dass er 1923 eine Gruppe Schläger losschickte, die Räume der Münchener Post zu überfallen und alles in Reichweite zu verwüsten. Die Schläger waren Hitlers persönliche Leibgarde, der »Stoßtrupp Adolf Hitler«.
Als Hitlers Beliebtheit wuchs, schlug die Münchener Post Alarm ob seiner mörderischen Agenda. In einem Artikel mit der Schlagzeile DIE JUDEN IM DRITTEN REICH berichtete sie 1931 von einem »Geheimplan« zur »Lösung der Judenfrage«. Eine anonyme Quelle aus den Reihen der Nazis hatte eine detaillierte Auflistung aller Beschränkungen durchsickern lassen, die den Juden auferlegt werden sollten, falls die NSDAP sich durchsetzte; es gab auch das Vorhaben, »die Juden in Deutschland zum Arbeitsdienst […] zu verwenden«. In diesem Jahr, 1932, veröffentlicht die Zeitung eine Meldung über »Zelle G«, eine geheime Todesschwadron innerhalb der Nazipartei, die Hitlers Gegner ermordet. Die Journalisten bei der Münchener Post, den Lesern als Sprachrohr der Sozialdemokratischen Partei bekannt, nehmen Hitler ernst, selbst als viele andere das noch nicht tun.
8.
Auf dem Alexanderplatz beobachtet Mildred eine blutige Auseinandersetzung. Ein Zug aus schäbig gekleideten erwerbslosen Fabrikarbeitern marschiert über den Platz und ruft »Wir haben Hunger!«, während Polizeibeamte mit Schlagstöcken auf sie einprügeln. Ein Armeepanzer taucht auf – eine Bestie von Gefährt, erinnert sich Mildred später, »mit kleinen Schlitzen zum Schießen und einem Maschinengewehr, das vor und zurückschwang und die Menge ins Visier nahm«.
Der Panzer wird von Männern geführt, die der sogenannten »Schutzstaffel« angehören – oder einfach bloß SS. Sie tragen schwarze Uniformen und sind weder Teil der deutschen Polizei noch sonst irgendwie mit dem deutschen Staatsapparat verknüpft. Sie sind ein Elitekorps aus Offizieren einer privaten paramilitärischen Einheit, die der NSDAP untersteht. Diese Privatarmee – zu der auch einige der Leibwächter im Stoßtrupp gehören, der Hitler beschützte, als er Reden in Bierkellern brüllte – wächst seit Mitte der 1920er Jahre stetig an. Das Gleiche gilt für ein anderes paramilitärisches Privatheer, dessen Mitglieder braune Uniformen anziehen und umgangssprachlich als »Braunhemden« geläufig sind; formeller wird diese Armee »Sturmabteilung« oder einfach nur SA genannt. Bis 1932 ist die Zahl der SA-Männer auf erstaunliche 400.000 angewachsen. Beide paramilitärischen Einheiten sind bewaffnet und stehen jederzeit bereit, die Befehle der NSDAP auszuführen, die sich allem Anschein nach auf eine gewaltsame Revolution von rechts in Deutschland vorbereitet.
9.
Überall, wo Mildred hinschaut, erkennt sie Zeichen der Brutalität und des Leids.
Sie schreibt:
Vielen der Arbeitslosen sieht man an, dass sie von Hunger und Kälte zermürbt sind.
Und:
Tag für Tag essen sie Kartoffeln und sonst nichts.
Und:
Die Lage wird immer schlimmer.
Als sie zur U-Bahn geht, fällt ihr Blick auf eine deutsche Frau, die ungefähr im Alter ihrer eigenen Mutter zu sein scheint und die
im scharfen Wind an der Straßenecke stand. Sie trug keinen Mantel, ihre Kleidung war dünn und abgewetzt; es war mitleidserregend, wie sie versuchte, Zeitungen zu verkaufen. Jedes Mal bei einem solchen Anblick, und deren gibt es viele, denke ich Wir müssen diese Verhältnisse so schnell wie möglich ändern.
Yankee Doodle Dandy
1902–1919
1.
Mildred erblickte am 16. September 1902 das Licht der Welt. Sie wurde zu Hause geboren, im ersten Stock einer in Milwaukee gelegenen Pension mit leckendem Dach und ohne gebäudeeigene Sanitäranlagen. Sie war das vierte Kind ihrer Mutter. Georgina Fish hatte die Schwangerschaft nicht geplant. Drei Sprösslinge waren mehr als genug.
Meistens war Mildreds Vater vollkommen pleite. William Fish fand eine Anstellung als Fleischer. Er gab Salate und Mehlsäcke beim örtlichen Lebensmittelhändler aus. Er überzeugte einen Mann in der Stadt, ihn als Kaufmann für Lebensversicherungen anzuheuern. Lange behielt er diese Arbeitsstellen nie. Wenn der Reiz des Neuen abklang, reichte William kurzfristig die Kündigung ein und kehrte zu der einzigen Beschäftigung zurück, die sein Interesse zu wecken vermochte: dem Pferdehandel.
Ich sollte mal lieber nach Rustler schauen, sagte er dann zu Georgina und löste sich tage- oder manchmal sogar wochenlang in Luft auf. William brachte Rustler und seine anderen Pferde in wohlhabenden Vierteln weit weg von den Unterkünften Milwaukees unter, wo er leere Scheunen von gutbetuchten Villenbesitzern mietete, die sie nicht mehr benötigten, weil sie ihre Pferde gegen Automobile eingetauscht hatten. William hielt bis zu sechs Tiere auf einmal, um mit ihnen zu handeln und sie zu verkaufen, damit er seine Schulden begleichen konnte. Wenn die Zeiten hart waren, veräußerte er alle Pferde bis auf Rustler, den Hengst mit dem Senkrücken, für den er so schwärmte.
Sobald William die Miete nicht zusammenkratzen konnte, zog er mit seiner Familie in eine andere Pension. In den zehn Jahren vor Mildreds Geburt wechselten William, Georgina und ihre drei Kinder – Harriette, geboren 1893, und die Zwillinge Marion und Marbeau, geboren 1895 – beinahe jährlich die Wohnung.
Georgina hatte das Ganze irgendwann satt und brachte sich das Schreiben in Kurzschrift bei. Ihre zehnjährige Schulbildung sollte zur Vorbereitung auf eine Anstellung als Sekretärin vollkommen genügen, fand sie. Also trat sie in einem unauffälligen, hochgeschlossenen Kleid aus der Tür und nahm die Straßenbahn in die Stadt, wo sie für Geschäftsleute Texte eintippte und Briefe aufsetzte.
Wenn sie nach einem langen Arbeitstag nach Hause zurückkehrte, machte sie ihre Kinder durch ein Pfeifen auf sich aufmerksam. Manchmal war William da, manchmal nicht.
Als Jüngste war Mildred häufig allein. Sie streunte auf den Schotterwegen ihrer Nachbarschaft umher und wich den Straßenbahnen aus. Sie kletterte auf die höchsten Äste einer gigantischen Ulme, deren Wurzeln sich durch den Vorgarten gruben. Sie saß rittlings auf einem Ast und sang Lieder – I’m the kid that’s all the candy, I’m a Yankee Doodle Dandy –, während sie zum Takt mit den Beinen wippte. Im Winter ging sie alleine Eislaufen und borgte sich dazu Schlittschuhe von einer Nachbarin, deren Tochter an Scharlach gestorben war.
Als Mildred sieben Jahre alt war, zog ihre ältere Schwester zu Hause aus. Als der Zulassungsbescheid der Universität von Wisconsin eintraf, konnte es keiner in der Familie fassen, am wenigsten die sechzehnjährige Harriette selbst. Harriette war ein Bücherwurm mit einer Vorliebe fürs Fluchen und einer beachtlichen Intelligenz, die so gut wie allen entging, denen sie begegnete. Sie erklärte jedem in Hörweite, dass sie keinerlei akademische Ambitionen hege, sie sei hinter einem anständigen Ehemann her, einem, der kein mit Pferden handelnder Säufer sei.
2.
Im folgenden Jahr zog William mit seiner Familie in eine Herberge aus rotem Backstein, in der es nach Mäusen roch.
Zwei Jahre später wechselten sie in eine Unterkunft auf der Chestnut Street.
Ein Jahr später zogen sie auf die Twentieth Street.
Ein weiteres Jahr später zogen sie auf die Twenty-First Street.
Noch ein Jahr später zogen sie zurück auf die Twentieth Street.
Eines nasskalten Morgens, als Mildred vierzehn Jahre alt war, packte Georgina ihren Koffer. Sie hatte die Nase voll, sie wollte William verlassen. Mildreds Geschwister waren inzwischen ausgezogen: Marbeau arbeitete auf einer Farm, Marion hatte einen Mann aus Evanston, Illinois, geheiratet, und Harriette hatte an der Universität von Wisconsin einen Bachelorabschluss und einen Ehemann erlangt. Georgina und Mildred zogen nach Madison, wo Georginas Schwester ein freies Zimmer mit einem ausreichend großen Bett besaß, um Mutter und Tochter gemeinsam darin unterzubringen. William flehte seine Frau an, nach Milwaukee zurückzukehren, und versprach, er habe sich geändert, er habe jetzt einen guten Job.
Georgina wappnete sich für einen allerletzten Versuch der Aussöhnung und ging zurück. Sie fand eine einfache Bleibe auf der Prairie Street mit ein paar freien Zimmern zur Miete und meldete Mildred an der örtlichen Schule an. Innerhalb von ein paar Monaten verlor William das Interesse an seiner neuen Anstellung und häufte abermals Schulden an.
Er verschwand, dieses Mal für immer.
William verkaufte alle seine Pferde, sogar Rustler, den Hengst mit dem Senkrücken, den er so liebte. Ein paar Wochen später starb er am 7. Januar 1918 während eines der schwersten Schneestürme jenen Winters alleine in einer leeren Scheune. Ein Nachbar fand ihn zusammengesunken in seinem Stuhl, der Kohleofen eiskalt.
3.
Georgina und Mildred zogen wieder um, dieses Mal nach Chevy Chase, Maryland, wo Harriette in einem behaglichen zweistöckigen Haus auf der Brookville Road wohnte. Ihr Ehemann war ein freundlicher, bürgerlicher Anwalt namens Fred – eine merkwürdige Partie für einen fluchenden Bücherwurm, aber das war Harriette verdammt egal. Sie hatte ihren Weg gemacht.
Harriette hatte inzwischen eigene Kinder, zwei kleine Mädchen. Im Vorgarten pflanzte sie eine Ulme für die beiden, als Andenken an den gewaltigen Baum in Milwaukee, auf den Mildred so gerne geklettert war.
Mildred war sechzehn Jahre alt. Das ständige Umziehen in ihrer Kindheit hatte ihre Schulbildung durcheinandergebracht. Harriette ließ verlauten, Mildred habe – zum Teufel nochmal – nicht die geringste Chance, ans College zu kommen, wenn sie nicht auf der Stelle die bestmögliche Ausbildung erhielt. Es stand also fest: Fred würde ein paar Fäden ziehen.
Am ersten Schultag wachte Mildred in der Morgendämmerung auf, schlang hastig ihr Frühstück hinunter und eilte aus der Tür, um die Straßenbahn nach Washington, D.C., zu kriegen. Western High lag in Georgetown; ihre Klassenkameraden waren die Söhne und Töchter von Senatoren und Diplomaten. Die Kantine war eine fremde Welt aus Porzellantellern, Stoffservietten und poliertem Silber. Mildred tat ihr Bestes, um sich anzupassen. Sie trat dem Französischclub bei, obwohl ihr Französisch fürchterlich war. Sie bewarb sich beim Schwimmteam und ertrank fast. Sie schrieb sich für Basketball ein und verabscheute die Mannschaftskleidung, die aus einem Blusenkittel mit großer Schleife um den Hals und knielangen, an der Taille mit einer Kordel festgezurrten ballonförmigen Pumphosen bestand. Sie versuchte es mit Hauswirtschaft, doch war das Nähen eine blutige Angelegenheit, und sie ließ einfach alles anbrennen, was sie auf den Herd stellte. Erst als sie der Schulzeitung beitrat, entdeckte sie, wo sie wirklich hingehörte.
Wenn Mildred aus der Schule heimkam, wurde sie von Harriettes kleinen Mädchen umringt, die so neugierig waren wie Katzen. Besonders beliebt war Mildred bei der Jüngsten. Wo immer Mildred hinging, da wollte auch Janey hin. Eines Winternachmittags nahm Mildred Janey mit zum Schlittschuhlaufen. Als die beiden sich der Seemitte näherten, hörten sie ein gewaltiges Krachen und den Schrei einer Frau. Ein Junge war durchs Eis gebrochen. Das Eis um das Loch herum barst. Ein weiteres Kind brach ein. Dann noch eines und noch eines. Nun schrie nicht mehr nur die Frau – aus allen Mündern auf dem Eis ertönte ein schriller Chor des Entsetzens.
Janey brach in Tränen aus.
Beweg dich nicht!, befahl Mildred. Erst löste sie Janeys Schnürsenkel, dann die eigenen. Jetzt halt meine Hand! Zentimeter für Zentimeter schlitterten sie in Socken aufs Ufer zu, während das Eis unter ihren Sohlen splitterte und knirschte.
Guten Morgen, Sonne
1932
1.
Es ist der 1. September 1932.
In genau sieben Jahren wird der Zweite Weltkrieg beginnen.
Dieser Morgen ist im Vergleich dazu nicht gerade denkwürdig. Für Mildred fängt er wohl an wie jeder andere. Sie erwacht in ihrem einfachen Holzbett, steht auf und zieht die Vorhänge zurück, um das Tageslicht hereinzulassen. Weil die Wohnung große, breite Fester hat, gibt es davon mehr als genug, selbst im tiefsten Winter, wenn die Luft in Berlin körnig wirkt und die Konsistenz und Farbe von Kreide annimmt. Ein schmaler Flur führt ins Wohnzimmer, wo Mildred von Fenster zu Fenster geht und die Vorhänge öffnet. An den Wänden stehen Regale voll heißgeliebter Bücher. Ölgemälde von dichten Wäldern bringen Gold und Smaragdgrün in einen ansonsten schlicht eingerichteten Raum. Hier steht ein Sofa mit hölzernen Armlehnen. Dort liegen zwei ausgefranste Teppiche. Ein massiver runder Tisch, zwei robuste Stühle. Die Holzdielen sind abgenutzt, an manchen Stellen löchrig und knarren unter Mildreds Sohlen, wenn sie ans andere Ende des Zimmers geht, wo ein weißer Kachelherd steht, dessen dickes Ofenrohr bis unter die Decke reicht. Manchmal gibt es Kohle, manchmal nicht. Heute gibt es vielleicht welche. Mildred schürt die Kohlebrocken mit einer Eisenstange, damit frische Funken fliegen. Das Wasser im Kessel, den sie auf den Herd stellt, reicht für zwei Tassen Kaffee, eine für sie und eine für Arvid.
Sie macht das aus Gewohnheit. Sie ist allein, jedoch nicht mehr lange. Schon bald wird Arvid von seiner Russlandreise zurückkehren, rechtzeitig zu ihrem Geburtstag. In gut zwei Wochen wird sie dreißig Jahre alt werden – Ist es denn die Möglichkeit?
Das Frühstück ist einfach und besteht normalerweise aus nicht viel mehr als einer dicken Scheibe Brot, bestrichen mit dem, was gerade da ist – Marmelade, Butter, Senf, sie ist da nicht wählerisch. In der Mitte des Tisches stellt sie gerne eine oder zwei Blumen in ein Glas Wasser. Tulpen im Frühjahr, Flieder im Sommer, Almrosen im Herbst, Heckenkirschen im Winter. Manchmal kommen die Blumen von ihren Studenten. Manchmal sind sie von Arvid.
Er ist ein Romantiker. Diese Seite kennen andere nicht. Andere sehen einen Mann, der eine Brille mit großen runden Gläsern trägt, die ihn wie eine Eule wirken lassen, und der das Haus kaum je ohne Krawatte verlässt. (Hinter verschlossenen Türen reißt er sie freudig ab.) Andere sehen einen Mann, der stundenlang an seinem Schreibtisch sitzt. (Aber nichts liebt Arvid so sehr, wie an einem Sonntagnachmittag in den Bergen wandern zu gehen, die Gedanken schweifen zu lassen und die frische, belebende Luft einzuatmen.) Und obwohl es durchaus stimmt, dass Arvid ein Mensch ist, der die Sicherheit kalter, harter Fakten schätzt, steckt sein Kopf voller Poesie. Als Kind musste er Goethe lesen und kann nun, mit einunddreißig, lange Gedichte aus dem Kopf aufsagen, die er Mildred ins Ohr flüstert.
Die beiden haben sich an der Universität von Wisconsin kennengelernt, wo Arvid in den falschen Vorlesungssaal spaziert war. Eigentlich wollte er Professor John Commons und dessen Vorlesung über amerikanische Gewerkschaften hören, doch die Person am Pult war nicht Commons. Stattdessen stand dort Mildred, damals eine fünfundzwanzigjährige Masterstudentin. In ihrer Stunde befasste sie sich mit amerikanischer Literatur, und Arvid blieb bis zum Schluss. Dann ging er zum Pult und stellte sich vor.
Sie hatte einen Bachelor in Geisteswissenschaften und gerade ihr Masterstudium begonnen. Er hatte einen Abschluss in Rechtswissenschaft und promovierte in Philosophie. Nachdem diese Formalitäten geklärt waren, erzählte er ihr mit einer süßen, gutherzigen Förmlichkeit, die sie bis ins Herz traf, sein Elternhaus stehe in Jena, einer kleinen Universitätsstadt an der Saale in Deutschland. Sein Englisch war unbeholfen, aber ernsthaft. Wie sehr er sich von den Jungs aus dem Mittleren Westen an der UW unterschied; Jungs, die sich gegenseitig auf Maisfeldern und Footballfeldern zu Boden rangen, Jungs, die mit dem Geld prahlten, das sie dank ihres Abschlusses verdienen würden, Jungs, die mit lärmenden Scherzen um Mildreds Aufmerksamkeit buhlten – Har-dee-har-har! – und die überhaupt nicht witzig waren, zumindest fand das Mildred, und dennoch erwartete man von ihr, dass sie lächelte und errötete und mit der Hand wedelte und rief: Ach, was bist du nur für ein Schuft!
Bei ihrem zweiten Treffen brachte Arvid ihr eine Handvoll Wildblumen. Er hatte sie selbst gepflückt. »Einen großen Strauß dicker, weißer, duftender Blüten, dazwischen lilafarbene Glockenblumen«, schrieb Mildred später und erinnerte sich an jedes Detail.
Es war morgens – ein »wunderschöner« Morgen. Arvid stand auf der Veranda des zweistöckigen Hauses, in dem Mildred ein Zimmer angemietet hatte. Es lag in der Nähe des Universitätsgeländes und gehörte einem Professor, der dort mit seiner Frau und seinen beiden Kindern wohnte. Die Frau schaute hinter den Vorhängen hervor und betrachtete den blauäugigen Arvid und seine Wildblumen. Sie nahm regen Anteil an Mildreds Privatleben. Während Mildred beharrlich an ihrem Masterabschluss arbeitete, konnte die junge Dame ein wenig mütterliche Führung bestimmt gut gebrauchen, mag die Professorengattin gedacht haben, während sie darauf achtete, dass Mildred nicht durch einen falschen Mann auf Abwege geriet. Vielleicht war sie auch einfach nur neugierig. Endlich zog sie die Vorhänge zu und nickte mit aufrichtiger Zustimmung. »Männer von der Nordsee«, sagte sie, »geben sehr gute Ehemänner ab.«
Ein Ehemann – ob gut oder schlecht – war nicht, wonach Mildred suchte. Jetzt nicht. Sie erholte sich noch von einer herzzerreißenden Trennung von einem angehenden Anthropologen aus Kansas City namens Harry, trotzdem ging sie auf die Veranda hinaus und schloss die Tür hinter sich. Arvid gab ihr die Wildblumen und meinte, er hoffe, Mildred habe einen guten Morgen. Er strengte sich an, seinen deutschen Akzent weicher klingen zu lassen, und sie erkannte, dass er, bevor er an ihre Tür getreten war, viele Male geübt hatte, was er als Nächstes sagen würde. Er wolle mit ihr einen Ausflug mit dem Kanu machen, auf Lake Mendota, erklärte er, »dem großartigsten aller Seen«.
Seine zurückhaltende Galanterie gefiel ihr.
Also gut, antwortete sie ihm, gleichfalls scheu lächelnd. Sie werde mit ihm Kanu fahren.
Sechs Monate später gaben sie sich an einem Samstag unter einem improvisierten Hochzeitsbogen auf einer maroden Milchviehfarm das Jawort.
Arvid kehrte nach Deutschland zurück, um seine Doktorarbeit zu beenden. Bald würde Mildred ihm folgen, das Goucher College in Baltimore hatte ihr für das Studienjahr 1928–1929 einen Lehrauftrag für englische und amerikanische Literaturgeschichte erteilt. Wenn sie nicht beisammen waren, schrieben sie sich lange Briefe. Sie berichteten von den Büchern, die sie gerade lasen, oder umrissen ihre Pläne für die Zukunft. Beide würden eine Professur anstreben und an deutschen Universitäten lehren, vielleicht auch noch an amerikanischen Hochschulen. Mildred beendete ihre Briefe mit der Zeichnung einer Sonne. Arvid schloss seine mit derselben Sonne.
Endlich bestieg Mildred gemeinsam mit zweitausend anderen Passagieren am 2. Juni 1929 die SS Berlin und überquerte den Atlantik. Es war eine lange Reise auf windgepeitschter See. Der Atlantische Ozean ging in die Nordsee über, die kalt und unergründlich dalag. Mildred stand an Deck und schlotterte unter ihrem Mantel. Am Horizont konnte sie zwischen Himmel und Wasser Deutschland erkennen, dünn wie ein Bleistiftstrich.
Mildred schrieb sich als Doktorandin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen ein, während Arvid seiner Dissertation den letzten Schliff verlieh. An den Wochenenden gingen sie im Harz wandern, die Rucksäcke voller Bücher und belegter Brote. Arvid las seine Lieblingsgedichte von Goethe vor und Mildred ihre Lieblingsgedichte von Walt Whitman. Unter einem dichten Baldachin aus Nadelbäumen folgten sie ausgetretenen Pfaden und schlugen eigene Wege ein. Fichten, Kiefern, Tannen; Arvid konnte die Bäume anhand der Nadeln auseinanderhalten, die entweder lang oder kurz waren und locker am Zweig oder dicht wie die Borsten eines Pinsels wuchsen.
»Wir waren so glücklich miteinander«, notierte Mildred. »Er ist wie ein Weihnachtsbaum, an dem alle Kerzen leuchten.«
Es gibt Augenblicke, und an diesem Morgen mag es einen davon geben, in denen vermisst Mildred Arvid mit einer Kraft, die ihr den Atem raubt. Wahrscheinlich verspeist er jetzt gerade ebenfalls sein Frühstück, während er mit einer Gruppe an einem Tisch in Moskau sitzt, deren Name allein schon ein Zungenbrecher ist: Arbeitsgemeinschaft zum Studium der sowjetischen Planwirtschaft. (Mildred bevorzugt es, die Gruppe bei ihrem weniger sperrigen Kürzel zu nennen – ARPLAN.) Zu den Mitgliedern zählen Ökonomen, Politikwissenschaftler, Literaturkritiker, Politiker und Bühnenautoren, darunter bekennende rechte Ultranationalisten und eingefleischte Kommunisten. Unter anderen Umständen würden diese erstaunlichen Bettgenossen sich wohl nicht einmal die Hand geben, geschweige denn gemeinsam um einen Frühstückstisch herumsitzen, aber Arvid ist optimistisch – sie mögen sich in den Methoden unterscheiden, doch verbindet sie ein gemeinsames Ziel.
Deutschland steckt in der Krise. Etwas muss geschehen. Arvid hofft, durch das Studium einer anscheinend neuen wirtschaftlichen Lösung für die Sorgen der Sowjetunion ein Gegenmittel gegen die Krise im eigenen Land zu finden. Er ist Erster Sekretär der ARPLAN. Er erhält dafür kein Gehalt, aber sein Mitgefühl für die Armen in Deutschland und sein Wunsch, ein neues Wirtschaftsmodell zu entwerfen, das dieses Problem beseitigt, treiben ihn Tag und Nacht an den Schreibtisch.
In der Wohnung gibt es zwei Tische. Arvids Schreibtisch ist ausladend und groß, aus Holz geschnitzt und hat einst seinem Vater gehört. Der andere, ebenso eindrucksvoll, war einmal im Besitz seines Großvaters mütterlicherseits – Arvid nennt jenen Großvater »Großvater Reichau«. Dieser Tisch gehört nun Mildred. Eine gewaltige Tafel aus Mahagoni. Vorlesungen, Artikel, Übersetzungen, das alles verfasst sie handschriftlich und füllt Seite um Seite, bevor sie diese mit der Schreibmaschine abtippt.
Hier, an Großvater Reichaus riesigem Tisch, hängt Mildred ihren eigenen kolossalen Träumen nach. Eines Tages wird sie eine große Literaturwissenschaftlerin sein, sie wird herrliche Bücher verfassen. Der Tisch verleiht Stärke, Gewicht und Stabilität, Qualitäten, die Mildred vollkommen fremd sind. Sie selbst besitzt keine Familienerbstücke. Welche dürren Möbelstücke auch immer die engen, zugigen Zimmer ihrer Kindheit zugerümpelt haben mögen, sie hat sie schon lange hinter sich gelassen.
Mildred hält sich nicht lange mit dem Frühstück auf. Ein letzter Schluck Kaffee, und sie ist schon wieder auf den Beinen, stellt Tasse und Untertasse in die Spüle und wischt sich Krümel vom Mund. Dreckiges Geschirr wird sich dort tagelang anhäufen, bevor sie es bemerkt, ein schaukelnder Stapel aus Tellern, Tassen und Besteck. Es gibt immer Besseres zu tun als den Abwasch.
Sie trägt noch den Morgenmantel über ihrem Nachthemd und lange Strümpfe aus Walkwolle, die ihre Mutter gestrickt und in einem ordentlich verschnürten Päckchen zusammengelegt hat, das zwei Monate brauchte, um mit einem Dampfschiff über den Atlantik bis zu ihrer Wohnungstür zu gelangen. Ihre Füße berühren die knarrenden Dielen nur flüchtig – die Sohle eines Strumpfes wird dünn –, während sie zum breiten Fenster geht und es öffnet. Die Luft, frisch und knackig wie ein kalter Apfel, belebt sie. Sie wirft ihren Morgenmantel ab.
Nun beginnt sie eine Reihe Übungen, dabei folgt sie den Anweisungen aus einem Buch, das sie für ein paar Pfennige erstanden hat. »Die meisten Übungen sind auf die Stärkung der Bauchmuskulatur ausgelegt«, schrieb sie ihrer Mutter letztes Jahr, als sie ihr hastig versicherte, Arvid und sie würden »so bald wie möglich« Kinder kriegen. Die Übungen – Beinheber und Rumpfbeugen nach vorn und hinten – dauern zwanzig Minuten. Mildred ist schlank wie eine Tänzerin, wirkt aber eher angestrengt als anmutig, wenn sie mit den Armen rudert und die Beine in die Luft wirft. Ihr Nachthemd wölbt sich. Ihre bestrumpften Sohlen schlittern und rutschen über den Holzfußboden.
Nach dem Sport nimmt sie schnell ein Bad und verwendet dafür Kernseife, dann zieht sie sich um.
Obwohl im Verhältnis zum großen Ganzen der Geschichte nichts Besonderes, ist der heutige Tag für Mildred ein wichtiger Wendepunkt. Heute tritt sie ihre neue Anstellung als Lektorin am Berliner Städtischen Abendgymnasium für Erwachsene an, das kurz BAG genannt wird. Dort wird sie auf neue deutsche Schüler treffen, diese Aussicht beflügelt sie. Die Schüler werden sich von den Studenten, die sie an der Universität Berlin unterrichtete, unterscheiden – sie werden ärmer sein, vor allem aus der Arbeiterklasse stammen und in den meisten Fällen arbeitslos sein. Genau die Art von Menschen, die von den Nationalsozialisten unaufhörlich mit Propaganda bombardiert werden.
Hier sehen wir Mildred, wie sie aus der Tür schreitet, die Ledermappe in der Hand, und die vier Treppen bis zum Erdgeschoss hinabsteigt. Hier sehen wir sie auf dem Weg zur U-Bahn, die Mappe baumelt an ihrem Arm. In den Augen der Nachbarn ist sie nichts weiter als eine amerikanische Doktorandin.
2.
Früher einmal mochte Mildred die weite, offene Prärie des amerikanischen Mittleren Westens, aber inzwischen schätzt sie auch den Trubel Berlins.
Man lebt hier wie am Drehkreuz Europas. Jeden Tag rauschen zweihundertfünfzig Züge aus Nah und Fern in die fünf Bahnhöfe der Stadt ein. Wenn Mildred die kopfsteingepflasterten Straßen entlanggeht, hört sie eine Symphonie verschiedenster Sprachen – Russisch, Polnisch, Italienisch, Französisch. Die Prachtstraßen sind voller Fahrräder, Doppeldeckerbusse, elektrischer Straßenbahnen, Taxis und Automobile, die sich um die besten Plätze drängeln. Zwischen und neben den Straßen zieht sich ein verschachteltes Netz aus Wasserwegen und Kanälen hin, die sich jenseits der Stadtgrenzen bis zu der Ostsee, der Nordsee und bald auch dem Rhein erstrecken. In Berlin, so heißt es, gibt es mehr Brücken als in Venedig, mehr Statuen als in Rom und mehr Theater als in Athen. Hier wurde die erste Verkehrsampel Europas in Betrieb genommen, auf der Kreuzung am Potsdamer Platz, auf der fünf Straßen zusammenlaufen. Berlin dehnt sich weiträumig in alle Richtungen aus und ist neunmal größer als Paris, dennoch gibt es hier mehr Platz für Grünflächen und Forstanlagen als in allen anderen europäischen Metropolen. Im Zentrum der Stadt liegt der Tiergarten, eine dicht mit Bäumen bepflanzte Fläche, beinahe doppelt so groß wie der Londoner Hyde Park.
Mildred war noch nie in Italien oder Griechenland oder Frankreich und bis vor Kurzem auch nicht in London. In Milwaukee hatte sie nie ein Museum oder ein Konzert besucht, und die einzigen Theaterstücke, die sie je gesehen hatte, waren auf dem dick laminierten Boden der Sporthalle ihrer High School aufgeführt worden.
Jetzt lebt sie in einer Wohnung über einem Café voller Künstler, die sich leidenschaftlich den Ideen des Expressionismus oder Dadaismus oder Konstruktivismus oder Bauhaus oder sonstiger Bewegungen verschrieben haben, wie sie hier seit mehr als zehn Jahren aufeinanderprallen. Möchte sie ein Stück von Bertolt Brecht oder ein Musical von Kurt Weill oder ein Konzert von Arnold Schönberg oder ein Gemälde von Marc Chagall sehen, muss sie dafür nur ihre Wohnung verlassen und die vier Treppen bis zur Straße hinunter gehen, wo ein Taxi, eine Tram oder eine Bahn sie zum Theater, Konzerthaus oder zur Galerie ihrer Wahl bringen kann.
Zensur ist in Deutschland verboten. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg kam eine radikale Gruppe aus fünfundzwanzig Männern, darunter Historiker, Soziologen und Theologen (unter ihnen Arvids Onkel, Adolf von Harnack), im Deutschen Nationaltheater in Weimar zusammen, um die Weimarer Verfassung zu erarbeiten, die Männern und Frauen das Wahlrecht, das Recht auf Religionsfreiheit sowie das Recht einräumte, ihre »Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern«. Daraufhin explodierte das intellektuelle und künstlerische Leben und brachte vielfältige Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Architektur, der Malerei, der Bildhauerei, der Musik, des Films, des Theaters und der Literatur hervor.
Die Züge der U-Bahn und der S-Bahn, die Mildred nimmt, um in Berlin von A nach B zu gelangen, sind voller Deutscher mit Büchern in der Hand – Klassiker und Groschenromane oder dicke Wälzer über Geschichte und Philosophie. Auch eine breite Auswahl an Zeitungen ist zu sehen, von Klatschblättern bis hin zu Pamphleten, die ein weites Spektrum politischer Ansichten repräsentieren. Kommunistische Zeitungen wie Die Rote Fahne mischen sich mit Blättern für Sozialdemokraten (Vorwärts), konservative Deutschnationalisten (Die Deutsche Allgemeine Zeitung) und Nazis (Völkischer Beobachter).
Im Deutschen Reich erscheinen im Augenblick mehr Zeitungen als in jedem anderen industrialisierten Land. Darunter sind 4.700 Tages- und Wochenzeitungen, viele davon mit einer eigenen Morgen-, Tages- und Abendausgabe. Die Berliner Morgenpost hat die größte Auflage und wird von Ullstein herausgebracht, dem größten Verlagshaus Europas. Dieses in Berlin ansässige Unternehmen gehört einer jüdischen Familie, beschäftigt 10.000 Menschen und verwaltet Dutzende Publikationen, darunter die Berliner Allgemeine Zeitung, eine Tageszeitung für Arbeiter; das Blatt der Hausfrau, eine Zeitschrift für Hausfrauen; Die Koralle, ein Wissenschaftsmagazin; Sieben Tage, eine Zeitschrift über den Rundfunk; und Der Querschnitt, eine Kunstzeitschrift, in der Texte von Ernest Hemingway und James Joyce erscheinen.
Allein in Berlin kann man zwischen 90 Tageszeitungen wählen. Sie füllen die Zeitungsstände auf den Gehwegen, und wenn es auffrischt, flattern ihre Seiten wie Fahnen im Wind.
Wahlzettel, Berlin 1932
Deutschlands dynamische freie Presse spiegelt das Mehrparteiensystem der Weimarer Republik wider. Bei einer Wahl präsentiert sich eine schwindelerregende Vielzahl an Parteien – bis zu 62 – auf den Wahlzetteln.
Zum ersten Mal in der Geschichte ist nun eine große Bandbreite unterschiedlicher Stimmen im Reichstag zu hören. Manche dieser Stimmen sind weiblich, da Artikel 109 der Weimarer Verfassung ihnen dieselben Grundrechte und -pflichten einräumt wie Männern, darunter das Recht auf Bekleidung öffentlicher Ämter. Die Reichstagsabgeordneten werden ebenso gewählt wie der Reichspräsident.
Kaiser Wilhelm II. ist weg – der Mann, dessen Familie Deutschland seit dem 11. Jahrhundert regierte und der mit einer ganzen Reihe anderer Monarchen in ganz Europa verwandt ist, darunter Königin Victoria von England, seiner Großmutter. Wie so viele Herrscher vor ihm lebte Wilhelm II. in einem gewaltigen Schloss, doch im Gegensatz zu seinen Vorgängern, bevorzugte er einen Thron, der wie ein Kavalleriesattel geformt war und auf dem er in voller Montur mitsamt Pickelhaube saß, seinen verkrüppelten lahmen linken Arm in seinen Mantelfalten verbergend. Wilhelm II





























