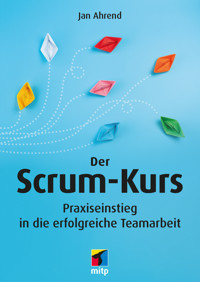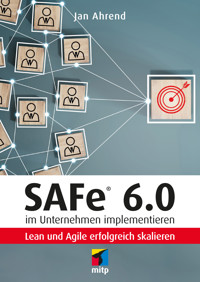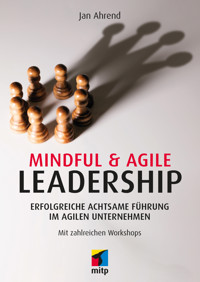
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: mitp Business
- Sprache: Deutsch
- Mitarbeiter achtsam führen und die Unternehmenskultur positiv verändern
- Coaching für mehr Achtsamkeit innerhalb des agilen Unternehmens
- Viele praktische Workshops für Konfliktlösung im Team
Der Erfolg von Agilität in einem Unternehmen hängt vom Mindset der Mitarbeiter und Führungskräfte ab. Dabei spielt Achtsamkeit eine entscheidende Rolle.
Mitarbeiter achtsam zu führen bedeutet, dass Sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen und seine Fähigkeiten fördern, nutzen und gemeinsam weiterentwickeln. Am Beispiel einer häufig vorkommenden Ausgangssituation lernen Sie, die Wirkprozesse zwischen Mindfulness und Agilität konstruktiv einzusetzen. Der Autor zeigt Ihnen, wie Sie bei den Mitarbeitern ein entsprechendes Bewusstsein schaffen, das eine wesentliche Voraussetzung für positive Veränderungen in der Unternehmenskultur ist.
Anhand eines durchgängigen und lebendig beschriebenen Praxisbeispiels für typische Herausforderungen in einer agilen Business-Umgebung lernen Sie mögliche Ansätze für das Coaching ihrer Mitarbeiter kennen. Jeweils passende Workshops liefern Ihnen Strategien und Ansätze, mit vielen kleinen Schritten die Transformation des Unternehmens weiterzuentwickeln und das Mindset der Mitarbeiter positiv zu verändern.
Der Coach und Change-Manager Jan Ahrend zeigt Ihnen praxisnah vielfältige Möglichkeiten, Achtsamkeit in Teams zu etablieren, und inspiriert Sie zum Selber-Ausprobieren. So lernen Sie, feste Muster zu durchbrechen und die Potenziale der Mitarbeiter zu fördern.
Aus dem Inhalt- Neue Techniken im Umgang mit sich selbst und den Mitarbeitern erlernen
- Praktische Übungen zu Mindfulness und Körperwahrnehmung (Embodiment)
- SCRUM oder Kanban als Grundlage für mehr Beweglichkeit in Unternehmen
- Meditation als ein Weg zu mehr Achtsamkeit in Teams
- Team-Konflikte aufspüren und auf die passende Art lösen
- Somatische Marker fördern und Unbewusstes in persönliche Ziele intergieren
- Emotion als Informationsquelle Bewusst machen und nutzen
- Resilienz im Team fördern
- Motivierende Gesprächsführung einsetzen
- Moderation von Workshops flexibel und optimal durchführen
- Verschiedene Motivationen der Mitarbeiter transparent machen
- Strategie des agilen Lernens verfolgen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Ahrend
Mindful & Agile Leadership
Erfolgreiche achtsame Führung im agilen Unternehmen
Mit zahlreichen Workshops
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-7475-0469-7 1. Auflage 2022
www.mitp.de E-Mail: [email protected] Telefon: +49 7953 / 7189 - 079 Telefax: +49 7953 / 7189 - 082
© 2022 mitp Verlags GmbH & Co. KG
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Lektorat: Katja Völpel Sprachkorrektorat: Petra Heubach-Erdmann Covergestaltung: Christian Kalkert, Sandrina Dralle Coverfoto: ronstik/adobe.stockelectronic publication: III-satz, Husby, www.drei-satz.de
Dieses Ebook verwendet das ePub-Format und ist optimiert für die Nutzung mit dem iBooks-reader auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung anderer Reader kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheherrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.
Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Einleitung
Viele Unternehmen sind dem Trend, Agilität einzuführen, gefolgt. Das Schlagwort dieser Zeit war VUCA. Es beschreibt eine Welt die zunehmend v-olatil, u-nsicher, c-omplex, a-mehrdeutig geworden ist. Die Agilität galt als die strategische Antwort auf diese Veränderungen. Die erste Welle bezog sich auf Teams. Team-Modelle wie SCRUM oder Kanban wurden eingeführt. Die Unternehmensführung und die Organisation als Ganzes wurden in dieser Phase selten verändert. Aktuell lösen die Enterprise-SCRUM-Modelle den nächsten Hype aus. Das sind Modelle wie SAFe®[1], LeSS[2] , Nexus[3], um nur die bekanntesten Vertreter zu nennen. Diese Modelle greifen in wesentlich größerem Umfang in die Organisation ein, indem sie die vorhandenen Rollen und Prozesse verändern. Diese Modelle sind noch nicht vollständig eingeführt und optimiert, da kommt schon die nächste Herausforderung auf die Unternehmen zu. Beschrieben wird sie durch das neue Kunstwort BANI. Die Welt hat sich ein Stück weitergedreht und das neue Schlagwort setzt sich zusammen aus den Begriffen:
Brittleness – Zerbrechlichkeit
Das Corona-Virus hat es uns deutlich vor Augen geführt, wie lang etablierte Wertschöpfungsketten quasi über Nacht zerbrochen sind. Einige Unternehmen mussten sofort ihren Geschäftsbetrieb aufgeben und waren auf Staatshilfe angewiesen, andere Unternehmen haben sich vor Neugeschäft kaum retten können. Halbleiter wurden weltweit Mangelware.
Anxiety – Ängstlichkeit
Die erlebte Zerbrechlichkeit der Welt löst bei den Menschen zunehmend Unsicherheit aus. Diese Unsicherheit erzeugt oft Angst. Existenzfragen werden relevant und können nicht aufgelöst werden. Auch die Klima-Katastrophe steht für viele jungen Menschen gefühlt vor der Haustür, und keiner unternimmt genug dagegen.
Non-Linearity – Nichtlinearität
Nichtlineare Phänomene bewirken, dass kleine Entscheidungen riesige Auswirkungen haben können und riesige Kraftanstrengungen gar keine Auswirkungen zeigen. Mit Werkzeugen der Expertenanalyse und der Comand&Control-Entscheidungen aus dem Top-Management kommen wir in dieser Welt nicht mehr sicher zum Ziel.
Incomprehensibility – Unverständlichkeit
Wir haben Informationen im Überfluss, doch wirklich verstehen, was passiert, können wir in bestimmten Bereichen immer weniger. Der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung liegt im Verborgenen. Wir sind gezwungen, uns jede Situation neu anzusehen, und wir können nicht mehr auf alte Erklärungsmuster zurückgreifen.
Abb. 1: Das BANI-Modell und passende Reaktionen[4]
Aus der veränderten Problemlage ergeben sich neue Lösungsrichtungen für Unternehmen.
Resilienz und Belastbarkeit werden benötigt, damit die Systeme stabiler werden und nicht versagen. Auch die Menschen, die Teil des Unternehmenssystems sind, müssen belastbarer und resilienter werden.
Empathie und Achtsamkeit werden benötigt, um gemeinsam die Ängstlichkeit zu überwinden. Die emotionale Erlebniswelt der Menschen lässt sich nicht länger ausblenden.
Komplexität und Adaptivität werden benötigt, um schnelle Anpassungen umsetzen zu können. Dies widerspricht zum Teil diametral dem Effizienzgedanken der klassischen Management-Theorie.
Die Reaktion auf Unverständlichkeit ist die Forderung nach Transparenz und Intuition. Transparenz hilft, die richtigen und wichtigen Informationen zu bekommen. Intuition ist eine Fähigkeit, die nicht auf Erfahrungen aus der Vergangenheit angewiesen ist, sondern situative Ahnungen erzeugt, was hilfreich sein könnte. Diese intuitiven Signale wahrzunehmen, sie in die Diskussion um gute Lösungen einzubringen und ernst zu nehmen, ist den westlich geprägten Menschen zum Teil sehr fremd.
Alle diese Lösungselemente beruhen zum großen Teil auf Fähigkeiten eines einzelnen Menschen. Sie beginnen beim einzelnen Menschen und nehmen dann ihren Verlauf im Unternehmen. Deshalb trägt dieses Buch den Titel »Mindful & Agile Leadership«. Es geht nicht mehr nur um agile Arbeitsmodelle, sondern es geht jetzt um die Potenziale des Menschen. Es muss gelingen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, seine Fähigkeiten zu nutzen und weiterzuentwickeln. Ganzheitlich denkende Menschen werden benötigt, die motiviert sind und sich ehrlich in ihr Team einbringen. Diese fallen jedoch nicht vom Himmel. Das Thema Mindset-Entwicklung ist eines der schwierigsten und langwierigsten. In diesem Buch werden viele konkrete Workshops aus der Praxis dargestellt, um Möglichkeiten und auch Grenzen aufzuzeigen.
Um eine häufig auftretende Ausgangsituation zu illustrieren, ist dieses Buch wie ein Trainingsplan aufgebaut. Dieses Training wird in einen Unternehmens-Kontext eingebettet, um die situative Komponente besser nachvollziehen zu können. Die daraus resultierende Geschichte ist ganz sicher kein packender Roman geworden. Er soll die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Themas und den Bezug zur Praxis verbessern. Die Geschichte und das Unternehmen sind fiktiv, aber sie enthalten viele Elemente, die wir als Berater bei unseren Kunden beobachtet haben.
Am Ende jedes Kapitels sind jeweils konkrete Workshops beschrieben, diese sind idealerweise direkt umsetzbar. Auf diese Weise soll das Thema Mindset nicht nur mithilfe guter Ideen, sondern auch mit Vorschlägen zur Anwendung vermittelt werden. Es soll zum Selber-Ausprobieren inspirieren und viele neue Möglichkeiten und Wege aufzeigen.
Die Inhalte des Buches bedienen sich eines breiten Spektrums an Hintergrundwissen aus verschiedensten Fachgebieten. Das Ziel des Buches ist es, einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten zu geben und zu Experimenten anzuregen. Es soll viele Inhalte wie ein Buffet vor dem Leser ausbreiten, damit dieser sich darin nach seiner Wahl bedienen kann.
Kapitel 1 – Transformation bzw. Agiles Change Management – Es setzt sich damit auseinander, wie der Geist der Agilität Teil der Einführung sein kann und damit eine vielschichtige Umgestaltung unter Beteiligung aller Mitarbeiter ermöglicht.
Kapitel 2 – Konflikte – Sie sind für viele Unternehmen eine Altlast, die Agilität im Keim ersticken kann. Wenn sie nicht nachhaltig und ernsthaft gelöst werden, kann Agilität nur Makulatur bleiben.
Kapitel 3 – Mindfulness – Hier wird eine sehr erfolgreiche Technik beschrieben, wie jeder Einzelne den Umgang mit sich und anderen Menschen schrittweise verändern kann. Sie hilft, die richtigen und die wichtigen Dinge zu erkennen und zu tun und die unwichtigen hinter sich zu lassen. Auf diese Weise entsteht Nähe zwischen den Menschen, und die Zusammenarbeit eines Teams verändert sich. Ein gutes Beispiel für einen sinnvollen ersten Schritt ist »Search inside Yourself«[5] von Google.
Kapitel 4 – Embodiment – Es stellt dar, wie bedeutsam es ist, sich selbst als ganzen Menschen zu erleben, einen Menschen, der Emotionen hat und diese für erfolgreiche und inspirierte Arbeit nutzen kann. Emotionen sind oft mit Körpergefühlen verbunden. Deshalb muss der Körper Teil der Wahrnehmung sein.
Es wird noch zu oft als professionell empfunden, sich im Berufsleben auf seine rationale Seite zu beschränken. Das hat in der Vergangenheit, abhängig vom jeweiligen Kontext, bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Zukunftsfähig ist diese Einstellung auf keinen Fall. Die Navigation in einem komplexen Kontext ist nur möglich, wenn wir all unsere Sinne benutzen.
Kapitel 5 – Resilienz – Vorgestellt werden alltagserprobte Muster, die Menschen dabei helfen, in Organisationen produktiv zu sein.
Der Ursprung der Resilienzforschung steht im Zusammenhang mit Krankheiten wie z.B. dem Burn-out. Ein komplett vorurteilsfreier Umgang damit gelingt noch nicht immer und überall. Daher befindet sich das Thema für viele in einer »Schmuddelecke« und ist dort auch noch nicht ganz herausgekommen. Das ist bedauerlich, weil viele gute Ansätze im Kontext dieses Themenfelds entwickelt wurden. Die Ansätze sollen hier dargestellt und verbreitet werden.
Kapitel 6 – Gemeinsam Denken – Es beschreibt Erkenntnisse, wie Organisationen die Talente vieler bündeln können, um gemeinsam mehr zu schaffen, als jeder einzeln erreichen könnte. Es gibt noch relativ viele Organisationen, die eine Atmosphäre geschaffen haben, die gegenseitige Inspiration eher behindert als fördert. Dieses Thema ist sehr eng mit der Möglichkeit von Innovationen verknüpft. In unserer arbeitsteiligen Welt sind Innovationen Teamsport geworden, und gemeinsam kreativ denken ist die Grundlage dafür.
Kapitel 7 – Agiles Lernen – soll die Brücke in die Zukunft schlagen. Peter Senge hat das Thema in seinem Buch »Lernende Organisation«[6] dargestellt. Die allermeisten Organisationen stehen vor Herausforderungen, die sich ableiten aus der Digitalisierung und der Globalisierung dieser Welt. Daraus ergeben sich Lernfelder, die Teams zukünftig nur bewältigen können, indem sie gemeinsam und dadurch schneller lernen. Hier wird ein Ansatz beschreiben, wie es funktionieren kann.
Kapitel 8 fasst noch einmal die zentralen Thesen des Buches zusammen. Wer möchte, kann dieses Kapitel auch gerne vorab lesen.
Die eingangs beschriebene illustrative Rahmenhandlung wird im ersten Kapitel erzählt. Ungeduldige Leser können einzelne Kapitel überspringen, ohne den roten Faden zu verlieren.
Dieses Buch beschreibt ein breites Spektrum an Themen. Die Konsequenz aus dem Versuch, das Thema umfassend zu beschreiben, ist, dass an der einen oder anderen Stelle die Tiefe fehlt. Um diese Tiefe zu ermöglichen, sei auf die folgenden Ergänzungen für die Leser hingewiesen, die sich in bestimmte Themen intensiver einarbeiten möchten.
Tipp für weiterführende Literatur
Kapitel 1 – Transformation
Selbststeuerung von Unternehmen: Ein Handbuch für Manager und Führungskräfte, von Alexander Exner, Campus, 2009
Micro-Inputs Veränderungscoaching: Die wichtigsten Modelle, Erklärungshilfen und Visualisierungen für das Coaching von Veränderungsprozessen, von Anna Egger, Manager Seminare, 2020
Kapitel 2 – Konflikte
Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führung, Beratung und Mediation, von Friedrich Glasl, Haupt, 2020
Selbsthilfe in Konflikten: Konzepte – Übungen – Praktische Methoden, von Friedrich Glasl, Haupt, 2007
Kapitel 3 – Mindfulness
Das weise Herz: Die universellen Prinzipien buddhistischer Psychologie, von Jack Kornfield, Arkana, 2008
Mindful Leader: Wie wir die Führung für unser Leben in die Hand nehmen und uns Gelassenheit zum Erfolg führt, von Esther Narbeshuber, O W Barth, 2019
Kapitel 4 – Embodiment
Selbstmanagement – ressourcenorientiert: Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM), von Maja Storch, Hogrefe 2017
Embodied Communication: Kommunikation beginnt im Körper, nicht im Kopf, von Maja Storch, Hogrefe, 2015
Kapitel 5 – Resilienz
Individuelles Gesundheitsmanagement: Der Leitfaden für mehr Achtsamkeit am Arbeitsplatz, von Claudia Härtl-Kasulke, Bletz, 2015
Micro-Inputs Resilienz: Lebendige Modelle, Interventionen und Visualisierungshilfen für das Resilienz-Coaching und -Training, von Ella Gabriele Amann, Manager Seminare, 2019
Kapitel 6 – Gemeinsam Denken
Dialogische Intelligenz: Aus dem Käfig des Gedachten in den Kosmos des Denkens, von Martina Hartkemeyer, Johannes Hartkemeyer, 2015
Der Dialog: Das offene Gespräch am Ende der Diskussionen, von Lee Nichol (Herausgeber), David Bohm, Klett-Cotta, 2014
Kapitel 7 – Agiles Lernen
Agiles Lernen: Neue Rollen, Kompetenzen und Methoden im Unternehmenskontext, von Nele Graf, Haufe, 2019
Neben der aufgelisteten Literatur hat sich eine weitere Form von Publikationen in diesem Bereich etabliert – Kartensets. Diese Kartensets stellen auf übersichtliche Weise eine Zusammenfassung in Kartenform dar. Sie lassen sich spielerisch in Workshops integrieren und geben vielfältige Anregungen. Im Folgenden ist eine Auswahl dargestellt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat.
Tipp: Kartensets für Workshops
Kartenset Achtsames Arbeiten, Kampel, Frank, Beltz Verlag, 2021
Kartenset Ressourcenübungen für Erwachsene, Gräßer, Hovermann, Beltz Verlag, 2019
Kartenset Online-Sessions wirkungsvoll durchführen, Claudia Härtl-Kasulke, Beltz Verlag, 2021
Kartenset Selbststärkung, Ness, Beltz Verlag, 2019
Kartenset Wondercards, Nadja Petranovskaja, Selbstverlag, 2020
Kartenset Coaching Karten Set – Ziele setzen, dranbleiben, Blockaden lösen & viele Inspirationen, David Goebel, SinnSTIFTen
Kartenset Liberating Structures Design Cards, Creative Commons License, Holisticon
Besonderer Dank bei der Erstellung dieses Buches gilt:
Steffi Triest für die Diskussion zum Konzept des Buches
Claudia Härl-Kasulke für die Diskussionen rund um Achtsamkeit und Resilienz
Rudi Ballreich und Kai Splittgerber für die gemeinsame Konzeption eines Trainings für fortgeschrittene SCRUM Master
Eggert Keller und Urte Ahrend-Keller für das Lektorat
mitp-Verlag für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
Ohne diese Unterstützung wäre das Buch in dieser Form nicht möglich gewesen, danke.
[1] https://scaledagileframework.com
[2] https://less.works/de
[3] https://www.scrum.org/resources/scaling-scrum
[4] https://stephangrabmeier.de/bani-vs-vuca/
[5] Search Inside Yourself: Optimiere dein Leben durch Achtsamkeit von Chade-Meng Tan, Goldmann, 2015
[6] Die fünfte Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation von Peter M. Senge, Schäfer Pöschel, 2017
Kapitel 1: Transformation
»So geht das alles nicht mehr«, stöhnt Bertram. Er ist der CEO der Versicherung »EINS«. Auf einmal ist der Raum so still, dass Sandy die Klimaanlage rauschen hört – ein unangenehmes Rauschen, fast bedrohlich. Irgendetwas klappert im Luftstrom. Keiner möchte der Erste sein, der jetzt etwas sagt. Die Anspannung im Meetingraum wächst mit jeder Sekunde des Schweigens. Sandy hat gerade die Ergebnisse und KPIs von ihrem agilen Programm präsentiert. Sie wusste, dass sie nicht besonders gut waren und sogar noch unter den Werten der vergangenen Wochen lagen. Mit dieser Reaktion hat sie jedoch nicht gerechnet. Sie überlegt, ob es angebracht sei, die Zahlen zu erklären und aus dem Kontext zu relativieren. In Anbetracht der Schärfe der Reaktion verwirft sie diesen Gedanken jedoch genauso schnell, wie er gekommen ist. Bertram sieht seine Mannschaft an und fährt fort: »Wir verlieren immer mehr Kunden; die operativen Kosten steigen, statt zu sinken. Von Innovationen oder Digitalisierung brauche ich da gar nicht erst anzufangen. Wenn wir so weitermachen, sind wir alle nächstes Jahr nicht mehr hier. Es geht ab jetzt an unsere Substanz. Unsere Investoren spielen nicht mehr mit. Das haben sie mehrfach angekündigt. Wir haben jetzt zwei Jahre mit vielen Investitionen Enterprise SCRUM eingeführt, und das sind die Ergebnisse, die wir haben? Noch schlechter als vorher? Das hätten wir billiger haben können.«
Frank ist der verantwortliche Manager für die Enterprise-SCRUM-Einführung. Er selbst war nie ein Fan von dem Modell, hat mit der Zeit aber ein Potenzial erkannt. »Bei den Mitarbeitern ist der Knoten noch nicht geplatzt. Sie sind sich noch unsicher, wie ernst wir es mit dem neuen Modell meinen, und sie befinden sich in einer Art Wartestellung. Ich denke, wir brauchen noch Zeit.«
Bertram ist kurz davor, endgültig die Beherrschung zu verlieren, »Durchhalteparolen wie ›Abwarten und Teetrinken‹ sind das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Ich will morgen einen Plan sehen, wie ihr das Ruder rumreißen wollt. Ich kann die Investoren nicht länger vertrösten. Alternativ müssen wir Enterprise SCRUM stoppen. Was auch immer danach kommen mag.«
Frank kannte seinen Chef schon lange, aber so hatte er ihn noch nie erlebt. Sonst war er immer eher nüchtern und abwägend. Bertram hatte sich persönlich für den Enterprise-SCRUM-Piloten eingesetzt und nach erfolgreichem Abschluss des Piloten hatte er sich für den Umbau der gesamten IT eingesetzt. Die Digitalisierung war das Kernstück seiner Strategie, mit deren Hilfe neue Investoren gewonnen werden konnten. Frank vermutet den Ursprung der aktuellen Unruhe genau aus dieser Richtung. Die Versicherung »EINS« war Marktführer in Österreich. Die Schweiz und Deutschland waren zwar existent, aber nicht wirklich groß oder erfolgreich. Nach einer erfolgreichen Digitalisierung wollte man Marktanteile in Europa gewinnen. Die »voll digitale Online-Versicherung« war das Ziel. Davon war man aktuell weiter entfernt als je zuvor. Anfangs hatte die Einführung von Enterprise SCRUM bei den Teams Begeisterung ausgelöst. Alles lief wie von selbst. Die Ergebnisse und die KPIs waren gut und machten wirklich Mut. So hätte es weitergehen müssen, tat es aber nicht. Jeder eskaliert aktuell nur noch: »Wir brauchen mehr Business-Analysten.« Dieser Satz war sozusagen das Mantra für den Misserfolg geworden. »Wenn ich keine guten Storys habe, kann ich auch nicht liefern – danke für das Gespräch.«
An diesen Assoziationen merkt Frank selbst, wie genervt er im Moment ist. Er hat jetzt einen Tag Zeit, um dieses Problem zu lösen, oder Enterprise SCRUM würde gestoppt werden. Erst wollte er alle zusammentrommeln und sich im »War-Room« einschließen. Jetzt kommt ihm das irgendwie Oldschool vor, und er besinnt sich eines Besseren. Er delegiert die Aufgabe an seine SCRUM of SCRUM Master und macht ihnen die Dringlichkeit klar. Sie sollten mit ihren SCRUM Mastern Lösungen vorschlagen, und morgen Mittag würden sie alle Ideen zusammentragen und bewerten. »Trust your team – they are giants«, hatte der agile Coach immer gesagt. Er versucht, es in diesem Augenblick zu glauben. Ein leiser Zweifel beschleicht ihn dennoch.
Am nächsten Tag kommen Frank und seine SCRUM of SCRUM Master wieder zusammen. Frank ist sehr unruhig; alle anderen sind ausgelassen und scherzen, das machte Frank noch unruhiger – sollten sie den Ernst der Lage möglicherweise nicht verstanden haben? Der erste SCRUM of SCRUM Master präsentiert seine Ergebnisse:
Mehr Unterstützung aus der Linie
Alle Interne müssen zu 100% im agilen Programm arbeiten
Schnellere Deployments
Automatisiertes Testing
Fokus auf Code-Qualität
Ablösung der Altsysteme
...
Frank merkt, wie es ihm mit Fortschreiten der Liste immer schwerer fällt, zuzuhören. Schließlich platzt es aus ihm heraus: »Habt ihr noch etwas anderes gemacht, als die Überschriften von Enterprise SCRUM in eine Liste zu kopieren? Das hatten sie alles schon seit Monaten gefordert, und idealerweise hätten sie es alle gemeinsam schon umgesetzt. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Das alles hat ein Ende, wenn uns keine Lösung einfällt. Wer hat eine Idee, die wirklich etwas Neues beschreibt?« Jetzt ist Frank nicht mehr der Einzige im Raum, der unruhig ist. Frank schaut in betretene schweigende Gesichter. Alle versuchen, seinem Blick irgendwie auszuweichen. Schließlich meldet sich Sandy, sie hätten da schon etwas Neues, aber sie sei sich nicht sicher, ob es gut passe, nämlich »Achtsamkeit«. Frank muss sich sehr zusammenreißen, um nicht endgültig die Beherrschung zu verlieren und in alte cholerische Muster zurückzufallen. Es gelingt ihm nur mit großer Anstrengung.
Sandy fährt fort. »Die ›Eins‹ hat ein Kulturproblem. Der geflügelte Satz ›Culture eats strategy for breakfest‹ trifft auf uns zu 100% zu. Wir sind schon wieder dabei, alles ganz perfekt und total verkopft anzugehen. Ich habe einen SCRUM Master auf einer Konferenz kennengelernt, der von genau demselben Phänomen berichtet hat. Dort hat man an dieser Stelle auf Kulturtransformation und Mindset-Entwicklung fokussiert. Ich kann gerne die Namen der Berater, die das Projekt umgesetzt haben, erfragen, wenn das gewünscht ist.« Frank ist sich nicht sicher, ob er die Namen haben möchte. Für ihn ist Achtsamkeit esoterisches Geschwafel – Diskussionsrunden mit Erdbeertee – ohne jede Substanz.
Irene ist SCRUM Master im Team von Sandy. Sie durchbricht als Erste das Schweigen. »Ja, das klingt seltsam, das kann ich gut verstehen, aber ich kenne das Unternehmen. Die sind alle wirklich begeistert, und sie haben jetzt auch gute Ergebnisse. Das ist wirklich mal etwas Revolutionäres, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das war das Motto der Transformation.« Die anderen SCRUM of SCRUM Master sind begeistert; ja, das hätten sie doch schon lange gefordert. Frank lässt sich breitschlagen, wenigstens mit einem Vertreter aus dem Unternehmen zu sprechen. Weitere Vorschläge sind nicht gekommen, und er ist sich nicht sicher, ob Bertram ihn in einen Zwerg verwandelt, wenn er ernsthaft Achtsamkeit als Lösung vorschlägt.
Das Telefonat mit dem Verantwortlichen des Unternehmens klingt pragmatischer und realistischer, als Frank zu hoffen gewagt hätte. Noch mehr hatte allerdings der Name des Unternehmens ihn von der Idee, diesen Vorschlag tatsächlich zu unterbreiten, überzeugt. Es war die »Bank EINS«; sie gehörte zur selben Firmengruppe und hatte immer sehr gute Zahlen. Sie wurde von der Unternehmensleitung gerne als Aushängeschild benutzt.
Frank nimmt Irene und Sandy mit zu dem Gespräch bei Bertram, um besser auf Nachfragen reagieren zu können. Sie präsentieren das vergleichbare Problem und die Lösung der »Bank EINS«. Als sie am Ende angekommen sind, sagt Bertram immer noch nichts. Er schweigt für seine Verhältnisse so lange, dass bei Frank schon erste Verzwergungsfantasien aufkommen. »Hm, ungewöhnlich, aber irgendwie schon nachvollziehbar«, meint Bertram dann schließlich. »Wir können ja den Berater mal einladen und uns anhören, was er uns vorschlägt. Könnt ihr bitte einen Termin für nächste Woche organisieren?«
Der Achtsamkeitsberater Tom ist gerne bereit, einen Termin zu machen. Jedoch möchte er nicht einfach nur eine Präsentation zeigen, sondern er will sich kurz selbst ein Bild von der Lage machen und ein, zwei Teams kennenlernen. »Was will er mit diesem Teamtreffen erreichen, was ich ihm nicht auch erzählen kann«, ärgert sich Frank. Zum Glück sind Sandy und Irene noch in der Nähe und erklären sich gerne bereit, die Teamführung für Tom zu übernehmen.
Zum vereinbarten Termin treffen sich Frank und Bertram in der Vorstandsetage. Einzig Tom und Sandy sind noch nicht da. Die ersten fünf Minuten lassen sich gut mit Themen überbrücken, die sie sowieso dringend besprechen müssen. So langsam wird Frank jedoch unruhig und blickt auf die Uhr. Endlich öffnet sich die Tür und Sandy stellt Tom vor. Er ist Brasilianer und hat einen deutlichen Akzent. Irgendwie schafft er es, fröhlich und nachdenklich zugleich zu wirken. Er entschuldigte sich für seine Verspätung und nimmt die Schuld dafür ganz auf sich. Er hat sich zu sehr mit den Teams befasst und dabei die Zeit ganz vergessen. »Die gute Nachricht ist aber, dass ich eine große Übereinstimmung mit der Situation der ›Bank EINS‹ entdeckt habe. Die Teams haben ein großes Potenzial. Die agile Reise hat ja auch gerade erst begonnen.« Während er das sagt, hat er die Präsentation angeschlossen und beginnt sich kurz vorzustellen. Bertram stellt sich und die Erwartungen der Investoren vor. Die anderen Teilnehmer des Termins habe er ja schon kennengelernt.
Abb. 1.1: Pyramide der Organisation neben den Leveln des Menschen[1]
Tom führt aus, wie das Modell Enterprise SCRUM in vielen Firmen mit einem starken Fokus auf Prozesse eingeführt wird. »Die Unternehmen fokussieren sich sehr auf die linke Seite der Grafik, den sichtbaren und leicht verstehbaren Bereich von Enterprise SCRUM. Das sind die Produkte, die Prozesse und die Tools, von denen Enterprise SCRUM reichlich zur Verfügung stellt. Dieser Fokus ist für das Erlernen eines neuen Handwerks durchaus nachvollziehbar und sinnvoll. Mit einem neuen Werkzeug muss man lernen umzugehen und dazu muss man mit Üben beginnen. Die Verwendung von externen Coaches, wie bei der Versicherung EINS geschehen, ist sehr hilfreich, um möglichst nah am Standard zu bleiben. Das ›mentale Loch‹, in das die EINS gefallen ist, ist etwas ganz Normales. Irgendwann kommt der Punkt, wo alle den Eindruck haben »jetzt haben wir es verstanden«, und der Charme des Neuen ist verflogen. Mit dem Charme des Neuen verfliegt oft auch die kindliche Begeisterung und die Neugier und die Routine kommen zurück. Das ist genau der Punkt, an dem die eigentliche Arbeit beginnt, nämlich die Arbeit an den Soft Facts, dem unsichtbaren und emotionalen Teil der Agilisierung. Der ist auf der rechten Seite der Grafik dargestellt. Jetzt kommen Fragen auf wie:
Wer bin ich als SCRUM of SCRUM Master?
Welche Werte und Normen habe ich?
Wie passen die zu Enterprise SCRUM?
Werte und Identitäten kann man nicht mit dem Jobtitel ändern, und auch eine Schulung oder ein Zertifikat helfen da nicht. Es geht um die Beweglichkeit im Kopf und um den Fokus auf den Menschen, die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Team. Beziehungen und Empathie sind der Schlüssel für diesen Teil der Arbeit. Für eine erfolgreiche Implementierung ist wichtig, dass die beiden Ebenen zusammenpassen und sich ergänzen. Es reicht nicht, alle agilen Prozesse aus Enterprise SCRUM zu implementieren. Die Menschen müssen die neuen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, auch lernen zu nutzen. Dazu müssen sie eigene Gewohnheiten und Muster ablegen. Wenn die Änderungen nur die Prozesse betreffen, bleiben die Identität und das Erleben dasselbe wie vor der Transformation, und die Kultur der Organisation ändert sich nicht in die gewünschte Richtung.
Menschen benötigen für diese Transformation sehr viel Zeit und an vielen Stellen auch Räume für neue Erfahrungen. Neue Erfahrungen sind der Schlüssel für die Veränderung. Experimentierräume werden benötigt, die die Menschen nicht nur rational schulen, sondern auch emotional bewegen. Eine Kultur lässt sich nur transformieren, wenn jeder sich auf eine innere Reise macht. Enterprise SCRUM hat durchaus Elemente, wie zum Beispiel das Growth Mindset, die in diese Richtung zielen, nur die Art der Vermittlung in einer Schulung entfaltet zu wenig Wirkung. Deshalb ist Enterprise SCRUM im Wesentlichen auf der linken Seite wirksam. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn die anfängliche Begeisterung und der Zauber des Neuen verflogen ist. Genau diese Entdeckung machen die Teams gerade.«
Agilität und Achtsamkeit gehören zusammen
»Ken Wilber hat den Zusammenhang zwischen innerem Erleben und Organisationskultur sehr gut in seinem Modell aufgezeigt.
Abb. 1.2: Agilität in den Ken-Wilber-Quadranten
Agilität wird in der Regel über die Strukturen eingeführt. SCRUM ist ein Framework, das ganz bestimmte Rollen und Prozesse benötigt. Diese werden dann erklärt und trainiert. Dies bewegt sich alles in der sichtbaren Außenwelt. Irgendwann sind dann die Strukturen verstanden und eingeübt. Die Reise ist beendet. Alle Konflikte und Widersprüche, die vorher da waren, sind immer noch da. Die Menschen sind auch noch dieselben. Wenn die Menschen vorher als Einzelkämpfer gearbeitet haben, werden sie nachher vermutlich noch dasselbe tun. Sie passen es nur in den neuen Rahmen ein. Die Kultur, die Dogmen und die Atmosphäre in der Organisation verändern sich so nicht. Da muss mehr, und vor allem etwas anderes passieren. Das wäre alles nicht wichtig, wenn Agilität nur ein Prozess wäre, den man einfach einführen kann. Das ist es aber nicht. Der Erfolg von Agilität hängt an der Beweglichkeit der Menschen in ihrem Denken und in ihrem Verhalten. Das geht sehr tief in die Persönlichkeit, jeder Mensch ist ein autonomes Wesen und entscheidet selbst, ob und wie weit er sich verändert. In diesem Bereich kann man nicht mehr anweisen oder schulen. Hier kann man nur anregen oder anbieten.«
Innere Welt und das Außen verbinden
»Die Menschen treffen selbst die Entscheidung, was sie zulassen und was nicht. Wichtig dabei ist ein Klima des Vertrauens und der Akzeptanz. Ohne das traut sich keiner, etwas anders zu machen.
Abb. 1.3: Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Struktur
Wenn ein Unternehmen beginnt, Strukturen im Außen abzubauen und beweglicher zu gestalten, ist es darauf angewiesen, dass die Menschen Strukturen und Fähigkeiten haben oder entwickeln, um die Verantwortung zu übernehmen. Die Struktur verlagert sich nach innen. Jeder Einzelne wird über den Prozess aufgerufen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Wenn er dies jedoch nicht tut, weil er es nie gelernt hat, wird sich nichts verändern. Unternehmen haben ihren Mitarbeitern über Jahrzehnte beigebracht, dass sie genau das tun sollen, was ihre Führungskräfte anweisen. Jetzt sollen sie das auf einmal nicht mehr? So schnell geht das nicht! Das Verhalten und das Vertrauen sind noch nicht gewachsen. Es braucht viel Zeit für eine innere Entwicklung, diese Verantwortung auch zu wollen und zu erleben.
Diese Entwicklung kann sehr gut durch Achtsamkeit begleitet werden. Achtsamkeit stellt den Menschen und sein Erleben in den Mittelpunkt. Das bedeutet natürlich nicht, dass Unternehmen zu Sekten werden und nur noch spirituelle Themen relevant sind. Achtsamkeit kann auf vielen Ebenen praktiziert werden. Es kommt dabei auf den Mix an, und dieser muss zur Organisationskultur passen. Das ist also für jedes Unternehmen etwas anderes. Der Suchprozess wird von vielen kleinen Experimenten begleitet und mündet in einer Reise, die sich dann Transformation der Kultur nennt.
In vielen Unternehmen wird Achtsamkeit mit Stressabbau verbunden und ist Teil des Gesundheitsprogramms. Dort wird dann MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction) geschult und ist mehr eine private Angelegenheit der Mitarbeiter und entfaltet so auch wenig bis gar keine Wirksamkeit im Bezug auf die Organisationskultur.
Wenn ich hier von Achtsamkeit spreche, meine ich mehr als ein Set von Übungen. Achtsamkeit ist ein Bewusstseinstraining. Wie stehe ich in der Welt, und wie bin ich mit mir und der Welt verbunden? Übungen können dabei helfen und stärken, sind aber nicht der Kern des Themas. Achtsamkeit ist eine Haltung. Im Unternehmenskontext gibt es viele andere wichtige und gute Ansätze, die eine ähnliche Haltung fördern. Das sind zum Beispiel Resilienz und Embodiment. Diese werden schon viel länger im Unternehmenskontext genutzt und können einfach als Ergänzung herangezogen werden.
Abb. 1.4: Themenlandkarte des Zusammenhangs zwischen Mindset und Agilität
Für die Veränderung der Unternehmenskultur ist es wichtig, die Wirkprozesse zwischen Mindfulness und Agilität zu erkennen. Da gibt es zuallererst zwei mögliche Herangehensweisen. Die eine läuft über eine Einflussnahme auf das Verhalten, die andere geht über das direkte Einwirken auf die Kultur des Unternehmens. Im Kern steht ein Thema, das alle anderen Bemühungen zunichtemachen kann, wenn es nicht konsequent gelöst wird. Das Thema heißt ›Konflikte im Unternehmen‹. Wenn es nicht gelingt, diese Konflikte nachhaltig zu lösen und konstruktiv in einen Lernprozess zu integrieren, zieht das Thema sehr viel Energie und überlagert alle anderen Themen.
Konflikte müssen nicht immer laut und sichtbar ausgetragen werden. Es gibt auch kalte Konflikte, in denen sich die Konfliktparteien einzig über die Leugnung des Konflikts einig sind. Die Wirkung von kalten Konflikten ist aber genauso schädlich wie die von heißen Konflikten.
Für eine erfolgreich gelebte Agilität ist es notwendig, dass Teams lernen, mit Konflikten selbst umzugehen, statt sie zu umgehen oder zu eskalieren. Konfliktkompetenz ist zentral, um in der Sache gemeinsam um gute Lösungen zu ringen und nicht mit faulen Kompromissen den sozialen Frieden zu wahren. Neben der Konfliktkompetenz sind es vor allem Resilienz und Embodiment, die einen großen positiven Einfluss auf die Haltung der Mitarbeiter und der Teams haben können. Beide Themen habe eine große Nähe zur Mindfulness und unterstützen diese und machen sie greifbarer. Sie wird leichter im Unternehmenskontext erlebbar.
Gemeinsames Denken und agiles Lernen sind für die gemeinsame Entwicklung von guten Lösungen hilfreich, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Die lernende Organisation ist kein neues Konzept, die Ursprünge reichen bis in die Siebzigerjahre zurück. An der Umsetzung hat es bisher immer etwas gehapert. Agilität und die selbstmotivierte Bearbeitung von vielen kleinen Lernschritten helfen hier. Die konsequente Nutzung macht für das Unternehmen einen strategischen Unterschied in Richtung der lernenden Organisation.«
Ein Portfolio aus Experimenten aufbauen
»Für die Transformation des Unternehmens sind es die Kleinteiligkeit und das experimentelle Herangehen an die Themen, die notwendig sind, um durch die Fülle und Gleichzeitigkeit der Themen zu navigieren.
Eine konsequente Sammlung von Optionen und das konsequente Design und die Auswertung von Experimenten sind entscheidend, um die Kultur in vielen kleinen Schritten in die gewünschte Richtung zu transformieren. Kultur ist nichts, was man direkt anfassen und managen kann. Sie hat ihre eigenen Gesetze, und diese liegen oft im Verborgenen. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen, Sie kennen die Praxis gut.«
Abb. 1.5: Ein Portfolio aus Experimenten erzeugen[2]
Change-Monitor der Transformation
»Die vielen kleinen Experimente und deren Status werden über ein Kanban-Board transparent gemacht und gesteuert.
Die Verantwortung für die Umsetzung der Experimente ist gut bei einer Organisationsform aufgehoben, die es in den meisten Organisationen noch nicht gibt. Es ist die Ablauforganisation. Sie kümmert sich um die konkrete Umsetzung der Wertschöpfung. Diese läuft in der Regel durch viele organisatorisch getrennte Hierarchiebereiche der Linienorganisation. Enterprise SCRUM nennt diese Organisationsform ›ein zweites Betriebssystem‹. Dieses System ist bei Enterprise SCRUM entlang der Wertströme aufgestellt und steuert die Wertschöpfung.
Abb. 1.6: Ein Portfolio aus Experimenten steuern
Abb. 1.7: Verbindung von Wertschöpfung und Hierarchie
Dieses zweite Betriebssystem lässt sich hervorragend nutzen, um auch die Transformation hin zu mehr gelebter Agilität zu steuern. Der Netzwerk-Charakter und die moderierende Führung sind deutlich besser geeignet, um die Beweglichkeit und Geschwindigkeit abbilden zu können, als eine starre hierarchische Linienorganisation. Hier werden Probleme sichtbar, und es wird an Lösungen experimentiert. Der agile Prozess ist ein guter Rahmen für das Design und für die Umsetzung von Experimenten. Der Change-Monitor führt diese dezentrale Umsetzung auf einem Board zusammen und macht es damit für alle transparent und wenn nötig steuerbar und abstimmbar.
Das war jetzt viel Theorie, die ich erklärt habe. Was ich ganz konkret bei der Bank EINS gemacht habe, war, SCRUM Master und SCRUM of SCRUM Masters wurden geschult, die Transformation der Organisation und das Mindset der Mitarbeiter mit vielen kleinen Experimenten und Workshops zu entwickeln. Manche nennen es auch Advanced SCRUM Master Training oder Mindful Agile Coaching. Diese Mitarbeiter werden dabei als Change Agents ausgebildet. Das ist der Kern der Transformation und wurde bei der Bank EINS hervorragend angenommen.«
Bertram hatte bis dahin für seine Verhältnisse sehr geduldig zugehört, jetzt kommt doch die erste Zwischenfrage »Das ist ja alles schön und gut und irgendwie auch schlüssig, aber was hat das mit Mindfulness zu tun, und vor allem, wie verbessert sich unsere Situation und Performance?«