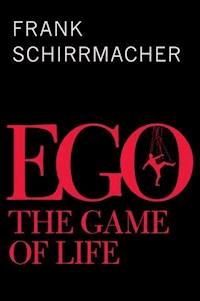14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum man Freunde gewinnen muss – und was es kostet
Unsere sozialen Beziehungen werden in den nächsten Jahrzehnten einer großen Belastung ausgesetzt: Sie werden knapp werden wie ein kostbarer Rohstoff. Schon heute bewegen sie sich in Teilen des Landes auf ein historisch nie gekanntes Minimum zu. Als Ergebnis der unumstößlichen Schrumpfung unserer Gesellschaft und aufgrund vielfältiger Globalisierungseffekte wird es eine Reduzierung unserer kleinsten Welt, der unserer Freunde und Familien geben. Diese Revolution wird sich in allen Lebensbereichen Geltung verschaffen: in der Politik wie in der Kultur, in der Wissenschaft wie im Alltag.
Wer ist da, wenn niemand mehr da ist? Jeder hat gelernt, dass er für die Zukunft vorsorgen muss. Wir sollen sparen, Geld und Vorräte anlegen. Aber kann man eigentlich Kinder sparen, die man nie geboren hat? Zu den knappen Rohstoffen der Zukunft wird etwas gehören, das man nicht sparen kann: Verwandte, Freunde, Beziehungen, kurzum das, was man soziales Kapital nennt. In den kommenden Jahren wird sich unsere Lebensweise radikal verändern. In vielen Ländern Europas wird eine wachsende Zahl von Kindern in ihrer eigenen Generation wenige oder gar keine Blutsverwandte mehr haben. Künftig sehen sich ganze Landstriche, wie heute schon Teile Ostdeutschlands, mit einer Wanderungsbewegung junger Frauen konfrontiert; zurück bleiben Männer, deren Chancen, eine Partnerin zu finden, immer geringer werden.
Frank Schirrmacher zeigt, dass unsere Gesellschaften auf diese Entwertung ihres sozialen Kapitals nicht vorbereitet sind: Der Wohlfahrtsstaat zieht sich in einem Moment als großer Ernährer zurück, in dem sich das private Versorgungsnetz aus Freundschaft, Verwandtschaft und Familie auflöst. Kann es in diesem Umfeld Uneigennützigkeit und Altruismus, selbstlose Hilfe und Unterstützung für den anderen überhaupt noch geben?
Der Zusammenbruch unserer sozialen Grundfesten zwingt uns, unser alltägliches Zusammenleben von Grund auf umzuorganisieren. Dabei werden Frauen eine alles entscheidende Rolle spielen.
"Wenn du einen Jungen erziehst, erziehst du eine Person, wenn du ein Mädchen erziehst, erziehst du eine Familie und eine ganze Gemeinschaft - ja, eine Nation."
(JAMES D. WOLFENSOHN, EHEMALIGER WELTBANKPRÄSIDENT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Frank Schirrmacher
Minimum
Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2006 by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
ISBN 978-3-641-01266-3V003
www.blessing-verlag.de
Die Männer
Es ist eiskalt. Und so weit das Auge reicht, liegt Schnee. Aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht die Landschaft aus wie ein riesiger weißer Bogen Papier, auf dem sechs abgezirkelte schwarze Kreise eingezeichnet sind. Diese Kreise markieren Lager, notdürftig errichtet von den Menschen, die hier festsitzen. Insgesamt sind es einundachtzig: mehrere große Familien, Alleinreisende und einige ortskundige Führer, die den Treck sicher durch die Sierra Nevada hätten bringen sollen. Doch nun ist Ende November 1846, und die Siedler sind am Fuße eines Berges wie festgefroren. Ohne entsprechende Ausrüstung und überwältigt von dem frühen Wintereinbruch kommen sie mit ihren Planwagen nicht mehr weiter, der Schnee blockiert den Weg nach vorne und auch den Weg zurück. Schneestürme, die sich zu Tornados auswachsen, fegen fast täglich über sie hinweg, decken ihre Habseligkeiten zu.
Jenseits der Berge, wo man vergeblich auf die Ankunft der Siedler wartet, schickt man ein Rettungsteam los. Doch es kommt nicht durch und muss umkehren. Die Retter wissen nicht, wie viel Vieh der Treck schon verloren hat, und fälschlicherweise glauben sie, die Gruppe hätte noch Vorräte für vier Monate.
Die Lage ist aussichtslos. Von einem kleinen Trupp, der einige Wochen später im Dezember ohne die Gruppe weitergezogen ist, hören die Zurückgebliebenen nichts mehr.
Margaret Reed, eine der Siedlerinnen, zermürben Hunger und Kälte so sehr, dass sie beschließt, zu Fuß über die verschneiten Berge zu fliehen. Zusammen mit ihrer dreizehnjährigen Tochter Virginia, einer Bediensteten und einem Führer macht sie sich auf; ihre drei jüngeren Kinder lässt sie bei den anderen Familien zurück. Aber neue, noch heftigere Schneestürme zwingen den kleinen Trupp schon nach wenigen Kilometern zur Umkehr.
Es ist, als wäre ein böses Märchen wahr geworden: Ein schrecklicher Bann liegt auf dem Lager – und niemand kann ihn brechen.
Heute wissen wir: Dieser Bann schmiedete die Menschen sechs Monate lang in der Eiswüste aneinander, und mit jedem Tag, der verging, näherten sie sich dem absoluten Minimum, das zum Überleben notwendig war.
Was sich zwischen ihnen abspielen wird, ist eine ziemlich schauerliche Geschichte, in der bis zum Mord kein menschliches Verbrechen ausgelassen und bis zur aufopfernden Liebe über den Tod hinaus keine menschliche Größe unverzeichnet bleibt.1
Das Schicksal dieser Menschen ist als die Tragödie vom Donner-Pass tief in das amerikanische Gedächtnis eingegraben.
Voller Optimismus hatten sich die Siedler auf den Weg gemacht, die meisten von ihnen waren wohlhabend und stammten aus Deutschland oder Österreich. Jakob Donner und sein Bruder George, die den Ereignissen ihren Namen gaben, beides reiche Landbesitzer, hatten die Spitze des Zugs gebildet. Sie waren mit Karren und Planwagen und großen Vorräten für Körper und Geist losgezogen, mit Bibel und Gesangbüchern, mit Illusionen und Träumen vom fernen Kalifornien, das irgendwo jenseits des Horizonts liegen musste.
Karte, auf der die Niederlassungen der am Donner-Pass stecken gebliebenenFamilien vermerkt sind. Gezeichnet von William Graves für C. F. McGlashan, 1879.2
»Ich sitze im Gras in der Mitte meines Zeltes«, schreibt die fünfundvierzigjährige Tamsen Donner am Tag der Abreise an ihre Schwester und verkündet: »Morgen gehen wir nach Kalifornien, in die Bucht von Francisco. Die Reise dauert vier Monate. Wir haben drei Wagen, die mit Nahrung, Kleidung und solchen Dingen gefüllt sind. Ich bin entschlossen zu gehen und bin sicher, es wird für unsere Kinder von Vorteil sein.«3
Tamsen Donner ist Lehrerin. Sie macht viele Notizen, sie plant, ein Buch über die Pflanzenvielfalt des Wilden Westens zu schreiben. Ihr Notizbuch wurde niemals gefunden. Nach allem, was ihre Mitreisenden später berichteten, wurde aus dem Buch über die verschiedenen Arten der Pflanzen bald eines über die verschiedenen Arten der Menschen in Zeiten der Not.
Man darf sich die Reisegruppe nicht als eine Bande von Glücksrittern und Goldsuchern vorstellen. Sehr viele dieser Menschen sind als Bürger und Kaufleute in ihr neues Leben aufgebrochen. Virginia Reed wird sich später daran erinnern, dass ihre Eltern nicht nur enorme Vorräte an Hausrat und Nahrung auf die Wagen geladen hatten, sondern auch eine vollständige Bibliothek, bestehend aus Werken der Weltliteratur.4
Schon lange redet niemand mehr über Bücher. Noch ehe die Siedler hier festfroren, hatten sie bemerkenswerte Höhen und vor allem Tiefen erlebt. Im Sommer hatten sie die Salzseen durchqueren müssen, und in der Hitze schmolzen die ersten Bindungen dahin, und Misstrauen wuchs. Die Abkürzung, die sie genommen hatten, erwies sich als Verhängnis, denn der Weg war kaum befahrbar. Jetzt begann die Panik. Sie mussten den Bergpass vor den ersten Schneefällen erreichen.
Am 6. Oktober 1846 fordert der Stress, dem der Treck ausgesetzt ist, sein erstes Gewaltopfer. Der junge John Snyder wird erstochen. Der Mörder wird verbannt, obgleich Ludwig Keseberg, ein Einwanderer aus Westfalen, zur Lynchjustiz ruft. Das soziale Gerippe der Reisegruppe kommt zum Vorschein und erschreckt zuallererst die Kinder.
Am 9. Oktober beginnt die Phase der angstgetriebenen Rücksichtslosigkeit: Ein ungefähr sechzig Jahre alter Mann namens Hardkoop, ein Einwanderer aus Belgien, wird von Ludwig Keseberg nach einem Streit vom Wagen gestoßen. Kein anderer nimmt ihn auf. Der Mann fällt mehr und mehr zurück. Zuletzt wird er gesehen, wie er sich einfach an den Straßenrand setzt und dort sitzen bleibt. Nicht jeder wird Zeuge des Vorfalls; einige erfahren erst abends davon. Sie entzünden ein Feuer, um den Verstoßenen ins Lager zu lotsen. Aber er bleibt verschollen. Am darauf folgenden Tag bittet Mrs. Reed mehrere Mitreisende um Pferde, sie will den alten Mann suchen. Doch jeder, den sie fragt, lehnt ab. Alle führen Gründe der Selbsterhaltung an. Die Zeit drängt, sie müssen den Gebirgspass überquert haben, ehe der Winter kommt, denn, wie alle wissen, die Schneestürme brechen ohne Gnade und Vorwarnung über das Land herein.
Verantwortungslos geworden, zieht die Gruppe weiter, es sind knapp achtzig Menschen, die keine Literatur mehr im Sinn haben und keine botanischen Studien und denen die schöngeistige Metapher von der Lebensreise plötzlich etwas voraussagt, was sie in wachsende Panik versetzt: Wenn die Reise hier endet, endet auch ihr Leben.
Und dann beginnt es zu schneien. In der Sierra Nevada, weit entfernt von jeglicher menschlicher Behausung, bleiben sie im Schneesturm stecken. Wären sie einen Tag schneller gewesen, so heißt es seither in der Literatur, hätten sie womöglich geschafft, die Wüste hinter sich zu lassen. Das ist der Augenblick, da diese Menschen ganz auf sich selbst und aufeinander angewiesen sind.
Wer sind sie? Es sind Alte und Junge. Großeltern sind dabei und Enkel, Mütter, Väter und Kinder, Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen, außerdem Junggesellen und Einzelgänger. Auffallend ist die hohe Zahl allein reisender Männer. Es sind insgesamt fünfzehn, alle zwischen zwanzig und vierzig Jahre alt. Sie sind stark, selbstbewusst und vertraut mit den Gefahren des Wilden Westens. Wenn es irgendwo Wagehälse, Glücksritter und Goldsucher gibt, dann findet man sie unter ihnen. Es gibt aber auch das achtjährige Mädchen, das es schafft, seine kleine Holzpuppe bis zuletzt in den Kleidern zu verstecken, um sie so vor dem Verfeuern zu retten; den fünfundsechzigjährigen George Donner, der den Ereignissen ihren Namen gegeben hat, und seine Ehefrau, Tamsen. Sie wird im Verlauf dieser Geschichte eine wichtige, manche sagen: eine heroische Rolle spielen. Tamsen Donner nämlich wird zeigen, dass ein Mensch bis über den Tod hinaus zu einem anderen Menschen halten kann.
Man sieht: Mit Blick auf Verwandtschaftsgrad, Alter, Geschlecht, Status und Charakter bestehen zwischen diesen Menschen fast alle erdenklichen sozialen und verwandtschaftlichen Querverbindungen. Von der Ferne betrachtet, von dort, wo man nur die weiße Fläche und die markierten Lager erkennt, wirkt das Ganze wie der Mikrochip einer Gesellschaft – ein Prozessor, der Schicksale verarbeitet -, und jeder von uns hätte dabei gewesen sein können.
Geschichten sind Rollenspiele. Auch auf dem Donner-Pass wurden solche Spiele ausgetragen. Virginia Reed, wie erstorben von der Langeweile des Ausharrens im Eis, hatte ihre Bücher wieder und wieder gelesen. Doch jedes dieser Bücher wurde verbrannt, am Schluss blieb ihr nur ein Roman, den sie, wie sie später erzählte, wie eine Rolle nachspielte: Es war eine Art Robinson-Crusoe-Roman, der die Geschichte des Überlebens eines starken und selbstbewussten Helden in der Wildnis erzählte.5
Spielen auch wir ein Rollenspiel. Wer mitspielt, kann sich nicht nur in eine fremde Welt hineinträumen, sondern auch eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung mit dem Schicksal aufstellen.
Wählen wir die Person, unseren selbstbewussten Helden oder unsere Heldin, in deren Haut wir schlüpfen wollen – eine Person, von der wir glauben, dass sie die Kälte und den Hunger am Donner-Pass durchsteht. Doch Vorsicht bei der Wahl: Am Ende dieser Geschichte werden vierzig Menschen gestorben sein.
Was müsste man tun, um dort zu überleben? Oder bescheidener: Was müsste man tun, um möglichst lange am Leben zu bleiben? Auf wen kann man in einer Gemeinschaft 6 bauen? Wer müsste man sein?
Die Erlebnisse der Schicksalsgemeinschaft am Donner-Pass geben auf jede dieser Fragen Auskunft.
Wissenschaftler fast aller Fakultäten haben sich mit der Tragödie in der Sierra Nevada befasst. Schriften wurden ausgewertet, Stammbäume erforscht und sogar Ausgrabungen durchgeführt. Aber nur einer, der Anthropologe Donald Grayson, beschäftigte sich mit der Frage, die unserem Rollenspiel zugrunde liegt.7 Keiner vor ihm hatte sie bisher gestellt, vielleicht weil keiner mit einer Antwort gerechnet hatte. »Was erfahren wir«, fragte Grayson, »wenn wir dieses schreckliche Erlebnis nicht als Historie, sondern als biologischen Vorgang deuten?«
Wer überlebt? Die meisten Menschen tippen bei der Beantwortung dieser Frage auf die Gruppe der fünfzehn erwachsenen, starken, unabhängigen und allein reisenden Männer.
Der Held – er erscheint im klassischen Repertoire unserer Kultur stets in Gestalt des Einzelkämpfers. Die Heldenmythologie, unsere Erziehung und die Klischees und Stereotype in der Gesellschaft haben in uns die Vorstellung geweckt, dass der Einzelkämpfer Krisen am besten meistern kann; gleichgültig, ob vor hundertsechzig Jahren im Winter in der Schneewüste oder heute bei einer Autopanne in den Bergen. Gerade die Unabhängigkeit erscheint uns als seine Stärke; Verantwortung für andere übernehmen zu müssen schwächt ihn. Der Held, so das Idealbild, findet irgendwann die junge, fortpflanzungsfähige Frau und schlägt sich fortan gemeinsam mit ihr durchs Leben – natürlich erfolgreich. Der Held ist, wie in Virginia Reeds letztem Buch, der Herrscher über das Schicksal, ein Macher, der kleine Mädchen zum Staunen bringt.
Die Ereignisse am Donner-Pass allerdings verliefen ganz anders. Noch ehe die Siedlergruppe überhaupt vom Schnee überrascht wurde, waren schon vier dieser hoffnungsvollen, kräftigen Männer tot. Der fünfundzwanzigjährige Luke Halloran starb an Tuberkulose, der gleichaltrige John Snyder wurde erstochen, Jacob Wolfinger ermordet, William Pike aus Versehen von seinem Bruder erschossen. Und schließlich Hardkoop, der als Sechzigjähriger die Rolle des Ausgestoßenen übernehmen musste.
Es kam also bereits zu einer Art Totentanz unter den Männern, bevor die eigentliche Katastrophe begonnen hatte. Donald Grayson wundert sich über diejenigen, die sich darüber wundern: So sterben vielfach junge, viel versprechende Männer, und so sterben auch ältere, ja, so sterben Männer überhaupt. Männer sterben früher als Frauen. Und sie sterben deshalb früher als Frauen, weil sie über die Millionen Jahre der Evolutionsgeschichte unzählige, unnatürliche Tode gestorben sind; durch Morde, Selbstmorde, Verkehrsunfälle und typische männliche Infektionskrankheiten, bei denen genetische Faktoren und Anfälligkeiten eine besondere Rolle spielen. Und aus genau diesen Gründen starben auch die ersten fünf Opfer des Trecks: »Fünf Todesfälle, alles Männer, und alle kamen auf typisch männliche Weise um: durch ansteckende Krankheit, Aggression und Gewalt.«8
Man ist also womöglich nicht gut beraten, sich in unserem Rollenspiel – und auch im wirklichen Leben – auf die starken, unabhängigen Männer zu verlassen. Oder, womöglich noch fataler: einer dieser Einzelkämpfer zu sein.
Denn, um es kurz zu machen, von den fünfzehn allein reisenden Männern, diesen Inbildern von Kraft und Herrlichkeit, überlebten die Tragödie am Donner-Pass nur drei. Einige von ihnen starben natürlich auch deshalb, weil sie bis zur Erschöpfung Holz fällen, in der Eiseskälte jagen oder fischen mussten. Das erklärt aber nicht, warum andere Männer, die in verheerender körperlicher Verfassung waren, überlebten. Und es erklärt auch nicht, warum manche älteren Siedler, zumal bei schlechter Kondition, sehr viel länger durchgehalten hatten als die jüngeren.
Grayson wurde bald klar, dass hier ein anderes Erklärungsmuster vorliegen musste. Nachdem er alle Todesfälle ausgewertet und Tote mit Überlebenden verglichen hatte, wurde ihm klar, was entscheidend für das Durchkommen am Donner-Pass gewesen war: die Familie. Einzig und allein, ob die betreffende Person in einer Familie oder allein gereist war, entschied darüber; mehr noch: Je größer die Familie war, desto größer war die Überlebenswahrscheinlichkeit des Einzelnen. Und nicht nur das: Auch wie lange jemand durchhielt, hing von der Größe seines verwandtschaftlichen Netzes ab. »Je größer die Familie, in der eine Person reiste«, so Grayson lakonisch, »desto länger überlebte diese Person.«9 Das galt übrigens auch für den Ältesten der Gruppe, den fünfundsechzigjährigen George Donner, der, obwohl an der Hand schwer verwundet, im Vergleich zu den anderen Männern nur deshalb so lange am Leben blieb, weil seine Frau Tamsen ihn aufopfernd gepflegt hatte.
»Diese Gruppen lehren uns«, schreibt Grayson, »was mit Gemeinschaften geschieht, die sich nicht gegen Kälte und Hunger wehren können und denen dennoch die Fähigkeit verblieben ist, sich innerhalb einer Familie auszutauschen.«10
Als sich am 23. März 1847 eine kleine Rettungstruppe zu den Verlorenen durchgekämpft hatte, weigerte Tamsen sich, mit ihr zu gehen – sie wollte ihren Mann nicht alleine zurücklassen und gab den Rettern ihre drei Töchter mit. George Donner, obwohl verwundet und der Älteste der Gruppe, schaffte es dank dieser Zuwendung bis zum 26. März. Tamsen überlebte ihn nur um zwei Tage.
Erst einen Monat später, am 25. April 1847, wird das letzte Mitglied des Trecks gerettet.
Nachwuchs
Zwei Kräfte haben unsere Welt in den vergangenen Jahren so sehr verändert, dass uns das Gefühl befällt, jedes Jahr tiefer in einen Schlamassel zu geraten: Arbeit und Liebe.
Liebe begünstigt Geburten, Arbeit vereitelt sie. So lautet der Grundwiderspruch unserer Gesellschaft. Nicht gerade ein Romeo-und-Julia-Stoff. Die Tragödie unseres Lebens besteht nicht mehr darin, liebend unterzugehen, sondern darin, arbeitend, ohne genügend Nachwuchs abzutreten.
Arbeit bringt Geld, Liebe kostet Geld. Arbeit liefert – allen einschlägigen Untersuchungen zufolge – die dem Menschen maximal zugängliche Erfüllung, Liebe endet oft im Streit. Arbeit produziert Waren und Eigentum, Liebe produziert Kinder und Verluste. Arbeit eignet sich für Sachbücher, Liebe für Romane.
Arbeit ist vor allem Arbeit des Gehirns. Der Grad der Ausbildung einer Frau ist mittlerweile eine feste Größe für Kinderlosigkeit und die Verschiebung stabiler Partnerschaften. Arbeit vergrößert das Risiko von Kinderlosigkeit – sogar in stabilen Partnerschaften.
Arbeit und Liebe teilen unsere Welt auf, in Schwarz und Rot, und mischen die Schicksale. Aber zwischen Arbeit und Liebe gibt es ein Drittes, das sich erst konstituiert, wenn beide zusammenfinden. Es ist die Familie, die Überlebensfabrik, die Donald Grayson am Donner-Pass detektivisch aufspürte.
Der Schnee, die Menschen und die Winterlager: Übertragen wir das Muster auf die Gegenwart, und schauen wir, was vom Gesetz des Sterbens der Männer und des Überlebens der Familien bleibt. Die Donner-Gruppe war in ihrer Verteilung von Männern, Frauen und Familien ein demographischer Spiegel, ein Mikrokosmos ihrer Zeit. Wie wären die Mitglieder einer solchen gestrandeten Gruppe heute miteinander verbunden? Wie viele Familien gäbe es? Wie viele Einzelreisende? Wie viele Freunde? Und wie würden wir ein solches Unglück überleben?
Kaum einer von uns Heutigen wäre auf dem Donner-Pass unter den sicheren Gewinnern gewesen. Die größte Überlebenschance, so fand Grayson heraus, hatten Familienverbände, die mehr als zehn Mitglieder umfassten. Das ist ein repräsentativer Wert, der für diese Art der Katastrophen fast immer gilt und nicht nur für den Wilden Westen des Jahres 1846: Je größer die Familie, desto sicherer die Rettung.11
Doch zu zehnt ziehen wir längst nicht mehr umher. Wir sind weniger geworden. Vielleicht auch deshalb, weil seit ein paar Generationen keiner mehr damit rechnen musste, auf seiner Lebensreise in irgendeinem verschneiten Pass festzustecken.
Neuerdings können wir uns dessen nicht mehr so sicher sein. Wir sind zwar nicht mit Wagen, Pferden und vergilbten Landkarten unterwegs, aber das Land fühlt sich für viele trotzdem wie eingefroren an. Wir sind keine Pioniere, aber dass unbekanntes Terrain vor uns liegt, spürt jeder. Wir haben keine Knappheit an Vorräten, aber uns mangelt es am Vorrat verwandtschaftlicher Beziehungen.
Der Demograph Nicholas Eberstadt hat für die nächsten beiden Generationen in Italien vorausberechnet, dass drei Fünftel der Kinder keine direkten Verwandten haben werden. Auch für die anderen Länder Europas gibt er keine Entwarnung: »Ungefähr vierzig Prozent der europäischen Kinder werden keine gleichaltrigen Blutsverwandten haben; weniger als ein Sechstel werden aus erster Hand die Erfahrung von Bruder oder Schwester und gleichzeitig einem Cousin oder einer Cousine haben. Familien in den weniger fortschrittlichen Regionen der Welt werden diese Entwicklung im Jahre 2050 noch nicht vollständig durchlaufen haben. Aber das ist nur eine Frage der Zeit: In einer oder zwei Generationen wird eine Familie, die aus Geschwistern, Cousins und Cousinen, Onkeln und Tanten besteht, unter den hier zugrunde liegenden Fertilitätsraten in der gesamten Welt eine Anomalie darstellen.«12 Und der Economist prophezeite: »Ein subtiler, aber gleichermaßen fundamentaler Wandel wird sich in den Familienstrukturen vollziehen. Es gibt gute Chancen, dass das heute geborene sechsmilliardste Kind zwei oder drei Geschwister hat, eine ganze Reihe stolzer Tanten und Onkel und eine Hand voll Cousins und Cousinen. Baby Nummer 7 500 000 000 wird höchstwahrscheinlich ein Einzelkind sein, mit nur sehr wenigen Angehörigen seiner eigenen Generation.«13 Baby Nummer 7 500 000 000 hätte auf dem Donner-Pass keine Chance gehabt.
Gewiss: Wir stecken nicht im Schnee in irgendwelchen amerikanischen Bergen. Wir sind nicht bedroht von Kälte und Sturm; und doch haben auch wir zunehmend das Gefühl, nur noch langsam und sehr mühsam weiterzukommen. Man kennt die Verblüffung, die sich auf den Gesichtern abzeichnet, wenn der Sozialstaat die Mitreisenden unserer Gemeinschaft neuerdings anweist, in die Familien zurückzukehren, weil er nicht mehr helfen kann. Diese Botschaft war nicht vorgesehen. Und noch weniger war vorgesehen, dass sie nicht aus ideologischen Gründen erfolgt, sondern aus Mangel an Ressourcen.
Wohin zurückkehren? Wie die Reisegruppe vom Donner-Pass haben auch wir in der Vergangenheit eine Abkürzung genommen, um schneller ans Ziel zu kommen. Unsere Abkürzung heißt: weniger Kinder, um Kosten zu sparen, weniger Familien, um Verpflichtungen zu entgehen. Nun müssen wir und vor allem unsere Kinder für diese Entscheidung bezahlen. Sie ist irreversibel. Und sie gewinnt tragische Züge, wenn der Wohlfahrtsstaat, der die Familie ersetzen wollte, kapituliert. Oder einen wie den armen Hardkoop vom Wagen stößt.
Was, wenn der Staat seine Hilfsversprechen nicht mehr halten kann? Wer rettet dann wen, wenn es ernst wird, wer versorgt wen, wenn es Not tut, wer vertraut wem, wenn es schlimm wird, wer setzt wen als Erben ein, wenn es zu Ende geht? Und vor allem: Wer arbeitet für wen, auch wenn kein Geld da ist?
Unsere Kinder sind es, die zunehmend ohne Mitverbündete aufwachsen, die nicht, um Nicholas Eberstadt zu zitieren, durch das Urgefühl sozialisiert werden, »dass es ein unauflösliches Band gibt, das sie mit Gleichaltrigen in der Familie verbindet«.14 Von diesen Kindern aber hängt alles ab. Von ihrer Ausbildung, aber auch von ihren Lebensentscheidungen. Sie sind die wahre »Sandwich-Generation«. Sie werden nicht nur mit Geld, sondern auch mit ihrer Lebenszeit zahlen müssen. Sie werden sich, da sie meistens spät von ihren Eltern geboren wurden und vermutlich selber spät Kinder bekommen, womöglich mehr als vierzig Jahre ihres Lebens auf die eine oder andere Weise der Fürsorge von abhängigen Familienangehörigen – erst der eigenen Kinder, dann ihrer Eltern – widmen müssen. Die Kinder, die wir heute schon auf den Straßen sehen, werden zwei Erwachsene ersetzen müssen, »in Produktion und Reproduktion, im sozialen Leben, im Netz ihrer Gefühle und Loyalitäten«.15
Wir haben uns, je älter wir wurden, angewöhnt, Familien als Organisationsformen der Enge, des Absurden, der Komik, der Soap-Operas misszuverstehen. Mag sein, dass sie das alles sind. Vor allem aber sind sie, wie Donald Grayson gezeigt hat, Urgewalten, die aus allem Guten und allem Schlechten, was Arbeit und Liebe hervorbringen, bestehen 16 – Urgewalten, die sich seit Jahrtausenden immer wieder erneuert, immer wieder reproduziert haben.
Schicksalsgemeinschaft
»Die kargen Rationen werden in diesem Monat auf die Hälfte gesenkt. Das ist das Todesurteil für viele, die bislang noch mühsam Schritt hielten, vor allem für Kinder, alte Leute und Flüchtlinge.«17 Das schreibt der Schriftsteller Ernst Jünger in sein Tagebuch, und nicht über das Unglück in der Sierra Nevada, sondern über das im Deutschland des Jahres 1946. Es ist genau einhundert Jahre her, seit ein Treck von Siedlern einen gewissen Hardkoop seinem Schicksal überlassen hatte, weil auch er nicht mehr Schritt halten konnte. Jetzt, Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, ist ein ganzes Land am Ende. Die direkte Nachkriegszeit ist unsere Tragödie vom Donner-Pass.
Das absolute Minimum seit Kriegsende herrschte in Deutschland zwischen den Jahren 1945 und 1949. Keine andere Phase der deutschen Historie ist symbolhafter oder stärker verwoben mit unserem Leben und unseren Familiengeschichten. Denn diese Katastrophe der Weltgeschichte war zugleich eine der Familien. Sucht man nach dem letzten verbindenden Geschehnis, das an jedem Frühstückstisch als Vorwort aller Schicksalserzählungen weitergegeben wird, dann ereignete es sich in diesen Jahren: In jeder Familie gab es Kriegsgefangene, Tote, Täter, Opfer und das Gefühl des Zusammenbruchs und des Neuanfangs. Seit Generationen erzählen Eltern ihren Kindern davon, und das Land vergewissert sich in Gedenkfeiern und umfassenden Erinnerungsbänden alle zehn Jahre der Ereignisse. Dass die Deutschen dieses materielle, moralische und physische Minimum überstanden haben, hat bis weit in die neunziger Jahre zum Selbstbewusstsein des Landes beigetragen. Der Ort dieser Selbstermächtigung war die Familie, und ihre Kraft reichte, im Westen des Landes, von der Wiederherstellung des beschädigten Einzelnen bis zum Wiederaufbau des zerstörten Landes – durch Familien und auch durch Familienunternehmen.
Man redet seither bekanntlich von der Stunde null. Besser wäre es, auf den Temperaturunterschied hinzuweisen. Die Null als die Markierung eines Thermometers, die den Einschnitt in unserer Existenz verdeutlicht. Was vor 1945 geschah, bewegte sich in den Minusgraden des Lebens. Erst das Ende des Krieges verhieß ein Klima, in dem auch wieder soziale Beziehungen, womöglich sogar Kinder gedeihen konnten – es kam einer Erderwärmung nach einer Phase der Kälte gleich. Tatsächlich wurden auch in vielen Reden und Kommentaren aus der damaligen Zeit Bilder des Wachsens und Blühens verwendet.
Bedienten wir uns einer Zeitmaschine, um mit ihr die Kinder und Jugendlichen des Jahres 1945 aufzusuchen, würden wir den Legenden des Wiederaufbaus begegnen, dem intellektuellen und ökonomischen Personal der heutigen Republik und vor allem den Eltern der großen Geburtenjahrgänge der späten fünfziger und sechziger Jahre: Max Grundig ist siebenundzwanzig Jahre alt, Josef Neckermann dreiundzwanzig, Günter Grass achtzehn, Helmut Kohl ist fünfzehn. Auch der Vater des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, ist mit achtundvierzig Jahren verhältnismäßig jung. Sie alle stehen für den Neubeginn 1945.
Doch es gab auch viele Deutsche, denen die Lage in diesen ersten Nachkriegsjahren zunächst aussichtslos schien; manche fühlten sich in die Freiheit wie in einen Hinterhalt gelockt. Die Angst vor den riesigen entvölkerten Räumen, die die Deutschen seit dem Dreißigjährigen Krieg begleitet hatte, kehrte zurück. Und nicht wenige hatten das Bild eines für Generationen entvölkerten Landes vor Augen, worüber viele zeitgenössische Berichte Zeugnis ablegen.
»Es bleibt dabei«, notierte der Schweizer Schriftsteller Max Frisch im Mai 1946 in seinem Tagebuch, »das Gras, das in den Häusern wächst, der Löwenzahn in den Kirchen, und plötzlich kann man sich vorstellen, wie es weiter wächst, wie sich ein Urwald über unsere Städte zieht, langsam, unaufhaltsam, ein menschenloses Gedeihen, ein Schweigen aus Disteln und Moos, eine geschichtslose Erde, dazu das Zwitschern der Vögel, Frühling, Sommer und Herbst, Atem der Jahre, die niemand mehr zählt.«18
Ein Gefühl für den Verlust an sozialem Kapital, für die Entkoppelung von den Mitmenschen noch in der alltäglichsten Begegnung, vermittelt die Tagebucheintragung Ernst Jüngers von Heiligabend 1945: »Wenn man über unsere Landstraßen geht, kann man Gestalten begegnen, wie man sie nie gesehen hat. Es sind die Heimkehrer mit ihrer grauen Aura von allerletztem Leid. Ihnen ist alles zugefügt, was uns von Menschen zugefügt werden, und alles geraubt, was uns von Menschen geraubt werden kann. Sie sind Sendboten von Stätten, an denen zahllose zu Tode geplagt, verhungert, erfroren, geschändet sind. Einem solchen begegnete ich heute bei Beinhorn; sie hatten ihm nur einen grauen Leinenkittel gelassen, durch den der Nordwind pfiff. Er musste von weither kommen und zog, ohne den Blick zu wenden, wie ein Schatten vorbei. Wie kam es, dass ich ihn heute, am Weihnachtstage, nicht ansprechen konnte, wie ich es doch bei so vielen tat? War er so ungeheuer fern?«19
In den vergangenen Jahren hat sich die Wahrnehmung von 1945 verändert. Das Jahr steht jetzt – auch in offiziellen Reden – nicht mehr für das Ende, für den Epilog einer Unheilsgeschichte, sondern symbolisiert eher einen Anfang, den Prolog für eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Denn obwohl die Welt in Schutt und Asche lag, gelangen Wiederaufbau und Wachstum.
Unsere gegenwärtige Situation ruft ähnliche Assoziationen hervor wie das Jahr 1945: Auch heute muss sich Deutschland um den Wiederaufbau bemühen, aber die Einbruchstelle ist nun die Familie selbst, diejenige Institution, die damals die existenzielle Kraft fand, das Land wieder neu zusammenzusetzen – sollte das, was schon einmal gelang, nicht noch einmal möglich sein? Ohne Zweifel ist es verlockend, in der direkten Nachkriegszeit den