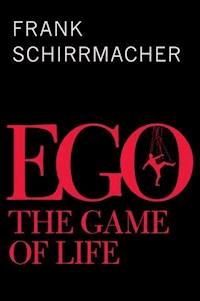12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum sind wir im Informationszeitalter gezwungen zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie gewinnen wir die Kontrolle über unser Denken zurück?
Was wollte ich gerade tun? Wieso haben die Dinge kein Ende mehr? Was geschieht mit meinem Gehirn? Fast jeder kennt die neue Vergesslichkeit und die fast pathologische Zunahme von Konzentrationsstörungen. Dahinter steckt sehr viel mehr als nur Überforderung. Wir wissen mehr als je zuvor und fürchten doch ständig, das Wichtigste zu verpassen. Der Mensch ist nicht nur ein Fleisch- und Pflanzenfresser, er ist auch ein Informationsfresser. Informationen sind Vorteile und in der Informations-Nahrungskette siegt der, der am schnellsten und effektivsten Nachrichten sendet und empfängt. Aber diese neue Form des Darwinismus führt dazu, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was wichtig ist und was nicht. Wir rufen unsere ganze Lebensbahn immer stärker wie Informationen ab und zerstören so unsere Fähigkeit, mit Unerwartetem umzugehen. Die Frage lautet, ob wir bereits begonnen haben, uns selbst wie Computer zu behandeln, und ob wir damit Gefahr laufen, den Menschen in mathematische Formeln zu verwandeln ...
Nicht die Technologien sind Schuld, sondern die Tatsache, dass immer häufiger nur noch das im Menschen gefordert und gefördert wird, was mit den Rechnern kompatibel ist. Eine Welt ohne Informationstechnologie ist nicht vorstellbar. Aber die pure Koexistenz von Mensch und Computer führt zum Sieg der künstlichen Intelligenz. Schon bald werden Computer zu Dingen fähig sein, die heute noch unvorstellbar scheinen. Sie werden unsere Wünsche besser kennen als wir selbst und in der Lage sein, sogar unsere Assoziationen in Software zu übersetzen. Wichtig aber ist, dass wir währenddessen unsere Fähigkeiten nicht verlieren. Wir können zurückfordern, was uns genommen wird, wenn wir die Stärken des Menschen neu bestimmen.
Ausgehend von Gesprächen mit den führenden Köpfen des Internet-Zeitalters und wichtigen Vertretern der modernen Psychologie zeigt Frank Schirrmacher, wie sich schon in den nächsten Jahren das Selbstbild des Menschen wandeln könnte und welche faszinierenden Antworten auf diese Krise möglich sind.
• Wir werden bombardiert mit dem, was andere Menschen jede Sekunde tun
• Wir werden voraussagen können, was jeder Mensch in der nächsten Minute tun will
• Wir wissen alles. Und nichts über uns selbst
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
FRANKSCHIRRMACHERPAYBACK
Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sindzu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir dieKontrolle über unser Denken zurückgewinnen
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Alle Rechte vorbehalten
© Karl Blessing Verlag, München 2009, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Layout: Ursula Maenner
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-02995-1V003
www.blessing-verlag.de
ERSTER TEIL
Warum wir tun, was wir nicht tun wollen
MEIN KOPF KOMMT NICHT MEHR MIT
as mich angeht, so muss ich bekennen, dass ich den geistigen Anforderungen unserer Zeit nicht mehr gewachsen bin. Ich dirigiere meinen Datenverkehr, meine SMS, E-Mails, Feeds,Tweeds, Nachrichtensites, Handyanrufe und Newsaggregatoren wie ein Fluglotse den Luftverkehr: immer bemüht, einen Zusammenstoß zu vermeiden, und immer in Sorge, das Entscheidende übersehen zu haben. Ohne Google wäre ich aufgeschmissen und nicht mehr imstande, einen Handwerker zu bestellen oder zu recherchieren.
Würde ich morgen vom Internet oder Computer geschieden werden, wäre das nicht eine Trennung von dem Provider, sondern es wäre das Ende einer sozialen Beziehung, die mich tief verstören würde.
Am Tag meiner Konfirmation, als ich den Spielcomputer Logikus der Firma Kosmos geschenkt bekam, bin ich freudig in das Wettrüsten mit der jeweils neuesten Technologie eingetreten. Moores Gesetz - das Gesetz, wonach sich die Geschwindigkeit der Prozessoren alle zwei Jahre verdoppelt - kannte ich schon, als ich meinen ersten Amstrad-Rechner kaufte.
Bedienungsanleitungen verstehe ich so wenig wie alle anderen Menschen, aber die Geräte selbst konnte ich immer schon nach kurzer Eingewöhnungszeit bedienen. Niemals fühlte ich mich von Computern überfordert. Ich simse am Stück, Leute, die ich nicht kenne, folgen meinem ungenutzten Twitter-Account, ich weiß, wo ich im Internet Antworten auf meine Fragen finde.
Ich will sagen: Weder bin ich der Amish des Internet-Zeitalters noch ein technologischer Einsiedler. Und ich erwähne das alles überhaupt nur, um nicht gleich im nächsten Absatz in den Verdacht zu geraten, einfach nicht mehr lernfähig zu sein.
Aber etwas stimmt nicht mehr. Mein Kopf kommt nicht mehr mit. Zwar bilde ich mir ein, dass ich meinen Gesprächspartnern ebenbürtig bin, und ich habe nicht den Eindruck, dass ich heute weniger von der Welt verstehe als früher.
Das Problem ist meine Mensch-Computer-Schnittstelle. »Das Hirn ist nichts anderes als eine Fleisch-Maschine«, hat leicht verächtlich Marvin Minsky, einer der Begründer der Informatik, schon vor Jahrzehnten gesagt. Und meine »Fleisch-Maschine« ist offenbar nicht mehr besonders gut.
Es ist, als laufe mein Web-Browser mittlerweile auf zwei verschiedenen Plattformen, eine auf meinem Computer und eine sehr viel langsamere Version in meinem Kopf. Damit ein leistungsschwaches Handy eine mit technischen Spielereien vollgepackte Website trotzdem darstellen kann, haben die Programmierer eine Methode erfunden, die sich »graceful degradation« nennt, auf Deutsch: »würdevolle Herabstufung«. Die Website gibt sich gewissermaßen bescheiden, um das Handy, das in diesem Fall zu den armen Verwandten zählt, nicht in seinem Stolz zu verletzen.
Das Verhältnis meines Gehirns zur Informationsflut ist das der permanenten würdelosen Herabstufung. Ich spüre, dass mein biologisches Endgerät im Kopf nur über eingeschränkte Funktionen verfügt und in seiner Konfusion beginnt, eine Menge falscher Dinge zu lernen.
Aber ich habe auch meinen Stolz. Ich schließe von meinem Kopf auf viele Köpfe, und dass es mir wie vielen geht: Ich glaube, es hat, um ein Lieblingswort der Informatiker zu zitieren, eine Rückkoppelung stattgefunden, die jenen Teil der Aufmerksamkeit, den wir früher uns selbst widmeten, abzapft, auffrisst und als leere Hülle zurücklässt. Man nennt das feed-back, wörtlich: eine Rück-Ernährung. Aber wer ernährt sich von unserer Aufmerksamkeit?
Keine SMS, kein Blog, keine E-Mail wird in den Wind gesendet. Keine Suchanfrage, kein Tweet, kein Click geht verloren. Nichts verschwindet und alles speist Datenbanken. Wir füttern mit unseren Gedanken, Worten und E-Mails das Wachstum eines gewaltigen synthetischen Hirns. Das ist keine Vermenschlichung eines technischen Vorgangs. Genau das geschieht, wie wir im Laufe dieses Buches sehen werden.
Mir scheint, dass viele Leute gerade merken, welchen Preis wir zahlen. Buchstäblich. Manchmal endet es im Ruin. So wie bei dem Stanford-Professor Lawrence Lessig, der vor ein paar Jahren seinen »E-Mail-Bankrott« erklärte, nachdem sich in seinem Postfach Tausende ungelesene E-Mails angesammelt hatten und er auch nach achtzig Stunden keinen Überblick hatte.1
Ich bin noch nicht bereit, den Bankrott zu erklären. Aber ich bin unkonzentriert, vergesslich und mein Hirn gibt jeder Ablenkung nach. Ich lebe ständig mit dem Gefühl, eine Information zu versäumen oder zu vergessen, und es gibt kein Risiko-Management, das mir hilft. Und das Schlimmste: Ich weiß noch nicht einmal, ob das, was ich weiß, wichtig ist, oder das, was ich vergessen habe, unwichtig.
Jeden Tag werde ich mehrmals in den Zustand des falschen Alarms versetzt, mit allem, was dazugehört. Nicht mehr lange, und ich könnte Ehrenmitglied jener wachsenden Gruppe von Japanern werden, die nicht nur systematisch ihre U-Bahn-Station verpassen, sondern mittlerweile auch immer häufiger vergessen, wie die Station überhaupt heißt, an der sie aussteigen müssen.
Kurzum: Ich werde aufgefressen.
Das ist eine so bittere wie peinliche Erkenntnis. Man kann ihr auch nicht entrinnen, wenn man den Bildschirm abschaltet. Ständig begegnet man Menschen, die in jeder Situation per Handy texten, E-Mails abrufen, gleich mit ihrem ganzen Laptop anrücken, und immer häufiger höre ich bei Telefonaten dieses insektenhafte Klicken, weil mein Gesprächspartner tippt, während er telefoniert. Jede Sekunde dringen Tausende Informationen in die Welt, die nicht mehr Resultate melden, sondern Gleichzeitigkeiten. Die Ergebnisse von Wahlen werden getwittert. In New York wollte ein Richter einen Geschworenen entlassen, weil herauskam, dass der entgegen der Weisung Hintergründe des Verfahrens gegoogelt hatte. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass acht weitere Geschworene das Gleiche getan hatten, worauf gleich das ganze Verfahren ausgesetzt werden musste.
In Arkansas verschickte ein Geschworener regelmäßig Updates eines Prozesses per Twitter, in Pennsylvania stellte ein anderer Schöffe das noch nicht verkündete Urteil auf seinen Facebook-Account.2 Jede dieser Informationen wird nicht nur getippt und gesendet, sie muss auch empfangen und gelesen werden.
Die neue Gleichzeitigkeit von Informationen hat eine Zwillingsschwester, die wir »Multitasking« getauft haben.
Wir alle, die wir auf die gläsernen Bildschirme starren, sind Menschen bei der Fütterung; wie die stolzen Besitzer von Terrarien, die Nahrungswolken auf die unsichtbaren Tiere in ihren Glaskästen herabregnen lassen. Es ist eine Eile dabei, als könnte etwas verhungern. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die ich kenne, immer schneller erzählen, gerade so, als könnten sie nicht damit rechnen, dass genug Zeit bleibt, ihnen zuzuhören, weil die Informationskonkurrenz so gewaltig ist.
Dass es anderen auch so geht wie mir, ist beruhigend. Und sehr beunruhigend zugleich.
In meinem E-Mail-Postfach findet sich seit ein paar Tagen die Nachricht des Herausgebers einer amerikanischen Literaturzeitschrift. Er beklagt, dass seine Doktoranden nicht mehr in der Lage zu sein scheinen, die Romane William Faulkners zu lesen. Und dann fügt er leicht klagend hinzu, dass auch er nicht mehr die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts liest, weil er an die Schnelligkeit und Zugänglichkeit verschiedenster Informationsquellen gewöhnt ist.
Wir Informationsüberladenen sollten uns bekennen.
Der Philosoph Daniel Dennett hat das Genre der intellektuellen Selbstbezichtigung unlängst in einem Artikel für die »New York Times« wunderbar neu belebt. Und von ihm können wir lernen: »Wir sind keine Minderheit, wahrscheinlich sind wir die leidende Mehrheit.«3 Wir sind überall. Wir könnten Ihre Brüder und Schwestern oder Ihre Töchter und Söhne sein. Wir sind Krankenschwestern und Ärzte, Polizisten und Lehrer, Journalisten und Wissenschaftler. Wir sind auch schon in den Kindergärten und Schulen. Und es kommen täglich mehr dazu.
Es ist ein Prozess ohne Beispiel. Und es ist ein Prozess, in dem nicht Dummheiten, sondern Intelligenzen miteinander konkurrieren. Wenn es um Dummheit und Zeitverlust ginge, um Entwürdigung von Mensch und Intelligenz, um die Aushöhlung der besten Seiten im Betrachter, dann reicht ein Blick in die Boulevard-Formate des Privatfernsehens. Gemeinsam mit IBM hat der amerikanische Kommunikationswissenschaftler Clay Shirky den geistigen Aufwand ziemlich genau beziffert: Das gesamte Wikipedia-Projekt, so Shirky, jede Zeile in allen Sprachen akkumuliert 98 Millionen Stunden menschlichen Denkens. Das ist eine gigantische Zahl. Sie relativiert sich aber, wenn man sich klarmacht, dass allein an einem einzigen Wochenende sämtliche Fernsehzuschauer der USA addiert 98 Millionen Stunden reine Fernsehwerbung sehen.4 Die 98 Millionen Stunden Wikipedia sind das, was Shirky »kognitiven Mehrwert« nennt.Wer über das digitale Zeitalter redet, redet nicht nur über ein Medium. Er redet über eine Fabrik der Gedanken. Im Internet mag es viele Dummheiten geben, aber es wetteifern dort auch außerordentliche Intelligenzen miteinander - nicht nur in Texten, sondern vor allem und in erster Linie in den unsichtbaren Computercodes, die uns leiten. Hinter ihnen stecken die wahren Programmdirektoren unseres Lebens. Darunter sind ein paar der klügsten Menschen der Welt.
Kein Mensch kann mehr daran zweifeln, dass wir in eine neue Ära eingetreten sind, aber die Zweifel, wohin sie uns führt, wachsen täglich.
Das Gefühl von Vergesslichkeit und Vergeblichkeit steht nicht im Widerspruch zu den gigantischen Datenmengen, die täglich gespeichert werden, sondern ist deren Resultat. Nichts mehr, das verweht, und keine Frage, die nicht ohne Antwort bliebe. Nach einer Berechnung der Universität Berkeley wurden im Jahre 2003 auf allen bekannten Datenträgern, von Print bis Internet, 5 Exabyte neuer Informationen gespeichert. Die unvorstellbare Zahl entspricht allen jemals von Menschen auf der Erde gesprochenen Worten.5 Die jüngste Studie, die 2010 publiziert werden soll, wird eine weitere Informationsexplosion verzeichnen. Jede dieser Informationen muss von irgendjemanden produziert und gesendet und von einem anderen gelesen und gespeichert worden sein. Darunter gibt es unendlich viel Trash, aber, da nun jeder am großen Text der Welt mitschreibt, auch unzählige Gedanken und Erkenntnisse, die nach unserem bisherigen Verständnis von Intelligenz jedermann angehen und interessieren müssten. »Es gibt nicht mehr genügend Hirne, die die Bevölkerungsexplosion der Ideen beherbergen könnte«, schreibt resigniert der Philosoph Daniel Dennett.6
Informationen fressen Aufmerksamkeit, sie ist ihre Nahrung.
Aber es gibt nicht genügend Aufmerksamkeit für alle die neuen Informationen, nicht einmal mehr in unserem eigenen persönlichen Leben. Wenn Bevölkerungsexplosionen mit Nahrungsmangel zusammentreffen, entstehen darwinistische Verteilungskämpfe, Arten sterben aus, andere überleben, das wissen wir, weil Charles Darwin die Bevölkerungstheorien von Thomas Malthus gelesen hat und dadurch erst seine Evolutionstheorie entwickeln konnte. Unsere Köpfe sind die Plattformen eines Überlebenskampfes von Informationen, Ideen und Gedanken geworden, und je stärker wir unsere eigenen Gedanken in das Netz einspeisen, desto stärker werden wir selbst in diesen Kampf mit einbezogen. Er hat jetzt erst Verlage und Zeitungen, Fernsehen und die Musikindustrie getroffen.
Aber man mache sich nichts vor. Der darwinistische Überlebenskampf ist im Begriff, auf das Leben des Einzelnen überzugreifen, auf seine Kommunikation mit anderen, sein Erinnerungsvermögen, das der größte Feind neuer Informationen ist, auf sein soziales Leben, auf seine Berufs- und Lebenskarriere, die längst Bestandteil des digitalen Universums geworden ist.
Die drei Ideologien, die das Leben der Menschen in den letzten zwei Jahrhunderten bis heute am nachhaltigsten verändert haben, waren Taylorismus - also die »Arbeitsoptimierung« gesteuert durch die Stoppuhr und den Zwang zur äußersten Effizienz -, Marxismus und Darwinismus. Alle drei Weltbilder fin-den im digitalen Zeitalter in einer »personalisierten« Form, nicht als Ideologie, sondern als Lebenspraxis, zusammen. Der Taylorismus in Gestalt des Multitaskings, der Marxismus in Gestalt kostenloser Informationen, aber auch selbstausbeutende Mikroarbeit im Internet, die vor allem Google zugute kommt, und der Darwinismus in Gestalt des Vorteils für denjenigen, der als Erster die entscheidende Information hat.
Dieses Buch will zeigen, wie die Informationsexplosion unser Gedächtnis, unsere Aufmerksamkeit und unsere geistigen Fähigkeiten verändert, wie unser Gehirn physisch verändert wird, vergleichbar nur den Muskel- und Körperveränderungen der Menschen im Zeitalter der industriellen Revolution. Kein Mensch kann sich diesem Wandel entziehen. Aber das sind nur Vorbereitungen auf einen ungleich größeren Wandel. Er umfasst weit mehr als Kommunikation mit Handys und Computern, mehr als Multitasking und Schwarmintelligenz; er bezeichnet eine Zeitenwende, die nach dem Wissenschaftshistoriker George Dyson dadurch gekennzeichnet sein wird, dass in ihr eine neue Art von Intelligenz geweckt wird. Was wir im Augenblick als geistige Überforderung mit den neuen Technologien bei gleichzeitiger körperlicher Lust an ihnen erleben, sind nur die physischen Schmerzen, die uns die Anpassung an diese neue Intelligenz zufügt.
Die digitale Gesellschaft ist im Begriff, ihr Innenleben umzuprogrammieren. Auf der ganzen Welt haben Computer damit begonnen, ihre Intelligenz zusammenzulegen und ihre inneren Zustände auszutauschen; und seit ein paar Jahren sind die Menschen ihnen auf diesem Weg gefolgt. Solange sie sich von den Maschinen treiben lassen, werden sie hoffnungslos unterlegen sein.Wir werden aufgefressen werden von der Angst, etwas zu verpassen, und von dem Zwang, jede Information zu konsumieren. Wir werden das selbstständige Denken verlernen, weil wir nicht mehr wissen, was wichtig ist und was nicht. Und wir werden uns in fast allen Bereichen der autoritären Herrschaft der Maschinen unterwerfen. Denn das Denken wandert buchstäblich nach außen; es verlässt unser Inneres und spielt sich auf digitalen Plattformen ab. Das Gefühl, dass das Leben mathematisch vorbestimmt ist und sich am eigenen Schicksal nichts mehr ändern wird, ist einer der dokumentierten Effekte der Informationsüberflutung.
Aber im Internet und den digitalen Technologien steckt auch eine gewaltige Chance. Denn es gibt einen Ausweg, der selten so gangbar schien wie heute: Die Perfektion der entstehenden Systeme hilft uns nur, wenn wir uns erlauben, weniger perfekt zu sein, ja aus unserem Mangel und unserer Unvollständigkeit etwas zu stärken, was Computer nicht haben und worum sie uns beneiden müssten: Kreativität, Toleranz und Geistesgegenwart.
DAS NEUE HIRN
er erste Computer stand beim Militär. Er kümmerte sich um Aufklärung im buchstäblichen Sinn: um Luftverteidigung und Artillerievorausberechnungen. Dann tauchten ein paar bei den Banken auf. In den siebziger Jahren eroberten sie die Universitäten und die Medizin. Dann zog er in die Praxen ein, und überall, wo er angeschlossen wurden, veränderte er die Menschen, die mit ihm arbeiteten. Mittlerweile steht in jedem zweiten Kinderzimmer einer.
Im Jahr 1923 schenkte ein Unbekannter einem kleinen elfjährigen Jungen zu Weihnachten ein Kinderbuch. Es hatte 365 Seiten und viele Bilder von Käfern, Gehirnen und Dinos. Das Buch hieß »Wunder der Natur, die jedes Kind kennen sollte«, und es war, wie wir heute wissen, eines der folgenreichsten Weihnachtsgeschenke der Weltgeschichte. Der pädagogisch befeuerte Verfasser, ein Dr. Edwin Brewster, wollte im Stil einer Wikipedia der Jahrhundertwende Kindern das Wissen der Natur und der Technik des Lebens vermitteln.7 Der kleine Junge las begeistert wie niemals wieder in seinem Leben. Noch nach vielen Jahren, längst ein Erwachsener und im Begriff, mit seinen Gedanken die Welt zu revolutionieren, schrieb er seiner Mutter, dass kein Buch ihn mehr beeinflusst habe als Dr. Brewsters Enzyklopädie.8
Brewsters Buch war erstaunlich ambitioniert. Kapitelüberschriften lauteten »Wo wir denken«, »Was Pflanzen wissen«, »Über Sprechen und Denken« und »Sehen ist Glauben«, eine Beschreibung optischer Täuschungen. Er erklärte, warum Papageien, die reden können, trotzdem nicht verstehen, was sie sagen, und führte als Beweis an, dass sie ja auch niemals miteinander reden würden. Entscheidend für das Naturverständnis Brewsters waren zwei Stellen. Er verglich den Menschen mit einer Maschine, die nach den gleichen Algorithmen arbeitet wie ein Motor. Und er beschrieb die biologische Notwendigkeit von Aufmerksamkeit, die die Voraussetzung von Denken ist. »Natürlich ist der Körper eine Maschine«, heißt es, »es ist eine unglaublich komplizierte Maschine, viel, viel komplizierter als irgendeine Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde, aber es ist immer noch eine Maschine. Sie ist mit der Dampfmaschine verglichen worden. Aber das war, bevor man so viel wusste, wie man heute weiß. In Wahrheit ist sie ein Benzinmotor, wie beim Auto, Motorboot oder dem Flugzeug«.
Und über die Aufmerksamkeit: »Verstehst Du jetzt, warum Du fünf Stunden am Tag zur Schule gehen musst, auf einem harten Stuhl sitzt und noch härtere Aufgaben lösen musst, während Du lieber schwimmen gehen würdest? Das geschieht, damit Du diese Denk-Punkte in Deinem Gehirn aufbaust… Wir fangen jung an, während das Hirn noch wächst. Jahr für Jahr bauen wir durch Lernen und Arbeit ganz langsam diese Denk-Punkte über unserem linken Ohr auf und benutzen sie für den Rest unseres Lebens. Wenn wir erwachsen sind, können wir keine neuen Denk-Punkte mehr formen.«9
Der kleine Junge war Alan Turing, einer der größten Mathematiker des zwanzigsten Jahrhunderts und ohne Zweifel der legitime Erfinder des Computers. Brewsters Buch war der Baukasten seines späteren Denkens: Die Vorstellung, dass der Mensch eine Maschine sei, ist Voraussetzung für die Frage, ob dann nicht umgekehrt Maschinen wie Menschen denken können. Und die Erkenntnis, dass nicht-papageienhafte Intelligenz sich in Kommunikation ausdrückt, ist die Voraussetzung für die Einsicht, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine über die Zukunft der Intelligenz entscheidet. Es ist paradox, dass der Mann, der die Grundlagen für intelligente Maschinen legte, gleichzeitig unfreiwillig derjenige war, der, um mit Brewster zu reden, die »Denkpunkte« im menschlichen Hirn schwächte, weil seine Entdeckung die Aufmerksamkeit und das Denken des Menschen fundamental veränderte. Der kleine Junge, der dort aufgeregt und ergriffen in einem Kinderbuch liest, ist ein Musterbeispiel dafür, wie Kinder zu Raketentreibsätzen der Evolution werden. »Eine neue Generation ist ein neues Hirn«, hat Gottfried Benn gesagt, und manchmal baut sie auch neues.
Wie die beiden Jungen Sergej Brin und Larry Page, die siebzig Jahre nach Alan Turing mit Lego spielen und eines Tages daraus ein Kasten bauten, der nichts weniger war, als der erste Server der Welt.
Aus diesem bunten Legoturm wurde innerhalb von nicht einmal fünf Jahren Google, das wertvollste Unternehmen der Welt, das in einem einzigen revolutionären Siegeszug Verlage, Zeitungen,Wissenschaften, Schulen und Hochschulen, Börsen und die Kultur in den Grundfesten erschütterte. Generationen von Kindern haben mit Lego gelernt, dass Gedanken zu Bauplänen und Baupläne zu Materie werden können. Sie haben instinktiv gelernt, was Algorithmen sind, wenn sie die Steine sortierten oder ein Haus bauten. Brin und Page haben die Baupläne mit der universellen Grammatik digitaler Kommunikation ersetzt, die den Legoturm nicht nur zu einem Gegenstand der sichtbaren Welt macht, sondern auch zu einem Leuchtturm der unsichtbaren Welt der Gedanken. Das ist das Hirn, das die Bibliothek von Babel steuert. Nicht aus den Laboratorien und Managementseminaren, sondern aus dem Kinderzimmer kommt die letzte große kognitive Wende der Menschheit. Und noch heute dankt Google mit seinen Farben und den Bausteinen, die in allen Google-Niederlassungen der Welt herumliegen. seiner großen Inspiration. Ihr nächstes Ziel, so sagte Larry Page vor ein paar Jahren, sei es, ein weltumspannendes Gehirn für die Menschheit zu bauen.
»Google ist Turings Kathedrale, und sie wartet auf eine Seele« - mit fast religiöser Inbrunst hat der nüchterne George Dy-son seinen Besuch im Googleplex beschrieben. Bilder von Golden Retrievern, die in Zeitlupe durch Springbrunnen laufen, Menschen, die winken und lächeln, und überall Spielzeug.10 So, das sagen übereinstimmend alle, die Google vor dem Börsen-gang besucht haben, muss es gewesen sein, als im antiken Griechenland das Denken und im zwölften Jahrhundert in Europa die ersten Kathedralen gebaut wurden. Es ist keine Übertreibung. Es mag heute Google und morgen ein anderes Unternehmen sein. Aber der Legoturm als Kathedrale des neuen kognitiven Zugangs zur Welt bleibt stehen.
Man kann nicht einmal ahnen, was es bedeutet, wenn in den nächsten Jahren eine Generation auf der Bildfläche erscheint, die Gedanken, neue Ideen und Lebensformen aus dem vorhandenen Wissen so selbstverständlich zusammensetzt, wie Brin und Page ihren Legoturm zusammensetzten. Aber das ist nur die eine Variante. Die andere ist die Frage, wie sie mit all dem auf der Welt umgehen, das nicht aus Bausteinen besteht.
Die Generation der heute 18-Jährigen kennt keine Welt ohne Computer. Können sie unsere Überforderung mit der Informationsflut nachvollziehen? Spüren sie sie überhaupt? Haben sie ein ganz anderes Selbstverständnis? Sind ihre Gehirne also bereits anders verdrahtet als die ihrer Eltern?
Die elektronische Nabelschnur, die jede neu heranwachsende Generation von Kindern mit dem Computer verbinden wird, ist die Maus. Sie hat die Verständigung zwischen Menschen und Computern revolutioniert, und die Geschichte der Technik kennt keinen zweiten Fall, wo der Gebrauch einer neuen Technologie auf das Zeigen zurückgeführt werden konnte - einer menschlichen Urgeste, die vor aller Sprache existierte. Seit der Erfindung der Maus gilt für die Entwicklung der Computer, in den Worten George Dysons, nur noch ein darwinistisches Gesetz: »Die natürliche Auslese begünstigt jetzt auf Gedeih und Verderb Maschinen, die besser mit Kindern kommunizieren können, und Kinder, die besser mit Maschinen kommunizieren können.«11
Es ein Mythos, dass sich hinter den Plagen mit dem digitalen Lebensstil ein Generationenkonflikt verbirgt. Teenager, Erwachsene, Senioren: Wir sitzen alle im gleichen Boot.
Und es ist falsch, jeden unter 25 für ein Computer-Genie zu halten. Die Erfolgsrate bei Teenagern, die von einer Website ein Programm installieren sollten, liegt beispielsweise bei fünfundfünfzig Prozent; zehn Prozent niedriger als bei Erwachsenen.
Eine Nielsen-Studie aus dem Jahr 2005 nannte dafür drei Gründe: ungenügende Lesefähigkeit, ungeschickte Suchstrategien und vor allem eine dramatisch geringe Geduldsspanne bei den jungen Menschen.
Dass wir junge Leute mit Computer-Intelligenz assoziieren, hat mit einer optischen Täuschung zu. Die meisten Leute, die Websites betreuen oder erfolgreiche Blogs schreiben, befinden sich an der Spitze des technologischen Fortschritts. Sie sind »Early Adopters«, frühe Anwender. Diese Leute sind laut der Nielsen-Studie gut ausgebildet, sehr intelligent und verbringen viel Zeit online: »Diese Teenager kennen meist nur andere Teenager, die ihr Interesse teilen. Aber diese oberen 5 Prozent sind nicht repräsentativ für die Masse.«12
Kurzum: Wir sind tatsächlich alle betroffen. Wir alle haben zunehmende Probleme, ein Buch zu lesen. Und die Bücher sind nur ein Indiz. »Ich ahne, dass es um viel mehr geht«, schreibt die Internet-Literaturkritikerin Lara Killian, »passen sich unsere Gehirne an, oder sind wir im Begriff, wesentliche kognitive Fähigkeiten zu verlieren?«13 Diese Unfähigkeit ist nicht, wie häufig angenommen, eine Frage des Alters und keine Sache der »digital natives« (derjenigen, die keine Welt ohne Internet und Handy kennen), und ich kann Sie beruhigen: Wir brauchen gar nicht erst die alte Platte von der neuen Dummheit der nachfolgenden Generationen aufzulegen.
Auch die Zeitspannen, die Jugendliche angeblich mit den digitalen Medien verbringen, werden von Erwachsenen locker überrundet. Vergleicht man den Computerspiel-Konsum eines durchschnittlichen Jugendlichen mit der Zeit, die ein Manager täglich an den Tasten seines Blackberry herumspielt, um nach aktuellen Nachrichten zu suchen, wird man auf vergleichbare Zeiten stoßen.
2009 berichtet der Internet-Star Bob Cringely von Freunden, deren sechzehnjährige Tochter namens Echo in einem Monat 14000 SMS entweder empfangen oder versendet hat, was bei ihren Eltern kein Kopfzerbrechen über die finanziellen Kosten - Echo hat einen guten Tarif -, sondern über die Zeit-Kosten auslöste.
Cringely: »Wenn ein typischer Monat 30 Tage hat, also 720 Stunden, von denen wir annehmen können, dass Echo davon ein Drittel schläft, hat sie 480 Stunden zum SMSen pro Monat. 14000 SMSe (eigentlich waren es mehr, aber wir runden es der Einfachheit halber ab) geteilt durch 480 Stunden entsprechen 29 SMSe pro Stunde oder eine SMS alle zwei Minuten.«14
Das ist aber noch nicht alles. Echo muss die SMS nicht nur lesen, sie muss sie auch beantworten, wobei sie für das Schreiben ungefähr doppelt so lange braucht wie für das Lesen. »Der durchschnittliche Teenager braucht ungefähr 20 Sekunden zum Tippen, was bedeutet, dass Echo ungefähr ein Drittel ihres wachen Daseins mit simsen verbringt .«
Das klingt ungeheuerlich. Dramatisch. Ausufernd. Nach Sucht - auch in meinen Ohren. Jedoch: Wie ein Selbstversuch mit Stoppuhr zeigt, könnte ich mit Echo mithalten.
Die einzigen Revolutionäre auf unserem Planeten sind offenbar kleine Kinder. Sie begehren systematisch gegen die Technik-Fixiertheit ihrer Eltern auf, wie die Journalistin Katherine Rosman im »Wall Street Journal« nach Interviews mit vier- bis siebenjährigen Mädchen und Jungen berichtete. Sie spüren, dass die Computer die Aufmerksamkeit ihrer Eltern fressen und nichts mehr für sie übrig bleibt. Allerdings nur, solange ihre natürlichen Instinkte noch wach sind.
Fünfjährige verstecken Blackberrys oder spülen sie die Toilette hinunter, damit ihre Eltern mit ihnen reden. Sie verordnen E-Mail-freie Zonen und ertappen ihre Eltern dabei, wie sie unter dem Tisch heimlich E-Mails abschicken.
»Meine Mutter hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne«, erzählt auch die vierzehnjährige Emma, deren Mutter bei den Prüfungsvorbereitungen ihrer Tochter für die High School statt sie abzuhören »Solitaire« spielte.
Selbst Ältere missbilligen es also, wenn die Kommunikation durch den Computer gesteuert wird, besonders da, wo es ihnen am wichtigsten ist - in der Familie. Die siebzehnjährige Christina Huffington, Tochter der Mitbegründerin der »Huffington-Post« Arianna Huffington, berichtete, dass ihre Mutter immer, selbst während der »Hinabschauender-Hund«-Stellung beim Yoga, den Blackberry benutze: »Ich hatte den Eindruck, dass sie mir niemals zuhört«, so die Tochter, die daraufhin einen Familientherapeuten einschaltete. Woraufhin ihre Mutter ihr einen Blackberry schenkte, damit sie beide besser miteinander kommunizieren konnten.15
UNSER DENKAPPARAT VERWANDELT SICH
ir brauchen kein Tipp-Ex mehr, und die 10 Meter Bücher, die statistisch jeder einzelne Mensch der Welt pro Jahr an gespeicherten Daten produziert, benötigen keinen Regalplatz. Worüber beschweren wir uns also? Information ist kostenlos. Wir sollten uns freuen. Sie kann unendlich oft kopiert und verbreitet werden, und auch das kostet nichts. Aber dass Information gratis ist, heißt nicht, dass wir keinen hohen Preis für sie bezahlen. Information kostet Aufmerksamkeit, wie der Nobelpreisträger Herbert Simon schon 1972 feststellte, und eine Flut an Informationen kann buchstäblich zu einer Armutswelle an Aufmerksamkeit führen.16
Durch die Vielzahl der neuen Medien und durch die Fülle an Informationen, die sie digital versenden, hat bei vielen von uns erstaunlicherweise ein Umbau des Denk- und Erinnerungsapparats eingesetzt. Hirnforscher haben gezeigt, dass sich die neuronalen Verschaltungen in unserem Gehirn verändern, ohne genau sagen zu können, ob noch die Glühbirne am Ende des Stromkreises angeht oder schon die Müllpresse.17 Die neue Architektur verändert auch das Ich, das in ihr wohnt - in einem Tempo, das Evolutionsforscher, milde ausgedrückt, in Erstaunen versetzt. Etliche Hinweise sprechen dafür, dass sich auch unsere geistige Architektur zu verändern beginnt. Es ist eine Verwandlung, wie die von Kafkas Held Gregor Samsa, der eines Morgens erwacht und feststellen muss, dass er über Nacht ein Käfer geworden ist.
Und wenn Sie jetzt meinen, dass das ein abgedroschenes Bild ist, werden Sie später erfahren, dass dieses Bild genau beschreibt, was passiert. Es ist tatsächlich wie bei Kafka: Hinter unserer Verwandlung stecken keine bösen Mächte, niemand sitzt bei Google oder im Silicon Valley, um den Menschen das Denken, Lesen und das Erinnern abzugewöhnen. Im Gegenteil: Es waren die Protagonisten der neuen Technologien, allen voran der Computer-Pionier Joseph Weizenbaum, die als Erste vor dem kognitiven Wandel gewarnt haben, mit dem wir es nunmehr zu tun haben.
Viele von uns registrieren zwar eine Veränderung ihres Denkapparats, aber das scheint sie bisher nicht besonders zu beunruhigen. Irgendwo, so meinen wir, steht schon ein Rechner, der aufzeichnet, was wir vergessen haben, uns daran erinnert, was wir zu tun haben, und uns alarmiert, wenn wir einen Fehler gemacht haben.
Das ist, mit einem Lieblingswort der Epoche, ein »systemischer Irrtum«. In seinem Zellkern steckt das, worum es in diesem Buch vor allem geht: unser Wahn, aus Angst vor Kontrollverlust die Welt in Formeln, Systematiken und Algorithmen, kurzum in Mathematik zu verwandeln. Wir werden immer unfähiger, mit Unsicherheiten und Unwahrscheinlichkeiten umzugehen, und sei es mit der Unsicherheit, welche Information sich hinter der SMS verbirgt, die gerade aufgeleuchtet ist. Wir sind in ständiger Alarmbereitschaft.
Ein Alarm, der dauernd angeht, ist keine Information, sondern eine Ruhestörung.
Als man noch Briefe bekam, konnte man sie zur Not nach Tagen beantworten, manchmal gingen sie auch hilfreicherweise verloren. Mittlerweile aber versteckt sich hinter fast jedem akustischen Informationssignal in unserem Alltag ein tatsächlicher, uns jederzeit umgebender menschlicher Kontakt und erzeugt einen Sozialstress, wie man ihn vorher nur von beleidigten Tanten und Onkeln kannte, für deren Ansichtskarte vom Bodensee man sich nicht bedankt hatte. Jeder weiß, dass E-Mails, auf die man nicht innerhalb von 48 Stunden reagiert hat, niemals beantwortet werden. Selbst wenn man sich entschließt, den Alarm zu ignorieren, ist die Galgenfrist nur kurz, bei SMS beträgt sie wenige Stunden, bei »Instant Messaging Services« Minuten. Die Ingenieure dieser Signale aber haben verstanden und basteln bereits an einer Lösung. »Kein Problem«, sagt Mary Czerwinski, die Arbeitsplatzbeauftragte von Microsoft, »der Computer wird eines Tages verstehen, welche Nachricht wichtig ist und welche warten kann.«18
Die Frage ist nur, ob wir selbst überhaupt noch imstande sind, zu unterscheiden, was wichtig ist und was unwichtig? Wie nicht anders zu erwarten, antworten die Experten auch auf diese Frage wieder mit einer technischen Betriebsanleitung. Die Rechner, sagen sie, werden nicht nur die Nachrichten, sondern auch deren Empfänger, also uns, immer besser verstehen.
Nicht wir haben demnach ein Problem, sondern unsere Geräte.
Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass wir ein ziemlich ernstes Problem haben. »Es könnte sein«, schreibt Daniel Dennett, der ein optimistischer Vordenker der Informa-tions-Technologien war, »dass wir ertrinken…, dass wir seelisch überwältigt werden, dass wir uns nicht den großen bösen Manipulationen unterwerfen, sondern nichts anderem als irgendwelchen unwiderstehlichen Liedchen, Signalen und Einzeilern«.19
GOOGLELOS
Ich gehöre zu den (offensichtlich zahlreichen) Leuten, bei denen Google seit rund einer Stunde nicht erreichbar ist. Und wenn ich »Google« sage, meine ich nicht nur die Suchmaschine, bei der ich im Fall ihrer Nicht-Erreichbarkeit nach Ersatz-Suchmaschinen suchen würde. Ich meine auch den Feedreader meiner Wahl. Und, vor allem: das Mailprogramm meiner Wahl. Gut, ich wusste immer schon, dass ich von Google abhängiger bin, als gut sein kann. Aber ich hatte immer gedacht, das würde sich in einer Form rächen, dass meine Mails oder die systematische Auswertung meiner Suchanfragen der letzten zehn Jahre an den Meistbietenden versteigert würden. Nicht, dass Google mich einfach eines Tages ausschließen würde. Das Gefühl ist schlimm. So kündigt sich in unseren Zeiten die Apokalypse an: »Google ist down.« Der Anfang vom Ende. Beunruhigende Gedanken:… soeben ist nun auch in den südlichen Server ein Flugzeug gestürzt… Dazu die Unfähigkeit, die Tatsache zu akzeptieren, den Computer auszumachen und, sagen wir, das Eisfach abzutauen. Nein. F5. Geht es, wenn ich google.fr eingebe? Nix. Google News? Nix. Google Reader? Nix. Hängt YouTube auch? YouTube hängt auch. Sogar die Google-Ads werden nicht angezeigt. Noch mal nach was suchen. F5. Escape. F5. Ins Postfach gucken. Geht nicht. Jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt?Nachtrag, 17.31 Uhr:Jetzt.
-6. März 2008, 17:09 -105 Kommentare Stefan Niggemeier