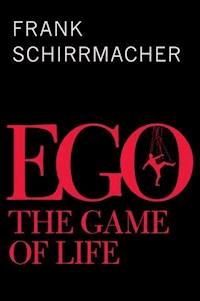11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die wichtigsten Texte Frank Schirrmachers in einem Band
Frank Schirrmacher war bis zu seinem viel zu frühen Tod einer der wirkmächtigsten und debattenfreudigsten Intellektuellen der vergangenen Jahrzehnte. Als Redakteur und später Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie als Buchautor initiierte und prägte er Diskurse wie kaum ein anderer zu den aktuellsten gesellschaftspolitischen Themen. Der vorliegende Band versammelt seine wichtigsten Texte aus drei Jahrzehnten. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Jakob Augstein.
"Frank Schirrmacher war eine zentrale Kraft, vielleicht die eine zentrale Kraft, welche die deutsche Öffentlichkeit am Leben und in Wachheit hielt." Hans Ulrich Gumbrecht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
Frank Schirrmacher war bis zu seinem viel zu frühen Tod einer der wirkmächtigsten und debattenfreudigsten Intellektuellen der vergangenen Jahrzehnte. Als Redakteur und später Herausgeber der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« sowie als Buchautor initiierte und prägte er Diskurse wie kaum ein anderer zu den aktuellsten gesellschaftspolitischen Themen. Der vorliegende Band versammelt seine wichtigsten Texte aus drei Jahrzehnten. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Jakob Augstein.
»Frank Schirrmacher war eine zentrale Kraft, vielleicht die eine zentrale Kraft, welche die deutsche Öffentlichkeit am Leben und in Wachheit hielt.« Hans Ulrich Gumbrecht
FRANK
SCHIRRMACHER
Ungeheuerliche
Neuigkeiten
TEXTE AUS DEN JAHREN
1990 BIS 2014
HERAUSGEGEBEN UND MIT EINEM VORWORT
VON JAKOB AUGSTEIN
BLESSING
1. Auflage
Copyright © 2014 by Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie
Werbeagentur, Zürich
Frank Schirrmachers Texte sind unter dem angegebenen Datum
in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« erschienen.
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«.
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-17032-5
www.blessing-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Mann im Mond
Der Mann im Mond ist gestorben: Die Epoche Neil Armstrongs
Die Rückkehr
Lob eines Kommunisten
Plötzlich sind wir alle Zuschauer
Tod und Jubel
Was gedacht werden kann, wird auch gemacht werden
Zehntausend Jahre Einsamkeit
Der Methusalem-Komplex
Alte, wollt ihr ewig leben?
Das Moses-Projekt
Solidarität mit dem jungen Deutschland
Wir altern im wachsenden Schatten von Riesen
Die Unordnung des Geldes
Demokratie ist Ramsch
»Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat«
Was wird morgen sein?
Die Deutschen und ihre Kriege
Luftkrieg. Beginnt morgen die deutsche Nachkriegsliteratur?
Ein Mann, dessen Werk Deutschland war
Eine Falle namens Thilo Sarrazin
Erziehung vor Verdun
Fangen Sie einfach mal damit an!
Seid ihr überhaupt sicher, dass der Krieg vorbei ist?
Die Geschichte deutscher Albträume
Wir haben ihn uns engagiert. Die Biographie Adolf Hitlers als Geschichte seiner Macht
Erste, zweite und dritte Kultur
Die Nachschulung
Seine Waffe: Aufklärung
Unser Sprößling
Was die SPD verschläft
Grass, Walser, Reich-Ranicki
Das imperative Ich
Den Schmerz verdoppeln
Ein sehr großer Mann
Sein Anteil
Tod eines Kritikers
Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche
Was Grass uns sagen will
Ein Gespräch
Wir brauchen eine neue Sprache für die Erinnerung
Kritik und Literatur
Abschied von der Literatur der Bundesrepublik
Adorno im Ohr
Der Gesang der Sirenen
Der letzte Ritter
Der Traum, aus dem die Stoffe sind
Der Zivilisationsredakteur
Ich will nicht die Welt verändern, ich will Geschichten erzählen
Neunzehn Worte Kafka
Sprich nicht immer von den Tritten der Vernichter
Register
Vorwort
Frank Schirrmacher hatte ein Boot. Es war alt und aus Holz und sehr schnell. Wie ein Pferd bäumt es sich beim Anfahren auf. Es reckt den Bug in die Höhe und stößt nach vorne. Es legt sich aufs Wasser und schießt davon. Im Rücken bleibt die Pfaueninsel, rechts liegt die Heilandskirche, linker Hand die Glienicker Brücke, vor uns das Schloss Cecilienhof. Eine leichte Landschaft ist das, mit heiteren Bauwerken, der Schönheit verpflichtet, dem Spiel. Eine Landschaft für Geschichten.
Frank Schirrmacher steht am Steuer des alten, schnellen Bootes, er braust über Havel und Jungfernsee, und, tatsächlich, »Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee.« Er ist der bedeutendste Journalist des Landes. Sein weißes Hemd flattert im Wind. Seit Jahren denkt er für Deutschland. Seine Themen werden zu den öffentlichen Themen. Ist das eine Übertreibung, eine Anmaßung? Natürlich. Der ganze Mann war eine Übertreibung, eine Anmaßung, die sich selber rechtfertigt.
»Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde …« Kafkas rätselhaftes Fragment beginnt so. Alles ist Bewegung, nach vorn geht der Blick, alles rast. Der Text handelt von einer Unmöglichkeit. »Wunsch, Indianer zu werden« heisst er. Werden. Nicht sein. Am Ende löst sich alles auf, Land, Pferd, Reiter. Alles bleibt unerfüllt. Und das unerfüllte Wünschen steht am Anfang der Geschichte.
Schirrmacher am Steuer seines schnellen Bootes, ein Indianer auf dem Rücken seines rennenden Pferdes, gleich bereit. Er befindet sich von Anfang an in einer einzigen Bewegung. »Immer noch steckt das Fragmentarische bei meinen Anfängen, undeutliche und schroff verbrämte Formen tun sich groß hervor, aber Neues soll werden.« Er war 21 Jahre alt, als er das an Siegfried Unseld schrieb: Neues soll werden. Und was war sein Wunsch? Frank Schirrmacher wollte Frank Schirrmacher werden.
Man versteht inzwischen, dass er es nicht lange bleiben konnte. Der Tod, der ihn am 12.6.2014 in Frankfurt ereilte, war unerwartet – aber nicht überraschend. »Nur allzu plausibel«, sagte Hans Ulrich Gumbrecht in seiner Trauerrede. Es liegt nicht eben nahe, so etwas zu sagen, in der Frankfurter Paulskirche, beim Gottesdienst, wenn einer im Alter von nur 54 Jahren gestorben ist. Vor der Zeit. Lange vor der Zeit. Aber Gumbrecht erkannte in Schirrmacher »eine Gestalt des Exzesses« und »keine auf die Ökonomie des Überlebens bis ins hohe Alter ausgerichtete Existenz«.
Ja, wie ein einziges Rasen, so kommt einem dieses Leben im Rückblick vor: diese ganze, große Fülle und Überfülle von Themen, Texten, Thesen. Ein rasender Reporter der Ideen, das war Schirrmacher. Gleich bereit. Egon Erwin Kisch, von dem der Begriff stammt, war Jahrzehnte zuvor Zeuge der Explosion der technischen Moderne gewesen, als die Zeit zur Maschine geworden war, die Gesellschaft zum Getriebe, und der Mensch seinen Platz im Räderwerk der Geschichte suchte. Im Zeitalter der Digitalisierung ändern sich die Metaphern. Es sind nicht mehr die Räder und Pressen und Walzen, die den Menschen zu verschlingen drohen. Nicht mehr die Stahlgewitter der Somme und die Blutmühle von Verdun, die ihn zermalmen.
Wieder hat ein ungeheurer Wandel die Welt erfasst und Schirrmacher wurde zu seinem Zeugen. Die Automatisierung der Welt, die im Zeitalter der Dampfmaschinen begonnen hatte, wird abgelöst durch die Automatisierung des Menschen im Zeitalter der Denk-Maschinen. Wo endet dann der Mensch?
Wo beginnt die Maschine? Was bleibt vom bestirnten Himmel und vom moralischen Gesetz, wenn Möglichkeit und Wille und Zukunft zu einer Verdichtung von algorithmisch herleitbaren Wahrscheinlichkeiten gerinnen? Schirrmacher war der Reporter der Entkörperlichung. Kein Wunder, dass ein Geisteswissenschaftler in diese Rolle schlüpfte, ein Intellektueller. Wer wüsste mehr von unserer Identität, die bald schon im Entstehen gefährdet sein wird? Von den Geschichten, die uns nicht einfach abhanden kommen, sondern die man uns raubt? Von der schwindenden Hoffnung auf Freiheit unter den Bedingungen von Berechnung und Berechenbarkeit?
Bei Schirrmacher fielen eine echte Sorge und eine tiefe Neigung günstig zusammen. Er sah die Welt bedroht und lebte selber im Genuss der Bedrohung. Der katastrophale Imperativ war die Grundform seiner gedanklichen Grammatik. Die Angst war sein Thema. Angst vor dem Verlust der Identität: der Tod, die Technologie, das Alter, die Verzweiflung, die Ausbeutung – unablässig werden wir in Frage gestellt, werden unsere Grenzen verletzt, gerät unsere Autonomie in Gefahr.
Auf eine paradoxe Weise kamen ihm der Wandel, das Werden, gerade recht. Wenn nichts bleibt, wie es ist, und immer dräut das Kommende. Wenn die Gegenwart immer in Frage steht. Bei Schirrmacher drängte immer alles und alles stürmte. Immer ging es um alles. Über Marcel Reich-Ranicki schrieb er: »Grundsätzlich begann ein Telefonat mit Sätzen wie »Sie wissen nicht, was sich abspielt.«
Aber das galt für ihn selbst. Neues soll werden – und gleichzeitig ist das Neue zu fürchten. Es ist immer größer als das Alte oder gefährlicher. Das gilt überall. Wir sorgen uns um Google und Apple? Schirrmacher schreibt: »Selbst Google und Apple sind nur Start-ups im Vergleich zu der neuen sozialen Software, die gerade ins Gehäuse unserer Gesellschaften implementiert wird.« Immer gibt es eine Ausdehnung, und sei es eine des Risikos. 1991, als er gerade 32 Jahre alt war und seit zwei Jahren Literaturchef der FAZ, sagte er: »Ich habe das sichere Gefühl, dass die großen Tragödien und Katastrophen erst noch kommen werden, gerade für mich und meine Generation.«
Schirrmacher war ein Humanist. So einer ist – je nach den Umständen – manchmal ein Linker, manchmal ein Konservativer, manchmal ein Liberaler, aber er kann nie ein Reaktionär sein. Als es um die große Krise des Kapitalismus ging, fragte ihn Jan Fleischhauer im Spiegel: »Würden Sie es als Beleidung empfinden, wenn man Sie heute als links bezeichnet?«, und Schirrmacher antwortet: »Beleidigung? Darauf käme ich sowieso nicht. Ich finde auch nicht, dass ich mich verändert habe. Ich bin wie wir alle nur Zeuge eines Denkens, das zwangsläufig in die Privatisierung von Gewinnen und die Vergesellschaftung von Schulden führte.« Und es war eine durch und durch bürgerliche Empörung, mit der er der entgrenzten Ideologie des Finanzkapitalismus, die er freimütig als »Neoliberalismus« bezeichnete, vorwarf, »sich im imaginativen Depot des bürgerlichen Denkens« bedient zu haben.
Es ist sein Humanismus, der ihn politisierte, ihn radikalisierte. Die Texte im vorliegenden Band, die zu seinen schönsten gehören, beschreiben Schirrmachers Weg: die Politisierung eines Ästheten. Die Radikalisierung eines Konservativen. Warum wandte sich denn der Experte für Benn und George der Technologie zu? Der Literaturwissenschaftler der Demokratie? Der Kulturkritiker der Gesellschaftskritik? Weil seine Thomas-Mann-Zivilisation in Trümmer geht.
Angst kommt gut an. Andere Menschen haben auch Angst. Und wenn der Intellektuelle Schirrmacher über die alternde Gesellschaft schrieb und über den Verlust sozialer Bindungen, über die Risiken der Digitalisierung und die Verwüstungen des internationalen Kapitalismus – dann folgten ihm auch solche Leser, die niemals das Feuilleton der FAZ in die Finger genommen hätten.
Im Jahr 2004 war der Herausgeber der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« Frank Schirrmacher allen Ernstes fünfmal der »Gewinner des Tages« der »Bild«-Zeitung. Na und? Reich-Ranicki hatte gesagt: »Jawohl, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kritik: dafür zu sorgen, dass Literatur ins Gespräch kommt und im Gespräch bleibt. Darauf kommt es an: die Literatur zu einer öffentlichen Sache zu machen.« Schirrmacher machte seine Bücher, seine Themen, seine Person zur öffentlichen Sache.
Die Gendebatte, die Altersdebatte, die Internetdebatte, die Finanzmarktdebatte – Schirrmacher hatte diese Themen nicht erfunden. Aber er hat sie geprägt. Alarmismus, Lust an der Kampagne, Sucht nach Öffentlichkeit, Erfolgsverliebtheit – all das hat man ihm vorgeworfen. Und alles zu Recht.
Dass sie es hier mit einem Ausnahmemenschen zu tun haben, konnten all jene, die die Regel sind, freilich schwer verkraften. Für Schirrmacher, der es jung an die Spitze geschafft hatte, galt das Nietzsche-Wort: »Ich überspringe oft die Stufen, wenn ich steige – das verzeiht mir keine Stufe.«
Als er dann starb, ging eine große Erschütterung durch das Land. Man hatte so etwas bei einem Journalisten noch nie erlebt. Was für Nachrufe! Die verzweifelten seiner Freunde, die bittersüßen seiner Opfer, die bewundernden seiner Beobachter.
Aber was ist das Erbe eines Journalisten? Was bleibt von dem, dessen Beruf an den Tag geknüpft ist? Was hinterlässt der Feuilletonist Frank Schirrmacher – und was wird aus seinem Feuilleton? Was bleibt, was er hinterlässt, was sein Erbe ist: es ist die Lücke, der leere Platz.
Wie leer dieser Platz ist, zeigte sich, als neulich ein Journalist einen anderen, der bei der FAZ arbeitet, fragte: »Braucht die FAZ nicht dringend eine Galionsfigur.« Die nüchterne Antwort lautete, man möge bitte die Galionsfiguren nicht überschätzen: »Galionsfiguren bilden den Bug des Schiffes und teilen die Wellen wie Moses einst das Rote Meer.« Und dann kam noch ein Verweis auf die »strukturellen Veränderungen«, unter deren Bedingungen sowieso alles anders und neu sei.
Mit Schirrmacher war einer gestorben, den wir noch brauchten, der mit uns noch nicht fertig war. Wer entsetzt sich nach ihm über den »Defätismus einer Gesellschaft, die in den letzten Jahren, ohne es zu merken, eine verheerende Vernichtung ihrer Ideale erlebt hat«? Wer trägt die Empörung weiter, die wir für unsere politische Moral so dringend brauchen? Ohne Schirrmacher droht das deutsche Feuilleton wieder da anzukommen, wo der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer es gegen Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts vorgefunden hatte: »Es ist, als hätte keiner ein Ziel. Eine heftige Sehnsucht. Eine Marotte von mir aus. Einen Maßstab, der wenigstens für ihn selber taugt und zu dem er seine Leser verpflichten möchte. Eine Begeisterung, eine Neugierde, eine Wut auch.«
Wenn man die Bücher, die Artikel, das Feuilleton der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« und das der zugehörigen Sonntagszeitung einmal beiseite legt – und da legt man schon eine Menge beiseite –, dann hinterlässt Frank Schirrmacher eine Erinnerung: In der Ära seiner größten Krise erinnerte Schirrmachers Tod daran, wie lebendig der Journalismus sein kann.
Er war ein ganz und gar unwahrscheinlicher Mann. Eine Geschichte. Zu Lebzeiten. Nach seinem Tode noch mehr.
Jakob Augstein, Mai 2015
Der Mann im Mond
27.08.2012
Der Mann im Mond ist gestorben: Die Epoche Neil Armstrongs
Er wurde stets abweisend, wenn es um die Mondlandung ging, bestritt seine Leistung, sprach ungern darüber. Fast war es, als habe der erste Mensch auf dem Mond gewusst, dass weder der Mond noch der Mensch das Entscheidende daran war, sondern die Maschine, die beides zusammenbrachte
Der Tod Neil Armstrongs ist der Tod des ersten Menschen, den eine ganze Welt in eine, von Armstrong so genannte »Suppendose« steckte, an Kabel anschloss, mit Strom versorgte, mit einer strahlungs- und luftundurchlässigen und mit unzähligen Sensoren versehenen Larve überzog, um seinen Herzschlag, Puls, innere Organfunktionen an ein großes Zentralgehirn in Texas zu funken, mit ungeheurem Schub versah – alles damit er auf einem Felsbrocken landen, aussteigen, eine Fahne hissen, Steine sammeln, einsteigen und wieder zurückfahren konnte. Es starb, das wissen wir, der erste Mensch, der den Mond betrat.
Es starb aber, und das ist im Jahre 2012 von ebenso großer Bedeutung, der erste Mensch, der ein Weltbild nur verändern konnte, indem er vollständig mit der Maschine verschmolz. Armstrong, gefragt, was seine eigentliche Leistung sei, antwortete wie Bilbo Beutlin im »Hobbit«, der seiner aufregenden Lebensgeschichte den Titel »Hin und zurück« gab: »Ich bin aus etwas ausgestiegen und wieder eingestiegen.«
Aber auch das ist, wie Armstrong sofort zugeben würde, nicht ganz richtig: Auch als er im Raumanzug seine ersten Schritte auf dem Mond tat, lebte er im Inneren der Maschine, sosehr, dass auf den Fotos dort, wo das Gesicht sein müsste, nur ein Spiegel zu sehen ist. Jahrtausendelang haben Menschen ein Gesicht im Mond imaginiert und später, mit Teleskopen, Gesichter in den toten Wüsten des Mars; aber es gibt kein Gesicht des Menschen, der den Mond betritt. Nur seinen Fußabduck.
Anfang der sechziger Jahre hatte das Universalgenie Manfred Clynes, ein Musiker, der Einstein betörte, und ein Autodidakt, der den Computertomographen erfand – wie so viele, die eine neue Cyber-Logik entwarfen, ursprünglich ein Österreicher –, den Begriff »Cyborg« geprägt. Gemeint war eine Mensch-Maschine-Einheit, die in feindlichen Umwelten die Lebensfunktionen mit der Maschine verschmolz. »Ich dachte, es wäre gut, ein Konzept zu entwickeln, das es Menschen ermöglicht, sich von den Beschränkungen ihrer Umwelt in dem Ausmaß zu befreien, wie sie es wünschten. Also erfand ich das Wort Cyborg.« Schon kurz darauf wurde die Nasa auf das Papier aufmerksam und verwirklichte mit Clynes’ Hilfe selbstlernende Systeme, die in Gestalt des Raumanzugs den Metabolismus des Körpers ersetzten oder zumindest unterstützten.
Niemals zuvor, die Hündin Laika eingeschlossen, waren biologische Organismen so konsequent als Informationssysteme gelesen worden. Gewiss, das Kontrollzentrum in Houston war nichts gegen Apple und Google, die bald schon aus jeder Handbewegung Schlüsse ziehen wollen. Aber immerhin gehörte die mentale Verschmelzung mit der Maschinen-Hülle, wie Armstrong berichtet, zu den wichtigen Trainingseinheiten der Astronauten.
Wer sich fragt, wieso Armstrong so schweigsam, abweisend, unpersönlich wurde, wenn es um die Mondlandung ging, und so enthusiastisch, beglückt und offen, wenn es um Flugzeuge der fünfziger Jahre ging, der findet hier die Antwort. Wer ihn traf, der begegnete einem Mann, der über nichts so ungern sprach wie über die Mondlandung. Er bestritt seine eigene Leistung, und aus seinen unprätentiösen Schilderungen des »Vorher« – des jahrelangen Trainings, der Reise durch den Weltraum zum Mond, des Funkverkehrs mit Houston, der Übermittlung von Daten – wurde klar, dass es sich bei der Mondmission um die erste »Eroberung« von Menschen gehandelt hat, die der Beteiligte im Zustand der Vollautomatisierung erlebte.
Was das bedeutet – es spielte damals in der Berichterstattung kaum eine Rolle – beginnt man erst heute, im Zeitalter von Computer, Drohnen und Cyber-Warfare, zu erahnen. Es gehört zu den unerwarteten Pointen der »Eroberung des Weltalls«, dass sich nach der Mondlandung die Erdanziehungskraft zu verdoppeln schien. Das war auf allen Ebenen spürbar. Die ersten Astronauten fanden nur mit Mühe, manche gar nicht, ins Leben zurück. Es ist leichter auf dem Mond spazieren zu gehen, als auf der Erde glücklich zu werden.
Keiner schien sich dessen so bewusst wie Neil Armstrong. Der erste Mann auf dem Mond hat sich gerettet, indem er eine Mauer des Schweigens um sich aufbaute. Schon der zweite Mann auf dem Erdtrabanten, Buzz Aldrin, hatte zu viel geredet, als er wieder unter Menschen war, und dafür mit Depressionen und Alkoholismus bezahlt. Die Nasa hat später Korrekturen an ihrem psychologischen Programm vorgenommen. Kein Mensch hatte geahnt, dass die Rückkehr das wirkliche Problem werden würde.
Aber auch auf der Erde war die trügerische Zeit der Schwerelosigkeit vorbei. Kennedy, der die Vision gehabt hatte, Menschen innerhalb von zehn Jahren auf den Mond zu schicken, war tot. Jetzt begrüßte Richard Nixon die Heimkehrer. Amerikanische Fernseh-Networks beschwerten sich, dass die Bilder aus dem All zu langweilig waren. Bald schalteten sie sich reihenweise aus den Live-Übertragungen aus.
Keine vier Jahre nach dem Ereignis veränderte die Ölkrise die gesamte Nachkriegsökonomie. Jetzt kam man zwar zum Mond, aber an autofreien Sonntagen nicht einmal mehr von Hamburg nach Bremen. »Die Erde hat sie wieder« war die triumphale Nachricht des Jahres 1969 für die Herren Armstrong, Aldrin und Collins. Für die Spezies selbst, zumindest aus der Sicht der Technologen, klang das bald eher nach lebenslanger Haft. Die Babyboomer erlebten die Mondlandung als Metapher.
Neil Armstrong war ihr Kolumbus (plus Charles Lindbergh, bei besserem Charakter), sie verbanden mit ihm zwei spezifische Erfahrungen von Freiheit: dass sie am 21. Juli 1969 bis 3.56 Uhr wach bleiben durften (was wenigen gelang) und die Verwendung des Wortes »schwerelos« für Momente des Glücks. Sie bekamen von ihren Eltern und Lehrern gesagt, wie groß der Mensch sei und was er zu leisten vermag, es war vielleicht nicht unbedingt nutzbringend, auf dem Mond zu landen, aber gerade deshalb war es groß. Was würde jetzt noch alles möglich sein, was entdeckt, erobert, bewältigt werden? Wer den Mond betritt, kann auch – um nur ein paar reale Prognosen des Jahres 1969 zu nennen – alle Krankheiten besiegen, die Armut überwinden, Teleportationsgeräte bauen und seinen Hausroboter zum Brötchenholen schicken.
43 Jahre später ist die Metapher »Apollo« gewissermaßen entkleidet, dismantled, bis zu dem Punkt, wo man auf das Zentralhirn der Operation trifft. Aller Fortschrittsoptimismus entzündet sich nun an der Mensch-Maschine-Schnittstelle, und es vergeht kein Tag, ja fast keine Stunde, in der nicht neue Visionen, wie wir angeblich leben und denken werden, den Markt überfluten. Aber zwei erwachsene Babyboomer, die unterschiedlicher nicht sein können, haben völlig unabhängig voneinander, an verschiedenen Orten, aber zur gleichen Zeit die fast identische Frage gestellt. »Warum«, so fragen sie, »hat man die Versprechen gebrochen, die man uns damals gegeben hat?«
Der eine, Peter Thiel, geboren 1967 in Frankfurt am Main, Milliardär, vermutlich der mächtigste Investor seiner Generation, ist ein Heros der Wall Street und des Silicon Valley. Der andere, David Graeber, geboren 1961 in den Vereinigten Staaten, Anarchist, Anthropologe, ist Mitbegründer der Anti-Wall-Street Bewegung »Occupy« und Verfasser des Bestsellers »Schulden«. In einem Augenblick, wo alle sich einig sind, dass es die Technologie ist, die das Antlitz der Erde und uns selbst verwandelt hat, durchlöchern sie das Selbstbewusstsein der technokratischen Intelligenz mit ihren Fragen: Wieso ist die Zukunft zu Ende? Warum gibt es seit vierzig Jahren fast keinen wirklichen technologischen Fortschritt mehr, der die Versprechungen einlöst, die uns gemacht wurden?
Wo ist der Sieg über den Krebs, den der amerikanische Kongress für 1976 – eine Art Apollo-Programm für den Menschen – verkündet hat? Wo die billige und risikolose Energie, die für 1980 versprochen wurde? Wie lange warten wir noch auf das »Ende der Arbeit«, utopische Epoche eines gut versorgten Robinson-Lebens, die für das Jahr 2000 versprochen worden war? Wo der Wohlstand, der die Kinder besser leben lässt als ihre Eltern? Was ist aus den fliegenden Autos geworden, den Marskolonien oder auch nur den Robotern, die Wäsche in die Reinigung bringen?
Das alles waren Versprechungen der technologischen Hardware, bis hin zu den Roboter-Ärzten, die längst unsere Krankenhäuser bevölkern müssten. Im Jahre 1900, bemerkt David Graeber zu Recht, haben Jules Verne und H.G. Wells einem ungläubigen Publikum die Welt des Jahres 1960 ausgemalt: mit Flugzeugen, Unterseeboten, Radio, Fernsehen und der Mondlandung. Genau das haben wir bekommen. Doch die Prognosen des Jahres 1960 sind niemals Wirklichkeit geworden. Keiner der angekündigten Durchbrüche auf dem Gebiet der Medizin, Robotik, Nanotechnologie, Raumfahrt oder Arbeit hat sich erfüllt, und einige der großen Erwartungen – von der banalen Geschwindigkeit bis zu den Realeinkommen und der Kaufkraft, haben sich sogar irgendwann zurückentwickelt.
Doch was noch gravierender ist: alles, was wir heute erleben, ist im technologischen Kern bereits in den fünfziger und sechziger Jahren erfunden worden. Und vieles war in die Apollo-Kapsel, die Neil Armstrong bediente, und sei es in der embryonalen Form, schon eingebaut. Das einzige Gebiet, auf dem sich die exponentielle Wachstumskurve wirklich vollzogen hat, betrifft die Leistungsfähigkeit von Computerchips. Moores Gesetz, das die Verdoppelung der Leistung bei gleichzeitiger Halbierung des Preises voraussagte, ist dadurch zum Schlüsselparadigma der ganzen Welt geworden, obwohl, bei Licht betrachtet, es sich nur um eine Technologie unter vielen handelt.
Doch selbst hier ist nicht eingetreten, was die Prognosen voraussagten. Computer sind keine autonomen, intelligenten Wesen geworden, mit denen man sprechen und konferieren kann, sondern Container, die wir mit unserer Intelligenz füttern. Solche Ernüchterung ist nötig, weil sie gegen den PR-Wahn des Silicon Valley ebenso immunisiert, wie gegen ein großes Missverständnis. Die Mondlandung als Paradigma einer Reise und einer Eroberung ist Geschichte, und ihr folgt eine traurige Phase von Visionsarmut und Verzagtheit. Die Mondlandung als Paradigma des Cyborg ist Gegenwart und ein Bestandteil jener sozialen Physik, mit der die Gesellschaft immer effizienter als automatischer Markt gescreent und organisiert wird.
Nicht der Mond und die atemberaubende und bescheiden machende Ansicht des Weltalls, sondern der geschlossene Raum der Kapsel, in der sich Neil Armstrong nur ein einziges Mal als Handelnder erlebte – als er kurz vor der Landung gegen den Computer entschied –, ist der geometrische Ort der Epoche. »Der Weltraum, unendliche Weiten« – wie es bei »Raumschiff Enterprise« hieß? Er sehe sich gerne die Sterne an, war eine der Standardantworten von Neil Armstrong. Das digitalreligiöse Magazin »Wired« hat gerade einen Bericht über jene High-Frequency-Trader veröffentlicht, die ihre Server neben den Hauptservern der New Stock Exchange plazieren, um 0,01 Millisekunden schnellere Informationen für den Börsenhandel zu bekommen. Und dann fällt da ein Satz: In dem Moment, wo ein normaler Kunde einen Aktienkurs sieht, ist es so, als sähe er einen Stern, der schon seit Jahrtausenden erloschen ist.
07.08.2004
Die Rückkehr
Ein Wort des großen Chesterton: »Es heißt immer, man könne die Uhren nicht zurückdrehen. Aber wenn sie falsch gehen, kann man genau das machen: sie zurückdrehen.« Und das geschieht nun mit der völlig aus dem Takt gekommenen sogenannten Rechtschreibreform.
Sie ist ein öffentliches Unglück. Sie hat eine verwirrte Sprach- und Schreibgemeinschaft hinterlassen, ein Land, in dem die Eltern anders schreiben als die Kinder, die Kinder anders als die Schriftsteller, deren Werke sie im Unterricht lesen, die Schriftsteller anders als die Zeitungen und Zeitschriften, in denen sie gedruckt werden, und von diesen jede anders als die nächste. Das Ziel einer Vereinheitlichung und Vereinfachung der deutschen Schriftsprache ist auf monströse Art verfehlt worden. Schon deshalb ist die Feststellung berechtigt: Die Reform der deutschen Rechtschreibung ist gescheitert.
Sie war einst geplant, weil man einen Alleingang der DDR befürchtete. Als diese zerfiel, tagten die Ausschüsse und Gremien weiter, als hätte man vergessen, sie abzuberufen. Entstanden ist schließlich das letzte planwirtschaftliche Experiment auf deutschem Boden. Sprache, der lebendige Organismus, ist keine LPG und läßt sich nicht umbauen wie ein Einkaufszentrum.
»Wir haben im Augenblick wichtigere Sorgen als die Rücknahme der Rechtschreibreform«, verkündete unlängst der sächsische Ministerpräsident. Er vergaß freilich hinzuzufügen, daß wir mit der Rechtschreibung gut lebten, ehe sie in die Hände der Politiker fiel. Auch damals veränderte sie sich, und kein vernünftiger Mensch hat sich dem je entgegengestellt. Aber Evolution durch Gebrauch ist etwas anderes als Reform durch Verordnung. Daß die Politiker wichtigere Probleme zu lösen haben als die, die sie ohne Not in die Welt gesetzt haben, ist eine Lektion nicht nur für die Rechtschreibreform, sondern für Reformen überhaupt.
Dabei waren alle guten Willens. Diese Zeitung hat es ein Jahr lang mit der neuen Rechtschreibung versucht. In der »Welt« erklärte bereits 1998 Mathias Döpfner: »Solange es irgendwie möglich ist, schreiben wir weiter nach alten Regeln. Die Rechtschreibreform wird sich nicht durchsetzen.« Im »Spiegel« hatte Rudolf Augstein die Redaktion ermächtigt, in der alten Rechtschreibung weiterzuschreiben. Daß diese Verlage, wie auch viele andere, dann doch zur neuen Rechtschreibung wechselten, kann ihnen niemand vorwerfen. Auf dem Spiel stand die Einheitlichkeit der deutschen Sprache. Die Sorge, womöglich anders zu schreiben, als in Schulen gelehrt wird, beschleunigte den Prozeß.
Daß jetzt der »Spiegel« und der Axel Springer Verlag zur alten Rechtschreibung zurückkehren, ist mutig und angesichts des Einflusses der beiden Verlage folgenreich. Die Verlage handeln, wie auch diese Zeitung, aus Not, nicht aus ideologischem oder wirtschaftlichem Kalkül. Darin müßten sie von der Öffentlichkeit bitter ernst genommen werden: Ihr Schritt sagt nichts anderes, als daß es beim besten Willen nicht mehr geht.
Sprache ist das Handwerkszeug von Schriftstellern, Journalisten und Verlagen. Wie ein Schuhmacher oder ein Schmied wissen sie am besten, wenn man ihnen die Werkzeuge kaputtmacht. Fast jede Redaktion in Deutschland hat eine hausinterne Rechtschreibung entwickelt. Selbst diejenigen, die sich der neuen Rechtschreibung bedienen, äußerten sich oft geradezu verzweifelt. Die logischen und semantischen Abgründe, die die neue Rechtschreibung aufreißt, sind ruinös nicht nur für hochgeistige Werke.
Die »Süddeutsche Zeitung«, die weiß, was Sprachkultur ist und keiner Belehrung durch die Kultusbürokratie bedarf, schrieb vor wenigen Wochen: »Die Kultusminister spielen auf Zeit. Sie hoffen, daß entweder die Gewöhnung an den Unsinn oder die Verwirrung einen solchen Grad erreichen, daß niemand mehr weiß, wo ihm der Kopf steht.« Auch die »Süddeutsche Zeitung« hat sich jetzt zur Rückkehr zur alten Rechtschreibung entschlossen.
Es ist zu hoffen, daß die Umkehrung der Reform nicht zu einer Prestigefrage wird. Der »Spiegel« und die Axel Springer AG, wie auch diese Zeitung, haben erklärt, daß auf der Basis der alten Rechtschreibung sinnvolle Neuerungen durchaus übernommen werden können. Voraussetzung einer Reform ist, daß sie funktioniert, daß eintritt, was versprochen wird. Das Versprechen lautete: Einheitlichkeit, Einfachheit und größere Sinnhaftigkeit. Alles wurde durch die Praxis grotesk widerlegt. Die Reform war ein handwerkliches Desaster, und hier wird sie in der Tat zu einem Problem für die Politiker. Ratlos steht man vor der Erkenntnis, daß es in Deutschland offenbar unmöglich ist, etwas als falsch Erkanntes zu widerrufen.
Die Bundesregierung hat jüngst erklärt, sie bestehe auf der Reform, und brüskierte damit ihre eigene Kulturstaatsministerin. Der Grund dafür ist nicht bessere Einsicht oder die literarische Expertise des Kanzlers. Der Grund ist selbst ein sprachlicher. Man hat Angst, daß das Wort »Reform« gleichsam kontaminiert wird, daß die Rechtschreibreform, für die die derzeitige Regierung übrigens keine ursächliche Verantwortung trägt, nun zum Symbol von Reformunfähigkeit wird, zum Menetekel, das die Inkompetenz der politischen Klasse in giftiges Licht taucht.
Das Gegenteil ist wahr. »Spiegel« und der Axel Springer Verlag sind so sachlich wie der Technische Überwachungsverein: Was nicht funktioniert, dessen Zulassung wird widerrufen. Im Jahr 2004, das Historiker später einmal unter dem Stichwort der »Reform« mustern werden, ist die Auseinandersetzung um die Rechtschreibreform ein Symbol: Sie zeigt den Politikern die Grenzen ihrer Zuständigkeit.
10.02.1998
Lob eines Kommunisten
Unter den deutschen Schriftstellern war Bertolt Brecht, obgleich nie Parteimitglied, der bedeutendste Kommunist. Unter den Kommunisten war er der bedeutendste Schriftsteller. Es gab viele, die orthodoxer, und einige, die phantasievoller waren; aber nur ihm gelang es, die Orthodoxie zum Antrieb seiner künstlerischen Phantasie zu machen. Er hat den historischen Materialismus zur Magd seiner Kunst bestellt. Einmal, als er versuchte, das »Kommunistische Manifest« in Verse zu setzen, intervenierte der besorgte Feuchtwanger mit der Bemerkung, man könne Karl Marx nicht verbessern. Doch ebendies war Brechts Absicht. Seine Literatur sollte die Lehre ästhetisch aufbessern und dadurch gebrauchsfähig machen. »Die Theorie«, so lautete Marx’ berühmte Formulierung, »wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.« Brechts Theaterkunst war die Kunst einer Wegabkürzung.
Alle Einwände gegen Brecht sind bekannt. Seit es den politischen Autor Bertolt Brecht gibt, hat man von seinen Widersprüchen geredet. Man hat, gleich nach seinem ersten großen Erfolg, darauf hingewiesen, daß sein Publikum wenig mit den entrechteten Massen, aber um so mehr mit dem Establishment zu tun hatte. Man hat gezeigt, wie Brecht seinen revolutionären Impuls immer wieder brach, auch verriet. Es gibt in seinem Werk Passagen von geradezu terroristischer Grausamkeit. Ungerechtigkeit strahlt immer wieder von ihm aus und dazu jener Mangel an humaner Phantasie, der ihn etwa bei Stalins Emissären nur einmal zaghaft nachfragen läßt, was aus den im GULag verschollenen Freunden geworden ist.
Sich darauf zu einigen, wie es heute allenthalben geschieht, daß Brecht kein ganz guter Mensch war, wäre ein dürftiges Resümee. Er hatte zu Menschen, zum Werk und auch zu den kommunistischen Klassikern ein Gebrauchsverhältnis. Liest man die Zeugnisse seiner politischen Erweckung, dann erkennt man, daß der Kommunismus für ihn die Rolle einer Inspirationsapparatur spielte. Die hochabstrakten Klassiker, die Brecht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt ihrer Anwendung durch Lenin las, erlaubten es dem Künstler, die Komplexität der modernen Welt noch einmal auf einige wenige Grundbegriffe zu reduzieren. Sein Freund Walter Benjamin hat dies einmal, Brecht zitierend, »plumpes Denken« genannt und damit das Denken der Unterdrücker und Ausbeuter gemeint. Doch solche Plumpheit, mit den Mitteln leninistischer Dialektik ins Werk gesetzt, beförderte überhaupt erst die staunenswerte Karriere mancher der Brechtschen Platitüden. »Wer für den Kommunismus kämpft«, heißt es einmal, »hat von allen Tugenden nur eine: daß er für den Kommunismus kämpft.«
Dergleichen stand in der Tradition der kommunistischen Gebrauchsliteratur: Der Lehrer des Volkes bringt den Schülern überhaupt erst die Grundbegriffe der Weltverständigung bei, jenes »ABC des Kommunismus«, mit dem Bucharin einst eine ganze volkspädagogische Industrie begründet hatte. Für Brecht war es viel mehr. Denn bevor er, wie er später schrieb, in einer »epochalen Entdeckung« den Kommunismus fand, hatte der junge Augsburger Künstler sich selbst entdeckt. Befeuert von dem Ehrgeiz, unter allen Umständen und mit allen Mitteln Klassiker zu werden, Vorgänger und Nebenbuhler auszulöschen, mußte er die große Versuchung des kommunistischen ABC spüren. Überall erprobten die Schriftsteller der zwanziger Jahre neue Formen, neue Sprachen, neue Wörter. Brecht ergriff seine Chance sofort. Der Kommunismus, in ein ästhetisches Programm verwandelt, bot die Chance, ein neues, von keinem seiner Vorgänger benutztes Alphabet zu lehren.
Ein großes Talent, so hat Brechts Gegenspieler Thomas Mann bemerkt, sucht sich, was es braucht: Es übernimmt jede Tradition, die seine Inspiration befördert. Thomas Mann sprach von seiner eigenen bürgerlichen Bildungsgeschichte, in der er später Elemente der Unheilsgeschichte Deutschlands zu entziffern glaubte. Im »Faustus« gehe es um das Motiv »der schlimmen Inspiration« – und also um Nietzsche, Wagner und schließlich um Hitler. Heute ist jedermann klar, daß es unter der politisierten Intelligenz des Jahrhunderts auch die kommunistische, scheinbar rationalere, aber gleichfalls unheilvolle Seelenverschreibung gegeben hat. Versteht man Brechts soeben erschienene melancholische Briefe aus den letzten Lebensjahren recht, so machte er sich über den Preis, den sein Pakt ihn kostete, am Ende kaum noch Illusionen.
Manche faustische Seele fühlt sich noch heute Thomas Mann und seinem »fehlgegangenen guten Deutschland« näher und bestreitet Brecht jeden Anteil an den besten Traditionen des Landes. Das ist nicht nur literarhistorischer, sondern auch politischer Unsinn. Die Irrtümer der beiden nehmen sich nichts. Es war Brecht, der am 1. August 1943 einen Schriftstellerappell initiierte, in dem die amerikanische Regierung gebeten wird, »scharf zu unterscheiden zwischen dem Hitlerregime und den ihm verbundenen Schichten einerseits und dem deutschen Volke andrerseits«. Einen Tag später zog Thomas Mann die schon geleistete Unterschrift zurück mit der Bemerkung, er könne es nicht falsch finden, wenn »die Alliierten Deutschland zehn oder zwanzig Jahre lang züchtigen«.
Gewiß: Was der eine zur Hölle schicken wollte, dem glaubte der andere einmal, den Himmel auf Erden bereiten zu können, und beides wirkt im Rückblick nur noch irregeleitet, anmaßend und schrill. Aber irgendwo unter den lastenden Betondecken all dieser Systeme und Genialisierungen und welthistorisch herbeiphantasierten Zuständigkeiten hört man in der Literatur die Stimme des einzelnen. Zweifelnd, gefühlsmächtig noch an der Gefühllosigkeit leidend, ungeduldig und dabei oft ganz einfach und klar. Man hört sie bei dem heute Hundertjährigen, in den Gedichten Bertolt Brechts.
04.05.2011
Tod und Jubel
Keine Trauer um Usama Bin Ladin. Aber Freude darüber, dass ein Mensch getötet wurde? Und gleichsam auch noch amtlich?
Es gibt viele Gefühle, die man angesichts des Todes von Usama Bin Ladin in sich entdecken kann. Gehört »Freude« dazu? »Ich freue mich, dass es gelungen ist, Usama Bin Ladin zu töten«, sagte die Bundeskanzlerin am Montag, und viele freuten sich mit ihr. Ein Satz, der einem leichtes Frösteln bereitet. Genugtuung, dass Bin Ladin das Handwerk gelegt worden ist. Freude, dass es dem Mörder nicht gelungen ist, sich dauerhaft zu verstecken – all das sind verständliche Reaktionsmuster. Gewiss: Angehörige seiner tausendfachen Opfer werden ihre Rachegefühle befriedigt sehen – wer wollte es ihnen verdenken? Aber Freude darüber, dass einer getötet wurde? Und die gleichsam auch noch amtlich?
ENDE DER LESEPROBE