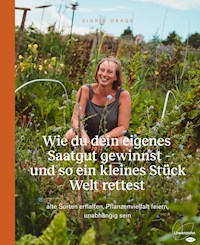Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Löwenzahn Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wir leben auf heißen Pflastern: Superelement Wasser effizient nutzen In diesem Buch geht es um die wichtigste Ressource unserer Erde: Wasser! Und zwar, weil es der Schlüssel der Natur ist und in Gärten, auf land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, in Siedlungsräumen und generell auf Landschaftsniveau besondere Beachtung verdient. Gerade die immer häufiger auftretenden Wetterextreme, die dazu führen, dass Wasser oft entweder Mangelware oder Überfluss vorhanden ist, zwingen uns, das Thema genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn: Wasser ist zwar für uns alle lebensnotwendig, doch es kann auch zum Problem werden, z. B. wenn es vom Boden nicht mehr aufgenommen werden kann, weil viele Flächen so stark baulich verändert wurden. Und genau hier setzt die Autorin Sigrid Drage mit ihrem Buch an: bei der Gestaltung von Flächen. Ob dem eigenen kleinen oder größeren Garten, den Grünflächen in der Gemeinde oder auch auf größeren landwirtschaftlichen Flächen. Catch me if you can: Auffangen, was anfällt "Das fällt auch nicht vom Himmel" gilt bei Gießwasser … nur bedingt. Aber weil in manchen Regionen zunehmend Trockenheit herrscht, ist es (nicht nur dort) umso wichtiger, Regenwasser effizient aufzufangen. Sigrid Drage beschreibt im Detail, wie das am besten geht und welche anderen Möglichkeiten es gibt, vorhandene Wasserressourcen sinnvoll weiterzuverwenden und aufzubereiten: Stichwort Grauwasser. Damit das Regen- oder Grauwasser nicht nur wirksam aufgefangen, sondern genauso zielgerichtet zum Bewässern eingesetzt werden kann, gibt es im Buch außerdem einen Crashkurs zum Thema Gießen. Mit der richtigen Taktik - wie beispielsweise dem Gießen zu einer bestimmten Tageszeit - kannst du die Pflanzen in deinem Garten oder auf dem Balkon nämlich "erziehen". Und nicht zuletzt spielt im Wasserkreislauf auch die Permakultur eine große Rolle. Von Hügelbeeten, Humus und Hitzeprofis Einen klimafitten Garten planen und ganz neu anlegen: Das ist das Best-Case-Szenario, keine Frage. Aber was, wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist? Wenn der Garten mit zunehmend schwierigen klimatischen Bedingungen wie langer Trockenheit, Stürmen oder starken Regenfällen zurechtkommen muss? Dann heißt es: umdenken! Und die Lage checken: Welche Zonen im Garten liegen zum Beispiel niedriger als andere, sodass sich Wasser sammeln kann und sich durstige Pflanzen dort besonders wohl fühlen? Wie du einen gründlichen Lagecheck durchführst, warum Humus ein unschlagbarer Wasserspeicher ist, wie er entsteht - und welche Pflanzen mit Hitze gut zurechtkommen: All das fasst Sigrid Drage ebenso ausführlich wie praxisnah zusammen und hat mit diesem Buch einen wichtigen Wissensschatz zum Thema Wasser geschaffen! - Schlüsselressource Wasser – ohne läuft gar nix: Genau deshalb ist es so wichtig, sich um das Thema Wasser zu kümmern: Wie lässt sich Wasser am besten speichern und nutzen? Was hat die Qualität des Bodens und die Gestaltung des Gartens mit dem Ganzen zu tun? - It's all connected: Keine oder überdurchschnittlich starke Niederschläge, regelmäßig sehr heiße Tage – der Wasserkreislauf ist aus dem Lot. Sigrid Drage zeigt, wie dein Garten-Ökosystem auch dann zurechtkommt, wenn es heiß hergeht – und an welchen Stellschrauben du in deiner Umgebung drehen kannst. - Alles im dynamischen Gleichgewicht: Die Permakultur liefert eine Fülle an Werkzeugen, die Autorin praxiserprobtes Know-how und Beispiele: von Mulchmaterialien über Mischkulturen, Swales und Speicherteiche, Hecken und Aquakulturen bis hin zu Methoden für Humusaufbau und Grauwassernutzung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WASSER!
Über ein Element, von dem alles abhängt
Wasser: Im Garten. In der Landschaft. Im Kreislauf.
Unsere Krisen – unsere Handlungsmöglichkeiten: Wir können viel tun!
Beginne mit dem Wasser
Dieses Buch soll dir dabei helfen
Wasser: Ein paar Hard facts
IT’S ALL CONNECTED: ALLES ÜBER WASSERKREISLAUF UND WASSERHAUSHALT
Wie das Wasser auf seinem Kreislauf alles in Verbindung setzt
Die Sonne als Motor, aber gesteuert wird von Land und Wasser
Was sind also die wichtigsten Prozesse des Wasserkreislaufs?
Der Wasserkreislauf ist hochsensibel
Was der Wasserkreislauf noch alles kann – außer Wasser zu transportieren
Eine Schlüsselstelle? Dort, wo das Wasser auf den Boden trifft
Wasser als Schlüsselressource: der Wasserhaushalt
Wir sind dran!
Der Wasserkreislauf und der Wasserhaushalt der Pflanze
Wasserretention ist das Zauberwort
WAS KLIMA- UND LANDSCHAFTSWANDEL MIT WASSER ZU TUN HABEN
Wie alles unausweichlich zusammenspielt, ohne dass wir uns entziehen können
Die Zusammenhänge werden immer komplexer, aber so ist eben das Leben
Was ist Klima, was ist Wetter?
Landschaftswandel: Alles wird glatter
Zu heiß!
Was für eine Katastrophe: Unsere Vulnerabilität
BIODIVERSITÄT UND RESILIENZ: WIR BRAUCHEN VIELFALT
Kulturlandschaft, so wie sie uns gefällt – und dein Garten mittendrin
Resiliente Landschaften erbringen vielfältige Ökosystemleistungen als „Dienstleistungen der Natur für uns Menschen“
Biodiversität for President
Wir brauchen Insekten!
Multifunktional – so bringen wir Wasser, Boden und Klima auf einen guten Weg
Natürliche Tausendsassa für Wasserretention und Lebensraumvielfalt
ALLES IM DYNAMISCHEN GLEICHGEWICHT: PERMAKULTUR
Wie alles begann: Die Permakultur als Gestaltungskonzept für eine bessere Welt
Die Permakultur-Ethik
Das Permakultursystem
Was Permakultur mit Biodiversität zu tun hat
Unser Ziel: Lebensräume schaffen und erhalten
Vorgehensweise in der Permakultur bei der Projektplanung
Am Anfang kommt das Wasser
Die 12 Permakultur-Gestaltungsprinzipien
BIST DU IM BILDE? VOR ORT UND HAUTNAH GEHT’S AUF ZUR ORTS- & BEDÜRFNISANALYSE UND DANN WEITER ZUR PLANUNG
Ja, lass mich im Regen stehen!
Beobachten, messen, recherchieren: Ortsanalyse Wasser und alles, was mit Wasser zu tun hat – also fast alles eigentlich ...
Checkliste zur Ortserhebung mit einer Vertiefung zum Wasserhaushalt
Was, wozu und wie? Bedürfnisse und persönliche Ressourcen
Funktionsanalyse oder: Mach den Kreislauf-Check
Bedarfsanalyse: Wie viel Wasser brauchst du und wofür?
Analyse und Reality-Check: Wie passt das alles zusammen?
Vision & Konzepterstellung
Entwurf & Detailplanung
Wie läuft der Nährstoffkreislauf ab?
VON DER NATUR LERNEN: MIT PERMAKULTURMETHODEN
Wasser-Basics im Permakulturgarten und drumherum
Gut durchdachter Ressourceneinsatz
Die 6 R oder: die Ressourcenkaskade
Mikroklima verbessern & lebensfreundlicher machen
Wasserretention oder: Regenwasser entschleunigen
Mehr & mehr Mehrjährige nutzen
Wähle passende Pflanzen für den jeweiligen Standort
Wasserbedarf einiger ausgewählter Garten- und Wildpflanzen
Das Wasser-Thema in der Jungpflanzenproduktion
Wie du deine Pflanzen richtig setzt
Mischkulturen: Auf die Kombi kommt es an
Mulchen: Kein nackter Boden!
Humus aufbauen: Los geht’s
Nicht wendende Bodenbearbeitung oder vielleicht sogar überhaupt keine Bodenbearbeitung
How to Erosionsschutz
Kompostieren: Wie aus Abfällen schwarzes Gold wird
Bodenschutz: Bereiten wir der Versiegelung ein Ende
„Wir haben uns drei Parkplätze gekauft“
Ein gutes Leben für unsere Tiere
Enten & Hühner als Mitarbeitende im Permakulturgarten
Setzen wir auf wasserspeichernde Naturmaterialien
Grauwassernutzung: Wenn das Duschwasser den Garten gießt
Da geht noch weniger: Bewässerung optimieren
Das 1 × 1 des Gießens
Ollas: Kleine zusätzliche Bodenwasserspeicher für besonders durstige Pflanzen
Tröpfchenbewässerung: die wohl beste automatische Wasserzufuhr
Auf der Wilden Rauke
Tipps für den Topfgarten
Mähen und stehen lassen: Ja, das bringt’s
Wiese statt Rasen: Einfach mal wachsen lassen
Wasserfußabdruck minimieren oder: Was es mit virtuellem Wasser auf sich hat
JETZT GEHT’S ANS GESTALTEN!
Aber wo beginnen? Die wichtigsten Elemente, um einen Garten klimafit zu machen
Permakultur-Elemente, ihre Funktionen und wie sie in Verbindung mit dem Wasserhaushalt stehen
YES! Permakultur- und Landschafts-Elemente, die den Wasserhaushalt positiv beeinflussen
Dein Wäldchen, oder: der Tiny Forest
Wildsträucherhecken für den Garten
Tauwassersammlung
Moorbeet
Wildniszonen
Blumenwiese: Magerwiese und Feuchtwiese
Gründach
Versickerungsoffene Wege/Terrassen/Parkplätze
Streuobstwiesen
Pilzkulturen outdoor
Naturnahe Aquakulturen
Schichtmulchbeet
Hügelbeet
Hochbeet
Baumscheibenbeet
Kraterbeet
Wallbeet
Topfgarten auf Balkonen und Terrassen
Miniteich
Teiche, Teiche, Teiche ... und zwar von Regenwasser gespeiste
Regenwasserzisterne
Tonnen/Fässer/Tanks
Grauwasseranlage
Mini-Speicher: Ollas
Brunnen
Sickergräben/Swales
Trockenbachbett
Wassersammlung, -leitung und -verteilung: Dachflächen, Dachrinnen, (Fall-)Rohre
Wasserpumpen
Schläuche, Brausen, Gießkannen
Kompostanlage
Mulchwiese, Fettwiese
Komposttoilette
Retentionsbecken
Rigolen
Waldgärten, Agroforstsysteme, Polykulturen, Schwammstädte, Klimalandschaften
Back to the Waldviertel – die Regenwassernutzung am Frei-Hof
Patric und das GUTE Wasser
Wasser amGUT
LEBENSRAUM (AM) WASSER
Mehr als die Summe ihrer Teiche
Amphibien-Wanderung: Frösche, Kröten, Molche auf ihrem Weg in die Laichgewässer und zurück
Ein Ausflug bei bestem Froschwetter
QUAKQuakQuakQuak QuakQuak!
Am Anfang war das Trillern: die Wechselkröten-Besiedelung unseres Gartens UND: Was ist eigentlich Citizen Science?
Citizen Science und das Projekt AmphiBiom
Duck Duck Duck
dasGUT und die Bienen
TROCKENBIOTOPE? – JA, DAS IST GUT!
WIR GÄRTNER* INNEN
ALLES DRUM UND DRAN – DEIN ANHANG
Glossar: Die wichtigsten Begriffe in aller Kürze
Literatur und Quellen: Für noch mehr Wissensfluss
Samenfestes Saatgut: Bezugsquellen
WASSER!
Über ein Element, von dem alles abhängt
Ein Tag im Juli. Es knistert und blendet, rund 30 °C im Schatten seit mehr als drei Wochen. Ich mache mich auf den Weg zum Geflügelauslauf, wo unsere Enten und Hühner den Großteil des Tages im Schatten, versteckt unter dem Stall und den Weinstöcken, verbringen und sich auf das frische kühle Wasser freuen, das ich ihnen gleich bringen werde. Mein Weg führt zuerst über den Hitzepol unseres Gemeinschaftshofes, den großen asphaltierten Innenhof, der noch auf seine klimafitte Umgestaltung wartet, dann öffnet sich die Kulisse und bietet Ausblick auf die weite Ebene, in der sich unser Garten, die Wiese und die Ackerflächen befinden, mitten in der intensiv industriell und landwirtschaftlich genutzten Landschaft nordöstlich von Wien.
Was hier knistert, ist das trockene Gras unter meinen Sandalen und der leichte Wind, der durch die Gräser streift. Der Ausblick ist beeindruckend weit, es gibt viele Äcker, Windräder, Stromleitungen, Gewerbegebiete, Einkaufszentren und dazwischen einige hübsche Dörfer mit Kirchtürmen und Kellergassen. Erst nach mehr als 50 km Luftlinie wird der Blick am Horizont durch die Hügel der kleinen Karpaten in Tschechien eingefangen – an klaren Tagen wie dem heutigen, denn es gibt ja auch die staubigen –, aber dazu später. Was ich hier nur spärlich sehe, sind schattenspendende und kühlende Elemente wie Wälder, Hecken, Teiche – der schützende Einfluss des Wienerwaldes ist nördlich der Donau nicht mehr zu spüren, dafür umso deutlicher der Wind, der über die pannonische Landschaft pfeift. Während es vielerorts im Lande schon seit Wochen sehr viel – oft zu viel – regnet und Überschwemmungen und Murenabgänge an der Tagesordnung stehen, sind wir hier im Osten Österreichs, im pannonisch geprägten Weinviertel, in der üblichen sommerlichen Dürrezeit angelangt. Faszinierend und erschreckend zugleich, wie nah dieses Zuviel und Zuwenig an Wasser doch beieinanderliegen können ...
Vor eineinhalb Jahren sind mein Partner, Andreas Voglgruber, und ich hierhergezogen, haben den SONNENTOR Frei-Hof im Waldviertel, den wir sieben Jahre lang bewirtschaftet und umgestaltet haben, seiner Bestimmung als Biodiversitäts-Hof und Naturgarten übergeben und sind mit unserem Permakultur-Bauernhof-Team – sprich den Enten, Hühnern, Katzen, Bienen und vielen, vielen Pflanzen – ins Weinviertel gezogen. Warum? Es war nicht unbedingt des Weines wegen, sehr wohl aber ein bisschen wegen dem sogenannten Weinbauklima. Der Hauptgrund war aber dieser besondere Ort vor den Toren Wiens und seine besonderen Menschen, die uns dazu bewegt haben, noch einmal ganz neu anzufangen. Hier amGUT mit seiner vielfältigen Hofgemeinschaft aus einer Demeter-Imkerei, einer Permakultur-Landwirtschaft und den Menschen, die hier wohnen und werken, wollen wir Schritt für Schritt auch die Biodiversität wieder einziehen lassen, also die Vielfalt an Lebensräumen, Pflanzen- und Tierarten mit all ihrer genetischen Variabilität. Wir haben ehemals konventionell bewirtschaftete Flächen übernommen und versuchen nun, ihnen Schritt für Schritt neues Leben einzuhauchen – mit der Schaffung von Strukturen zur Wiederbesiedelung durch Wildpflanzen und -tiere, durch schonenden Umgang mit dem Boden, ebenso wie mit einem neuen Wassermanagement zur Rehydrierung der Fläche. Denn Wasser sehen wir als Schlüsselressource, von der vieles – wenn nicht fast alles – abhängt. Und das ist nicht nur hier so!
Ebenes Land mit viel Himmel – so sieht vielerorts das Weinviertel aus, in dem sich dasGUT befindet. Umso mehr kommen Wälle, Teiche und Hecken zur Geltung, bereichern die Landschaft und entfalten ihre Wirkung.
dasGUT am Wasser: Um das Grundstück langsam wieder zu rehydrieren, haben wir uns entschlossen, die Dach- und Oberflächenwässer der versiegelten Fläche nicht mehr in den Abflussgraben abzuleiten, der südseitig an der Grundstücksgrenze verläuft, sondern das Wasser gezielt in den Garten zu führen, dort zu speichern, es zu nutzen und Überschüsse dort versickern zu lassen.
Wasser: Im Garten. In der Landschaft. Im Kreislauf.
In diesem Buch geht’s um Wasser! Und zwar, weil es als Schlüsselressource in Gärten, auf land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, in Siedlungsräumen und generell auf Landschaftsniveau besondere Beachtung verdient. Warum?
Weil wir alle Wasser tagtäglich brauchen und es lebensnotwendig ist.
Weil Wasser in Bezug auf unsere Bedürfnisse oft entweder im Mangel oder im Überfluss vorhanden ist und der Umgang mit dem Wasserthema deshalb eine zentrale Aufgabe und Herausforderung ist.
Weil Wasser als wichtigstes globales Lösungsund Transportmittel Materialien, Substanzen und Energie aufnimmt, verteilt und im Wasserkreislauf alles miteinander verbindet.
Weil der Klimawandel den globalen Wasserhaushalt stark beeinflusst und wir uns auf Wetterextreme einstellen müssen, die wir bisher nicht in dem Ausmaß erlebt haben.
Und weil wir Menschen viele Flächen und ganze Landstriche und Regionen, in denen sich unsere Siedlungen und Infrastruktur befinden, so stark baulich und intensiv landwirtschaftlich verändert haben, dass Wasser zum Problem wird: Es kann nicht mehr aufgenommen, gespeichert und verteilt werden, ohne dass wir uns dabei selbst in Gefahr bringen.
Genau hier setzt dieses Buch an. Denn bei der Gestaltung von Flächen, ob dem eigenen kleinen oder größeren Garten, den Grünflächen in der Gemeinde oder auch auf größeren landwirtschaftlichen Flächen, haben wir sehr viel Gestaltungsspielraum und spüren die positiven Auswirkungen am eigenen Leib, wenn wir uns um ein funktionierendes Wassermanagement kümmern.
Hier kommt die Permakultur ins Spiel, ein ganzheitliches Gestaltungskonzept, von dem ich und viele andere überzeugt sind:
Die Permakultur beschäftigt sich nämlich besonders intensiv mit dem Thema Wasser – genau aus den oben genannten Gründen – und bietet eine gut gefüllte Werkzeugkiste an Methoden und Elementen, um Grundstücke so zu gestalten, dass sie optimaler mit Wasser versorgt sind und Zeiten mit zu wenig oder zu viel Niederschlag möglichst schadlos überbrücken können.
Und wie immer, wenn es um Prozesse in der Natur und ihre Wechselwirkungen geht, brauchen wir einiges an Vorwissen und die Bereitschaft, wieder und wieder auf Beobachtungstour zu gehen, denn von der Natur als Vorbild können wir sehr viel lernen. Die Permakultur beruht auf ökologischen Grundlagen und hat Gestaltungsprinzipien entwickelt, mit denen Flächen zukunftsfähig gemacht werden können. Es lohnt sich, diese zu kennen, denn sie helfen beim Beobachten, Interpretieren, Planen und Entscheiden über den jeweils passenden Umgang mit dem Wasser.
Also let’s go, oder auch:
WASSER MARSCH!
Unsere Krisen – unsere Handlungsmöglichkeiten: Wir können viel tun!
Der Grund für dieses Buch? Das Thema Wasser steht häufig im Mittelpunkt der Krisen, die wir Menschen erleben: Der Klimawandel und die massive Umgestaltung der Erdoberfläche, die wir im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte vorangetrieben haben, machen uns verletzlich und verändern unsere Lebensbedingungen.
Der Klimawandel bringt tiefgreifende Veränderungen mit sich. Rekordsommer, Dürre, Überschwemmungen – Begriffe wie diese prasseln nahezu täglich auf uns ein. Städte, die im Sommer zu unerträglichen Hitzeinseln werden, landwirtschaftliche Betriebe, deren Ernte aufgrund ausgetrockneter Böden und Wasserknappheit verdorrt beziehungsweise bei stärkeren Regenfällen weggeschwemmt wird. Im Garten zeigt sich ein ähnliches Bild. Was können wir tun, wie dagegenhalten?
Zuallererst ist es wichtig zu verstehen, dass wir und unsere Gärten und alle Flächen, die wir bewirtschaften und die uns umgeben, Teil eines großen Ganzen sind. Jede Fläche ist Teil einer Kulturlandschaft, die – wenn sie vielfältig und resilient gestaltet und erhalten wird – die Auswirkungen des Klimawandels besser meistern kann, die den häufigen Extremwetterereignissen besser standhalten kann.
Der Nutzen für uns Menschen liegt also nahe, wenn wir in vielfältige Landschaften und Gärten investieren:
Lebensfreundliches Mikroklima durch Temperaturpuffer, Windschutz, Sonnenschutz
Hochwasserschutz und Abmilderung von Hitzewellen und Dürre
Mehr Ertragssicherheit und höhere Produktivität auf unseren Flächen
Siedlungsnahe Erholungsgebiete, die Naturbeobachtung ermöglichen und Lebensqualität sowie Gesundheitsförderung bringen
Beginne mit dem Wasser
Alle Elemente einer Landschaft, aber im kleineren Stil auch alle Elemente eines Gartens, werden durch den Wasserhaushalt geprägt, der in dem jeweiligen Gebiet vorherrscht. Wir Gärtner*innen haben sehr viele Möglichkeiten, den Wasserhaushalt zu unseren Gunsten zu beeinflussen, denn wir sind glücklicherweise an der Schlüsselstelle tätig: Wir arbeiten mit dem Boden, mit den Pflanzen, mit dem verfügbaren Wasser.
Wir können durch die Auswahl und Gestaltung unserer Gartenelemente maßgeblich bestimmen, wie viel Wasser das Grundstück speichern kann, wie gut es Temperaturextreme abpuffern kann und wie robust es gegenüber Trockenheit und Starkregen ist.
Dein Wirkungsbereich ist also dein Garten, in dem du deutliche Effekte spüren kannst, dessen Gestaltung aber ebenfalls die Nachbarflächen mitbeeinflusst. Das ist der Grund, warum das Thema Wasserhaushalt so effizient auf Gemeindeebene angegangen werden kann: Hier kann sehr viel getan werden, und die positiven Auswirkungen sind dann genau in diesem Gebiet auch eindeutig spürbar.
Lebensräume zu schaffen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Permakultur – Trittsteine und Korridore der Vielfalt gestalten, die helfen, dass Landschaften wieder von Wildtieren und -pflanzen besiedelt werden und gleichzeitig produktives Landwirtschaften ermöglichen – yes, it’s possible!
Wie du siehst, wurde hier gerade die Befürchtung entkräftet, dass einzelne Menschen oder kleine Gruppen zur Minderung des Klimawandels nichts beitragen können, sondern dass es nur die großen Player sind, von denen alles abhängt. Klarerweise wird das Ausmaß des globalen Klimawandels vorwiegend durch das Agieren der großen Konzerne und durch die Rahmenbedingungen geprägt, die die Politik für uns alle schafft, aber all die Menschen, die Landschaft gestalten und bewirtschaften, haben großen Einfluss. Unsere Handlungsmöglichkeiten sind unsere große Chance: So wie du und ich unsere Gärten, unsere landwirtschaftlichen Flächen, unsere Grünanlagen, unsere Wälder und Siedlungen und unsere Landschaft insgesamt gestalten, bestimmt maßgeblich, wie groß unsere Verwundbarkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels ist.
Das kannst DU tun:
Auf den Flächen, für die du selbst Verantwortung trägst – also in Gärten, auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen und betrieblichem oder öffentlichem Grün – Anpassungen an den Klimawandel vornehmen. Beginne mit dem Wasser!
Eine politische Einigung zum sofortigen Handeln zum Schutz unserer Lebensgrundlage (sprich „Klimaschutz“) unterstützen/vorantreiben/erwirken.
Denn maßgebliche Akteur*innen aus Forschung, Wirtschaft, Technik, Landwirtschaft sind bereit dazu. Steuere deine Erfahrung, dein Wissen und dein Bemühen bei, denn
Kooperation, nicht Konkurrenz ist die Grundlage lebendiger Systeme und die Basis für eine gute Zukunft!
FREI NACH BILL MOLLISON AUS DEM HANDBUCH DER PERMAKULTUR-GESTALTUNG
Über Wasserwege gibt es so einiges zu berichten: Sie verbinden und vernetzen Menschen, Gärten, Landschaften. Der Zugang zu Wasser und Land ist für alle Garten-Geschichten ein zentraler Ausgangspunkt. Die Menschen, die Gartenprojekte in Angriff nehmen und längerfristig bewirtschaften, sind ein weiterer.
WASSER: EIN PAAR HARD FACTS
Wir leben auf einem Wasserplaneten. 71 % der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt, und wir selbst bestehen zu einem Großteil aus Wasser. 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt es auf der Erde, gut 97 % davon sind Salzwasser. Von den verbleibenden 3 % Süßwasser sind derzeit etwa 2,3 % in Polareis und Gletschern gespeichert, 0,6 % in Boden und Grundwasser, 0,02 % in Seen und Flüssen und etwa 0,001 % in der Atmosphäre. Durch den Wasserkreislauf bleibt das Wasser in Bewegung, es wechselt zwischen den Speichern, bleibt mal länger, mal kürzer. Im Schnitt verweilt ein Wassermolekül ca. 100–200 Jahre im oberflächennahen Grundwasser, aber 10.000 Jahre im tiefer liegenden, fossilen Grundwasser, es bleibt im Durchschnitt 3.200 Jahre in den Ozeanen und 20–100 Jahre in Gletschern und Seen. In Flüssen sowie in der saisonalen Schneedecke verweilt es im Durchschnitt 2–6 Monate, in den oberen Bodenschichten etwa 1–2 Monate und in der Atmosphäre etwa 9 Tage, bis es wieder zur Erde fällt und sich zu den anderen Wassermolekülen in einem der Speicher gesellt.
Jenes Wasser, das wir als Trinkwasser nutzen, kann ganz unterschiedliche Herkünfte haben. Es stammt aus Grundwasser, Quellwasser oder Oberflächenwasser, und letzteres wiederum aus Seen, Flüssen, Uferfiltrat oder Regenwasser. Auch aus entsalztem Meerwasser und wiederaufbereitetem Abwasser kann Trinkwasser entstehen. Die Mindestanforderung an Trinkwasser ist, dass es keine krankheitserregenden Keime enthält und auch keine Kontaminationen aus Landwirtschaft und Industrie. In vielen Teilen der Welt ist das Wunschdenken, obwohl es ein Menschenrecht auf den Zugang zu sauberem Wasser gibt.
Wenn wir Wasser nutzen, verändern wir oft leichtfertig seine Qualität und machen es zu Abwasser, das entweder aufwändig gereinigt werden muss oder Gewässer, Böden, Lebewesen kontaminieren kann. Auch in unseren Haushalten entsteht Abwasser, das zum Teil deutlich reduziert oder – mit den entsprechenden Kenntnissen und Vorsichtsmaßnahmen – sinnvoller genutzt werden könnte, als es in die nächste Kläranlage zu schicken:
Grauwasser stammt aus der Dusche, der Waschmaschine, dem Geschirrspüler und den Waschbecken in Haus und Garten. Es kann, wenn natürliche Reinigungsmittel verwendet werden, als Brauchwasser im Garten noch einmal genutzt werden (mehr auf Seite 126).
Schwarzwasser ist alles, was aus Toiletten weggespült wird. Mit Komposttoiletten und Trockentoiletten kann eine große Menge Wasser eingespart werden, das in dem Fall ja gar kein dringend nötiger Teil der Sache ist, sondern einfach nur dem Wegtransport dient. Schade drum. (Mehr darüber findest du auf Seite 204.)
Regenwasser statt Trinkwasser macht absolut Sinn für alles, wo kein Trinkwasser nötig ist, also für Gießwasser, Toiletten, Brauchwasser im Haushalt.
Dieses Buch soll dir dabei helfen
Im ersten Teil werden wichtige Grundlagen zum Wasserkreislauf und dem Zusammenhang mit dem Klimawandel zusammengefasst.
Ab Seite 36 erfährst du, wie Biodiversität und vielfältige Landschaftselemente unsere Kulturlandschaft robust, produktiv und enkeltauglich machen.
Die Permakultur als Gestaltungskonzept wird ab Seite 55 vorgestellt, sie basiert auf den ökologischen Grundlagen, die in den ersten Kapiteln beschrieben werden, und bietet eine Vielzahl an Methoden und Elementen, die genau jetzt Sinn machen.
Und wie immer, wenn es um Prozesse in der Natur und ihre Wechselwirkungen geht, brauchen wir eine gute Beobachtungsgabe. Wie du die Ortsanalyse angehst und es mit der Planung deines Gartens, deines Balkons, deiner Ackerflächen weitergeht, erfährst du ab Seite 68.
Permakultur-Elemente und Methoden zum Selbstausprobieren findest du ab Seite 94.
Wie du Wasserlebensräume schaffen kannst, zeige ich dir ab Seite 210.
Das Glossar und weitere Empfehlungen sind ab Seite 231 aufgelistet.
IT’S ALL CONNECTED: ALLES ÜBER WASSERKREISLAUF UND WASSERHAUSHALT
Wasser ist das Superelement unseres Planeten, so viel ist klar. Es ist die Grundlage unserer Ernährung, Gesundheit und Hygiene. Wasser ist der Motor der Natur, es reguliert das Klima und schafft Lebensräume für unzählige Arten. Angesichts seiner zentralen Rolle ist es wichtig, die Hintergründe und Zusammenhänge des Wassers genau zu beleuchten. In diesem Kapitel geht es also um den Wasserkreislauf, den Wasserhaushalt und die Wasserretention – und was das alles mit unseren Flächen zu tun hat.
Jedes natürliche Gewässer ist ein Gewinn – für die Biodiversität genauso wie für unsere Wasserversorgung.
Wie das Wasser auf seinem Kreislauf alles in Verbindung setzt
Auch wenn wir Wasser als lineare Ressource betrachten, die kommt und geht, zum Beispiel
wenn wir es im Haushalt oder in der Industrie aus Leitungen entnehmen und nach der Verwendung als Abwasser entsorgen,
wenn eine neue Siedlung gebaut wird und dafür Ackerflächen versiegelt und drainagiert werden,
wenn wir Flüsse begradigen, um „Land zu gewinnen“,
oder Grundwasser zur großflächigen Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen verwenden, bedenken wir oft nicht:
dass Wasser sich immer im Kreislauf bewegt und jeder Eingriff in diesen Kreislauf die Wege des Wassers auf unterschiedlichste Weise verändern kann. Und damit auch alles beeinflusst, was mit dem Wasserhaushalt in Verbindung steht: nicht weniger als den Boden, das Klima und unsere Lebensbedingungen.
Deshalb schauen wir uns doch einmal genauer an, wie das mit dem Wasserkreislauf funktioniert, im Großen wie im Kleinen. Außerdem möchte ich dir zeigen, dass wir auch hier ganz schön handlungsfähig sind.
Im Wasserkreislauf zirkuliert Wasser auf regionaler wie globaler Ebene kontinuierlich – aber in unterschiedlichstem Ausmaß – zwischen den Wasserspeichern: Das sind die Atmosphäre, die Ozeane, Seen, Flüsse, die Feuchtgebiete wie Moore, Auen, Sumpfgebiete, das Grundwasser, der Boden mitsamt seiner Humus- und Streuschicht, die Vegetation und alle anderen Lebewesen sowie die vereisten Polkappen und Gletscher.
Besonders spannend sind vor allem die Prozesse, mittels derer das Wasser zwischen diesen Speichern transportiert wird. Sie betreffen uns alle: Wir können sie spüren und beobachten, und sie sind auch in Bezug auf den Wasserhaushalt unserer bewirtschafteten Flächen von großer Bedeutung.
Die Sonne als Motor, aber gesteuert wird von Land und Wasser
Angetrieben wird der Wasserkreislauf durch die Sonne, indem sie Wasser wieder und wieder zum Verdunsten bringt. Durch die Schwerkraft fällt es aus der Atmosphäre auf die Erdoberfläche zurück. Was aber in weiterer Folge passiert und für alles Leben prägend ist, ist ein Wechselspiel mit der Erdoberfläche, mit dem Land, den Ozeanen, den vorhandenen Strukturen und ihren Eigenschaften – wie zum Beispiel deren Temperatur. Und die Erdoberfläche gestalten und prägen wir Menschen ganz maßgeblich: Lebewesen, Wasserkreislauf, Boden und Klima – diese vier Dinge sind untrennbar miteinander verzahnt und beeinflussen sich gegenseitig.
Die Schneedecke, wie hier am Greim in der Steiermark, speichert Wasser ...
Achten wir darauf, dass das auch in unseren Siedlungen und Gärten möglich ist.
... bis es schließlich als Schmelzwasser über einige Wochen verteilt im Boden versickert und ins Tal fließt.
Was sind also die wichtigsten Prozesse des Wasserkreislaufs?
Verdunstung: Wasser verdunstet schon bei Raumtemperatur, geht also vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über. Einerseits verdunstet es von Oberflächen – von belebten wie Wiesen oder unbelebten wie Hausdächern – und andererseits durch das Schwitzen von Lebewesen. Wie stark die Verdunstung ist, wird durch viele Umweltfaktoren bestimmt: Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Sonneneinstrahlung, dem Wassergehalt des Bodens und der Beschaffenheit von Boden und Vegetation.
Das von Pflanzen ausgeschwitzte Wasser kann Insekten als Trinkwasser dienen, bevor es verdunstet.
Kondensation: Verdunstetes Wasser, das sich als Wasserdampf in der Atmosphäre befindet, kondensiert, also verflüssigt sich zu Wassertröpfchen in Wolken und Nebel. Kondensation passiert, wenn die Lufttemperatur fällt oder die Luftfeuchtigkeit steigt. Tau und Raureif sind kondensiertes Wasser, das sich an Oberflächen anlegt. Grundsätzlich sprechen wir auch von Kondenswasser, wenn sich Wasser aus der Luft an kühleren Oberflächen verflüssigt (auf Fensterscheiben, Zeltplanen usw).
Niederschlag: Wasser fällt als Regen, Schnee, Hagel usw. aus den Wolken auf die Erdoberfläche. Das passiert dann, wenn der in der Luft gespeicherte Wasserdampf kondensiert und zu schwer oder zu viel wird und ihn die Schwerkraft deshalb zu Boden zwingt. Je wärmer die Luftmassen sind, desto mehr Wasser kann in ihnen gespeichert sein. Komplizierte Abläufe von Temperatur- und Luftdruckänderungen bestimmen, wo wann und wie viel Niederschlag fällt.
Interzeption: Es regnet und ALLES ist nass! Interzeption heißt, dass Niederschlagswasser an der Oberfläche der Vegetation zurückgehalten bzw. abgefangen wird. Es haftet z.B. an Blättern und Nadeln von Bäumen. Danach kann das Wasser entweder verdunsten oder z.B. bei Wäldern verzögert durch Stammabfluss* und Kronentraufe** auf den Boden gelangen. Wichtig bei diesem Prozess ist, dass er die auf den Boden auftreffende Wassermenge reduziert bzw. zeitlich verzögert. Die Verdunstung des Interzeptionswassers erhöht außerdem die Luftfeuchtigkeit und prägt so das Mikroklima eines Standortes. Hydrologische Daten belegen, dass in Nadelwäldern 30–40 % und in Laubwäldern 15–25 % des Jahresniederschlages auf diese Weise aufgenommen und verdunstet werden und nicht in den Boden gelangen.
Es sind allerdings nicht nur die Wälder, nein, alle Pflanzengemeinschaften werden von Niederschlagswasser benetzt, denken wir an Wiesen, Hecken und Gartenbeete. Auch in einer Mulchschicht findet Interzeption statt. Für die Wasserrückhaltefähigkeit einer Region (mehr dazu auf Seite 25), aber auch eines Gartens, ist die Pflanzendecke und die Beschaffenheit der Oberfläche ein wichtiger Maßstab.
Infiltration: Sie beschreibt den Prozess, durch den Niederschlagswasser in den Boden eindringt. Wie gut und wie viel Wasser vom Boden aufgenommen werden kann, hängt sehr stark damit zusammen, wie die Bodenporen ausgeprägt sind. Sandige Böden können z.B. sehr große Infiltrationsraten zeigen, also viel Wasser aufnehmen, weil sie viele größere Poren haben. Die Infiltration wird aber auch bestimmt von der Wassersättigung des Bodens und seiner Temperatur. Klarerweise kann ein bereits gesättigter Boden kein Wasser mehr aufnehmen. Und auch ein Boden, dessen Oberflächentemperatur unter dem Gefrierpunkt liegt und deshalb vereist ist, nimmt kein Wasser auf.
Positiven Einfluss auf die Infiltration haben vor allem die Vegetationsdecke und die Durchwurzelung, aber auch die Streuschicht im Wald – also abgestorbene pflanzliche Reste wie Laub, das sich auf dem Boden sammelt – oder eine Mulchschicht im Garten: Durch sie wird der Aufprall der Regentropfen abgedämpft und eine Verschlämmung des Bodens verhindert. So kann Wasser auch bei starken Niederschlägen gut in den Boden eindringen. Die höchsten Infiltrationsraten wurden übrigens in Waldböden gemessen, aber auch Wiesenböden sind wunderbare „Wasseraufsauger“.
Auf Ackerflächen sehen wir bei Starkregen hingegen häufig die erwähnte Verschlämmung, die gemeinsam mit den durch intensive Bodenbearbeitung gestörten Poren dazu führt, dass die Wasserinfiltration nur mehr in geringerem Ausmaß möglich ist.
Auch Flechten – wie hier in einer bereits kahlen Lärche – saugen sich bei Regen mit Wasser voll.
Jeder Grashalm umhüllt sich bei Regen mit einer Wasserschicht – in Summe nimmt die Wiese große Mengen Regenwasser auf.
Nachdem das Wasser in den Boden infiltriert wurde, kann es entweder von den Pflanzen genutzt werden, bleibt im Boden gespeichert oder füllt die Grundwasserkörper auf.
Unter dem Begriff Versickerung versteht man in der Hydrologie das baulich gezielte Einbringen von Regenwasser in den Untergrund, was z.B. mittels Sickermulden erfolgen kann. Verrieselung bezeichnet die Einbringung von belastetem Sickerwasser in den Boden, wenn z.B. bei Kläranlagen Abwasser in einen abgegrenzten Bodenbereich eingeleitet wird, um eine weitere Reinigung durch die Filterwirkung des Bodens zu erzielen.
Oberflächenabfluss: bedeutet, dass Niederschlags- oder Schmelzwasser nicht in den Boden infiltriert wird, sondern auf der Geländeoberfläche dem Gefälle entlang abrinnt. Das passiert, wenn die Wasseraufnahmefähigkeit einer Fläche eingeschränkt ist, wie z.B. bei Ackerflächen mit verdichtetem Boden, oder gar nicht möglich ist, wie bei versiegelten Flächen. Der Oberflächenabfluss ist der Auslöser der sogenannten Wassererosion, ein Prozess, bei dem durch die abtragende Tätigkeit des Wassers Materialien und Sedimente hangabwärts transportiert werden. Das Oberflächenwasser rinnt mit allem, was es mit sich trägt und nicht früher auf irgendeine Weise zurückgehalten wird, über Bäche, Flüsse und Seen letztendlich bis zu den Ozeanen.
Der Waldboden mit seiner Streuschicht und den Unterwuchspflanzen ist perfekt für die Wasserretention.
Auf diesem Acker konnte ein Starkregen nicht gut versickern – der Boden ist verdichtet und die Pflanzendecke fehlt. Wassererosion schwemmt den Boden aus und nimmt die Nährstoffe gleich mit ins Tal.
Der Wasserkreislauf ist hochsensibel
Auch wenn die Gesamtmenge des Wassers, die zirkuliert, immer gleichbleibt, verändern sich ständig die Wassermengen in den verschiedenen Speichern – und zwar, weil die Prozesse des Wassertransports hochsensibel und dynamisch sind.
Es sind einerseits das Klima und die aktuelle Wetterlage, die starken Einfluss auf den Wasserkreislauf haben. Allen voran ist die Temperatur der Luft, der Gewässer und der Landoberfläche zu nennen. Sie prägt maßgeblich jene Energie, die in Wasser gespeichert ist und freiwerden kann.
Andererseits ist die Beschaffenheit der Bodenoberfläche dafür verantwortlich, wie sich Wasser verhält, sobald es auf die Erde trifft. Ob Wasser aufgenommen und somit entschleunigt werden kann oder ob es oberflächlich abrinnt, dadurch beschleunigt wird und potentiell gefährliche Kräfte mit sich trägt.
Beides – Klima und Bodenoberfläche – beeinflussen wir Menschen durch die unvermeidlichen Wechselwirkungen auf deutliche Art und Weise.
Ein ewiges Wechselspiel: Wasser in der Atmosphäre, im Boden, in Lebewesen, in Gewässern ...
WAS DER WASSERKREISLAUF NOCH ALLES KANN – AUSSER WASSER ZU TRANSPORTIEREN
Wärmepumpe: Wasser ist der beste Wärmetauscher. Sowohl Wärme als auch Kälte werden durch Wasserströmungen verteilt: im Körper, in Gewässern, auf der Landoberfläche – und das nicht nur mittels flüssigem Wasser, sondern auch durch den Wasserdampf in der Luft und der Atmosphäre.
Motor unserer Fließgewässer: Von nix kommt nix. Nur, weil es den von Sonnenenergie betriebenen Wasserkreislauf gibt, fließen unsere Flüsse und Bäche, sammelte sich Wasser in Seen und Teichen.
Nährstofftransport und -aufnahme: Im Wasser gelöst werden Nährstoffe über weite Strecken transportiert. Auch die Nährstoffaufnahme braucht Wasser: z. B. erhalten Pflanzen alle Nährstoffe, indem sie Wasser aufnehmen.
Landschaftsgestalter: Wasser formt mittels der sogenannten Wassererosion die Erdoberfläche. Berge, Täler, Schluchten, Seen usw.: Ihr Aussehen wird maßgeblich durch den Wasserkreislauf geprägt. Und diese von der Arbeit des Wassers gestaltete Topografie von Landschaften ist dann auch die Basis dafür, welche Pflanzen und Tiere sich ansiedeln und etablieren können. Wie immer: It’s all connected!
Eine Schlüsselstelle? Dort, wo das Wasser auf den Boden trifft
Wo das Regenwasser auf den Boden trifft – dort befindet sich eine sehr wichtige Schlüsselstelle. Es macht einen enormen Unterschied, ob das Regenwasser auf Pflanzen, eine Streuschicht, einen Acker oder eine Straße trifft. Je nach der Beschaffenheit der Bodenoberfläche kann das Wasser entweder vor Ort von der Vegetation und dem Boden aufgenommen werden (Interzeption und Infiltration) oder eben nicht. Wenn es aufgenommen werden kann, wird es in weiterer Folge weitergereicht: ein Teil verdunstet, ein Teil versickert ins Grundwasser, ein Teil wird gleich von den Pflanzenwurzeln aufgesaugt ... Das Wasser wird also von diesem Ort aufgenommen, es kann an diesem Ort gespeichert und genutzt werden, und ja – das Leben kann sich an diesem Ort besonders üppig entfalten.
Die andere Möglichkeit – und natürlich gibt es viele Übergänge zwischen den Möglichkeiten – ist, dass das Wasser aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen werden kann und sich als Oberflächenabfluss auf den Weg macht. Wohin? Dorthin, wo Wasser sich immer hinbewegt: zum tiefsten Punkt, der ohne unüberwindbare Hindernisse zu erreichen ist.
Gründe, warum Wasser nicht aufgenommen werden kann, sind folgende:
Der Boden ist versiegelt.
Der Boden ist von Haus aus nur bedingt in der Lage, Wasser aufzunehmen: Er enthält wassersperrende Schichten aus Ton, tonigem Lehm oder dichten Gesteinen.
Der Boden kann aufgrund intensiver Bewirtschaftung nur mäßig gut Wasser aufnehmen, er ist verdichtet, hat wenig Struktur und neigt zur Verschlämmung. Ein Großteil unserer Ackerflächen leidet unter diesem Problem.
Der Boden ist wasserabweisend: z.B. durch starke Austrocknung, durch Verdichtung oder das Fehlen von Vegetation.
Der Boden ist wassergesättigt, weil es schon sehr viele Niederschläge gegeben hat.
Der Boden ist gefroren.
Die Schlüsselstelle im lokalen Wasserkreislauf, die wir als Gestalter*innen sehr stark beeinflussen können.
Im Umkehrschluss helfen folgende Elemente und Methoden bei der Wasseraufnahme durch den Boden:
dauerhafte Bepflanzung (mehr dazu auf Seite 99)
eine Mulch- oder Streuschicht (mehr dazu auf Seite 109)
eine wasserrückhaltende Topografie und/oder ebensolche Gestaltungselemente (mehr dazu ab Seite 141)
Und auf keinen Fall vergessen dürfen wir das natürliche Rückhaltevermögen naturnaher Landschaftsbereiche. In Bezug auf den Hochwasserschutz sind v.a. Berg- und Auwälder, Moore und andere Feuchtgebiete sowie Flüsse und Bäche mit Retentionsfläche ganz einfach unersetzlich (mehr dazu auf Seite 37).
Lacken/Pfützen entstehen überall da, wo Wasser nicht einfach vom Boden aufgenommen oder abgeleitet werden kann. Hier mitten auf einem Weg mit verdichtetem Boden.
Landschaften die wie diese in der Obersteiermark mit Hecken, Wiesen, Wäldchen und Teichen ausgestattet sind, können Wasser sehr gut entschleunigen und speichern – und sind deshalb gute Vorbilder für die Gestaltung.
Wasser als Schlüsselressource: der Wasserhaushalt
Schon wieder ein neuer Begriff! Jeder Ort der Erde, jede Region, jeder Garten hat einen – einen ganz persönlichen Wasserhaushalt.
Der Wasserhaushalt beschreibt, vereinfacht gesagt, wie viel Wasser in den Haushalt (= das jeweilige Gebiet) eingebracht wird, wie viel wieder rausgeht und wie viel im Haushalt gespeichert ist. Daraus kann sich eine positive Bilanz ergeben: Es gibt Überschüsse und die Speicher sind voll. Oder eine negative: Es geht mehr raus, als reinkommt, und die Speicher (z.B. der Boden und das Gewebe der Pflanzen) werden immer leerer – also trockener.
Der Wasserhaushalt eines Gebietes ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie es sich dort leben lässt: welche landwirtschaftlichen Nutzungen möglich sind, welche Ökosysteme und Lebensräume sich entwickeln und etablieren können und welche Herausforderungen es in Bezug auf die Ressource Wasser gibt.
Der Wasserhaushalt selbst wird unter anderem durch Niederschlag, Verdunstung, Infiltration und Wasserspeicherung geprägt. Das Ganze spielt sich in unterschiedlichen Größenskalen vom Großklima bis zum Klein- und Mikroklima ab. Grob gesprochen gibt es Gebiete, in denen die Verdunstung von Wasser im Jahresschnitt den Niederschlag übertrifft, in diesen Regionen herrscht ein „arider“ Wasserhaushalt vor, Wasser ist eher Mangelware. Im Gegensatz dazu sind Gebiete mit „humidem“ Wasserhaushalt solche, deren Jahresniederschlag die Verdunstung übersteigt, es gibt deshalb viele Wasserspeicher wie Seen, Flüsse und Moore. Allerdings gibt es viele Mischformen und auch – gerade jetzt im Zuge des Klimawandels – große Veränderungen des Wasserhaushalts. Damit einher gehen auch große Veränderungen im Landschaftsbild vieler Gebiete.
In den von den Zentralalpen geprägten Regionen Österreichs ist es keine Seltenheit, dass die jährliche Niederschlagssumme doppelt so hoch ist wie im Osten – das ist auch deutlich sichtbar an der Vegetation.
Wir sind dran!
Eine Sache gleich vorweg: Der Wasserhaushalt ist nichts rein „Naturgegebenes“! Er wird ganz stark davon beeinflusst, wie die Landoberfläche – bzw. die Bodenoberfläche – beschaffen ist, wie wir also unsere Siedlungen, Gärten, Höfe, Betriebe – sprich unsere Landschaft gestalten. Bekanntermaßen greifen wir Menschen sehr deutlich in die Landschaft ein und verändern dadurch auch den Wasserhaushalt. Veränderungen, die sich negativ auf den Wasserhaushalt auswirken, sind Bodenversiegelung, Drainagierungen, regulierte und in ihrem ursprünglichen Lauf stark verkürzte Flüsse, Entfernung von wasserspeichernden Wäldern, Hecken und Wiesen und der intensive bodenverdichtende Ackerbau, der die Wasseraufnahmefähigkeit von landwirtschaftlichen Flächen stark einschränkt. All das verringert die Wasserspeicherfähigkeit eines Gebietes und verschiebt die Wasserbilanz hin zu zunehmender Trockenheit bis hin zur Wüstenbildung.
DER WASSERKREISLAUF UND WASSERHAUSHALT DER PFLANZE
Auch wenn wir Gärtner*innen uns natürlich als Produzent*innen verstehen: Eigentlich sind das die Pflanzen!
Wasser ist neben Kohlenstoff und Sauerstoff der wichtigste Baustein von Lebewesen, denn er wird für unzählige Stoffwechselprozesse gebraucht. Nicht umsonst gehören jene Ökosysteme zu den produktivsten, wo am meisten Wasser verfügbar ist.
Pflanzen sind durch ihre Verdunstung immer zwischen dem Wasserspeicher im Boden und dem in der Atmosphäre eingespannt, sie werden ständig von einem Wasserstrom durchflossen. Und genau diesen brauchen sie auch, um ihren Stoffwechsel zu betreiben. Im Schnitt werden für jedes Gramm Biomasse, das eine Pflanze produziert, ca. 500 g Wasser über die Wurzel aufgenommen, über die Gefäße transportiert, für verschiedenste Stoffwechselprozesse genutzt und letztendlich durch Verdunstung auch wieder an die Atmosphäre abgegeben.
An einem warmen, trockenen Sommertag kann ein Blatt ca. 100 % seines Wassergehaltes in einer Stunde austauschen. Durch den Transpirationsstrom erfährt das Blatt aber auch einen deutlichen Kühleffekt: Bis zu 10 °C kühler ist ein Blatt, das lebendig ist und transpiriert, im Gegensatz zu einer abgeschnittenen Pflanze. Umso wichtiger ist es also, dass genügend Wasser im Boden vorhanden ist, um die Kühlung zu gewährleisten.
Hitzeschäden auf Früchten entstehen häufig dann, wenn diese Kühlung nicht mehr ausreichend klappt – entweder weil es schlichtweg zu heiß ist und/oder der Nachschub an Wasser knapp wird. Um in Zeiten von Wasserstress, also Wasserknappheit, die Verdunstung zu minimieren, können manche Pflanzen auch Schutzstellungen einnehmen: Kürbisse lassen z. B. bei großer Hitze ihre Blätter hängen und richten sie wieder auf, sobald gegen Abend die Sonne weniger stark ist.
Gegen zu starke Verdunstung haben sich Landpflanzen etwas einfallen lassen. Sie haben eine wasserundurchlässige Außenhaut, die Cuticula, die unter anderem aus verschiedenen Wachsen besteht. Eine weitere Anpassung ist dichte Behaarung, die die Verdunstung minimiert, wie beispielsweise beim Salbei.
Eingebaut in die Cuticula sind an den Blattunterseiten dann die Spaltöffnungen, die eine Pflanze gezielt öffnen oder schließen kann. Über die Spaltöffnungen findet auch der Gasaustausch statt, also die Aufnahme von CO2 und die Abgabe von Sauerstoff sowie die Verdunstung von Wasser. Das aufgenommene CO2 wird gemeinsam mit H2O, also Wasser, von der Pflanze mit Hilfe von Sonnenenergie in organische Kohlenstoffverbindungen umgebaut und bildet die Grundlage für das Wachstum des Pflanzengewebes und für den pflanzlichen Stoffwechsel. Weil durch diesen Prozess CO2 aus der Luft entnommen und gebunden wird, heißt er auch Kohlenstofffixierung. Und weil das nur grüne Pflanzen, einige Bakterien und Archäen können, also aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff organische Biomasse produzieren, werden sie Primärproduzenten genannt. Wir Nicht-Pflanzen können das nicht und sind somit voll von Pflanzen abhängig. Für unser Wachstum müssen wir andere Lebewesen essen, also Pflanzen oder Tiere, die wiederum Pflanzen gegessen haben. Pflanzen sind also ganz schön wichtig, das ist klar.
Und das leitet uns auch schon zum nächsten Kapitel. Der in den Pflanzen fixierte Kohlenstoff ist nämlich ein riesiges Thema.
Wasserretention ist das Zauberwort
Das Wort Retention leitet sich ab vom lateinischen retinare und bedeutet zurückhalten.
Ob es sich jetzt um Wassermangel oder Wasserüberschüsse handelt, die uns das Gärtnern, das Landwirtschaften und leider manchmal auch das Leben schwer machen, so hat beides doch eines gemeinsam: eine gelungene Wasserretention, also der Rückhalt von Wasser, hilft, beide Herausforderungen zu meistern. Denn auch wenn es sich wie ein Gegensatz anfühlt – einmal gibt es zu wenig Wasser und wir wünschen uns nichts als Regen, ein andermal gibt es zu viel –, so nah liegen diese beiden Phänomene beieinander. Oft befördert eine Dürre die nächste Überschwemmung – nämlich dann, wenn die Fläche das auf sie treffende Wasser nicht aufnehmen kann. Die Gründe dafür kennen wir ja bereits.
Eine verbesserte Wasserretention kann durch eine Vielzahl von Elementen und Methoden erreicht werden, die besonders im Zusammenspiel ihren Trumpf ausspielen. Jede*r Gärtner*in, jede*r Landwirt*in kann sie auf ihren*seinen Flächen umsetzen und wird die positiven Effekte spüren. Mehr zu den Methoden findest du ab Seite 95.
Allgemein gilt, je mehr Pflanzen und Blattfläche in einem Bestand vorhanden sind, desto besser ist die Aufnahme- und Pufferrate gegenüber Starkregenereignissen (z.B. Altieri et al. 2018). Wenn sich Gärtner*innen, Landwirt*innen, Gemeinden und Betriebe zusammentun, können sie die Wasserretention auf ihren Flächen optimieren. Der positive Effekt entfaltet sich dann auch im größeren Maßstab: Wetterextreme wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen werden regional abgemildert, die Produktivität und der ökologische Wert der Flächen wird erhöht und dadurch die Lebensqualität in der Region dauerhaft verbessert.
Also let’s do it!
Hier gibt es viel zu tun! Wir fangen schon mal an und pflanzen Bäume.
*Regenwasser, das am Stamm von Bäumen entlang zu Boden rinnt.
**Regenwasser, das durch das Kronendach eines Baumes hindurch auf den Boden tropft.
WAS KLIMA- UND LANDSCHAFTSWANDEL MIT WASSER ZU TUN HABEN
Klar, Klima und Landschaften haben sich durch natürliche Prozesse immer schon verändert, sei es etwa durch Vulkanaktivitäten, Plattentektonik, Erosion, Vegetationsdynamiken u.v.m. Aber so schnell und dramatisch, wie dies in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, dafür sind nur wir Menschen verantwortlich.
Wie alles unausweichlich zusammenspielt, ohne dass wir uns entziehen können
In den letzten Jahren ist für mich, aber auch für viele andere, nochmal ein großer Schritt passiert, was das Erleben und Begreifen des anhaltenden Klimawandels betrifft. Das Miterleben und Mitfühlen der Sturzfluten in Spanien, des Hochwassers in Teilen Mitteleuropas inklusive Niederösterreichs, wo ich wohne, der Murenabgang nach einem Starkregen in meiner Heimatgemeinde in der Steiermark, der unseren Garten verschüttet hat, die Hitzewellen und Brände im nahen Mittelmeerraum, die extrem hohen Meerestemperaturen und der Algenschleim an den Adriaküsten ...
Das Problem ist nicht mehr irgendwo in der Ferne, sondern betrifft uns direkt: Es gibt mir das Gefühl, dass es jederzeit bedrohlich werden kann. Es ist für uns schwerer und aufwändiger, Lebensmittel zu produzieren. Es schränkt meinen Radius ein und erschwert meine Arbeit im Freien, wenn wieder eine Hitzewelle ausgebrochen ist. Auch unsere Hühner und Enten müssen dauernd in Deckung gehen, verstecken sich vor der Sonne, legen weniger Eier, arbeiten weniger eifrig im Obstgarten. Und die Bienen finden in den Sommermonaten keinen Nektar und müssen gefüttert werden, um nicht zu verhungern. Das ist oft ganz schön ernüchternd.
Aber wir wollen handlungsfähig bleiben. Einfach weil es nötig ist und Lebewesen immer danach streben, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, oder?
Gemeinsam haben wir eindeutig mehr Spielraum und Möglichkeiten.
Im Sommer ist der einzig mögliche Zufluchtsort im Garten oft der Teich – das ist unser Luxus. Unsere Landwirtschaft braucht aber Schatten und mehr Schutz vor austrocknenden Winden, hier sind die Bäume noch zu jung.
Die Zusammenhänge werden immer komplexer, aber so ist eben das Leben
Lebewesen interagieren auf vielfache Art und Weise miteinander und verändern ihre Umwelt, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Einige der wichtigsten Zusammenhänge wollen wir jetzt beleuchten. Und zwar, weil sie uns direkt dahin führen, wo wir selbst aktiv werden können, um unsere Lebensbedingungen und Zukunftsaussichten zu verbessern.
TURBULENTE VERGANGENHEIT
Während der langen Geschichte unseres Planeten hat sich vieles abgespielt, was wir uns gar nicht vorstellen können. Massive Temperaturschwankungen, unterschiedlichste Zusammensetzungen der Erdatmosphäre, globale Vereisungen und tropische Landschaften wechselten sich ab. Immer wieder entstanden neue Lebensformen und verschwanden wieder. Ausgelöst wurden die Klimaänderungen durch komplexe Interaktionen und Rückkoppelungsprozesse zwischen der Vegetation, dem damit verbundenen CO2-Gehalt der Atmosphäre, Veränderungen in der Sonneneinstrahlung, der Abstrahlung (Albedo) der Erdoberfläche sowie den vulkanischen Aktivitäten des Planeten.
Erst seit den letzten 11.700 Jahren ist das Klima der Erde im Vergleich relativ stabil, und es konnten sich hoch entwickelte menschliche Gesellschaften bilden.
Besonders spannend ist die Beziehung von CO2 zu den Pflanzen und ihren unterschiedlichen Lebensräumen. Denn CO2 wird von ihnen aus der Atmosphäre aufgenommen und fixiert, also in Form unterschiedlicher Kohlenstoffverbindungen in Pflanzengewebe eingebaut und gespeichert und letztendlich in der kompletten Nahrungskette in Lebewesen eingelagert. Wenn Lebewesen absterben, wird der Kohlenstoff wieder frei – außer er kann nicht. Genau das ist in riesigem Ausmaß passiert, als vor mehr als 100 Millionen Jahren in den Meerestiefen sedimentierte Reste von Lebewesen durch Druck und Absenkung in tiefere Schichten zu Erdöl umgewandelt wurden. Auch wenn pflanzliche Reste in Mooren zu meterhohen Torfschichten verpresst werden oder wenn Böden mitsamt ihren organischen Resten zu Permafrost gefroren sind, wird Kohlenstoff langfristig fixiert.
Das Verhältnis von fixiertem Kohlenstoff in Boden und Pflanzen, aber auch von CO2, das in den Ozeanen gelöst und gespeichert ist, zum Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre ist ganz schön wichtig für das Klima der Erde und ihre Temperatur.
CO2 ist nämlich eines von mehreren besonders wichtigen Treibhausgasen. Was bedeutet das? Es ist strahlungsaktiv, das heißt, es kann Wärmeenergie absorbieren und in Richtung der Erdoberfläche zurückstrahlen. Das ist grundsätzlich gut für uns, denn der sogenannte Treibhauseffekt sorgt dafür, dass es auf der Erde nicht ständig flächendeckend Minusgrade hat. Es ermöglicht also Lebensbedingungen für Organismen wie uns Menschen. Aber ...
JA KLAR, KLIMAWANDEL HAT ES IMMER GEGEBEN, ABER ...
Seit mehr als 100 Jahren steigt der CO2-Gehalt der Atmosphäre stetig an – ausgelöst durch menschliche Aktivitäten. Riesige Mengen an fossilem Kohlenstoff werden durch die Erdöl- und Erdgasförderung und die darauf aufbauende Industrialisierung aus dem Boden geholt, verbrannt und als CO2 in die Luft geblasen. Verbunden ist das Ganze mit einer positiven Rückkoppelung: Je wärmer die Erde durch den befeuerten Treibhauseffekt wird, desto mehr CO2 wird zusätzlich aus tauendem Permafrost, austrocknenden Mooren und den Ozeanen frei. Mehr Erwärmung führt zu mehr klimawirksamen Treibhausgasen, führt zu mehr Erwärmung ... es ist ein Hexenkessel. Hinzu kommt die drastische Veränderung der Landoberfläche. Durch großflächige Entwaldung und die Zerstörung von Land und Vegetation kann immer weniger CO2 wieder aufgenommen werden und die Abstrahlung (Albedo) von Flächen vergrößert sich. Infolge vertrocknen Gebiete immer mehr und werden Schritt für Schritt zur Wüste. Ein Drittel der Erdoberfläche ist derzeit Wüstengebiet, und die Fläche wächst stetig – z.B. im Mittelmeerraum.
Der menschenverursachte Klimawandel verändert die Welt, in der wir leben, so schnell und drastisch, wie es noch kein Mensch zuvor erlebt hat – weder in einem Menschenleben noch im Laufe unserer evolutionären Entwicklung. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist derzeit so hoch wie in den letzten 800.000 Jahren nicht. Und seit wir Menschen das Wetter und das Klima beobachten und dokumentieren, wurden global gesehen noch keine heißeren Jahre als 2023 und 2024 gemessen.
Großflächige Abholzung lässt Naturkräfte wie Wind und Erosion umso stärker wirken – viele Landschaften im Mittelmeerraum sind geprägt von Wassermangel und Hitze.
Solange Moore intakt sind, binden sie jede Menge Kohlenstoff, aber sie sind schnell verloren, wenn sie achtlos genutzt werden.
WAS IST KLIMA, WAS IST WETTER?
Wetter ist der Zustand der Atmosphäre in einem bestimmten Gebiet, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. An jedem Tag, in jeder Minute jedes Tages erleben wir ein bestimmtes Wetter – Sonnenschein, Regen, Schnee, Hitze, Gewitter, Schäfchenwolken. Das Wetter und die sogenannten Wetterereignisse, wie Gewitter, Stürme und Hitzewellen oft genannt werden, können von Ort zu Ort sehr verschieden sein, da es in der Atmosphäre dauernd dynamisch zugeht und viele Parameter zusammenspielen. Teilweise fühlbare und auf jeden Fall messbare Wetterelemente sind die Sonneneinstrahlung, die Temperatur, die Luftfeuchte, der Niederschlag, der Luftdruck, der Wind usw.
Von Witterung sprechen wir, wenn das Wetter innerhalb einiger Tage und Wochen gemeint ist.
Mit dem Begriff Klima fassen wir die Gesamtheit der Wetterzustände an einem Ort, inklusive seiner Schwankungen über einen längeren Zeitraum, z. B. über die sogenannte Klimanormalperiode von 30 Jahren, zusammen. Der Klimabegriff hat eine räumliche Dimension, da das Klima immer auf ein gewisses Gebiet und seine Größe bezogen ist, z. B. Mikroklima, Lokalklima, Regionalklima, Großklima, Globalklima. Die Daten für Klimaberechnungen werden aus den Wetterbeobachtungen unzähliger Wetterstationen und Klimadienste sowie satellitengestütztem Klimamonitoring zusammengefasst. Sie sind ein Produkt der weltweiten Zusammenarbeit unglaublich vieler Menschen.
Landschaftswandel: Alles wird glatter
Durch die intensive Landnutzung und vor allem durch die Veränderung, die die Industrialisierung für die Gestaltung der Landoberfläche gebracht hat, ändert sich vor allem auch der Wasserhaushalt und der Wasserkreislauf sowohl auf globalem als auch auf lokalem Niveau. Zusammen mit einer wärmeren Atmosphäre führt das zu einer Häufung von Starkregenereignissen. Denn: pro Grad Erwärmung kann die Luft um 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen und enthält demnach auch mehr Energie, die sich entladen kann.
Die sogenannte Rauigkeit der Landschaft, man kann sie auch als Strukturvielfalt bezeichnen, bestimmt dann maßgeblich, wie viel Wasser aufgenommen und gespeichert werden kann. Je eintöniger und „glatter“ Landschaften sind, desto anfälliger sind sie gegenüber Extremwetterereignissen, insbesondere Hochwasser und Dürren. Dauerhaft bewachsene Flächen können Wasser generell besser aufnehmen als Flächen ohne dauerhaften Bewuchs. Gleichzeitig verdunsten sie auch mehr. Wälder sind richtige Wolkenbildner und Regenmacher.
Typische von der Agrarindustrie geprägte Landschaften sind strukturarm und „glatt“. Wir wollen sie aufrauen und schaffen vielfältige Strukturen wie Teiche, Hecken und Swales.
DIE AUSWIRKUNGEN VON KLIMAWANDEL UND LANDSCHAFTSWANDEL VERSTÄRKEN SICH GEGENSEITIG
Erhöhung der Meeresspiegel: Durch die Erwärmung der Erdatmosphäre und die daraus resultierende Schmelze von Gletschern und Eisschilden steigen die Meeresspiegel. Dies kann Küstenlandschaften wesentlich verändern, da sie der Erosion preisgegeben werden und Lebensräume verschwinden. Auch Tieflandgebiete erleben dann häufigere Überschwemmungen, und Feuchtgebiete können so gestört werden, dass sie ihre ökologische Funktion verlieren.