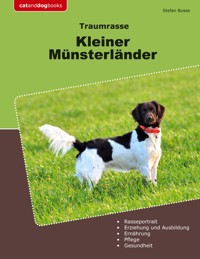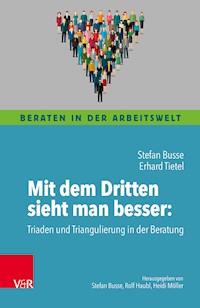
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
Der Band gibt eine Einführung in das triadische Denken und Handeln in der Beratung. Triaden, also Beziehungen zwischen Dreien, prägen unser Leben von Anfang an. Nicht nur in der Familie, sondern in allen Organisationen, die unser Leben begleiten: Kindergarten, Schule, Arbeitswelt etc. Die Autoren gehen davon aus, dass soziale Schieflagen und Konflikte, die Anlässe zur Beratung bilden, aus Störungen in lebens- und arbeitsweltlichen Triaden entspringen. Auch die Beratung selbst kann als das »Hinzukommen eines Dritten« und die »Arbeit am Dritten« verstanden werden. »Mit dem Dritten sieht man besser«: Am Beispiel der Supervision wird gezeigt, wie sich lebensweltliche, arbeitsweltliche und beraterische Triaden ineinander verschränken. Die beraterische Kunst besteht darin, Ratsuchenden zu ermöglichen, sich besser in ihren mannigfaltigen »triadischen« Beziehungen im Lebens- und Arbeitsalltag zu orientieren. Hierfür – und das macht Beratung so herausfordernd – müssen Berater auch sich selbst triangulieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Stefan Busse/Erhard Tietel
Mit dem Drittensieht man besser
Triaden und Triangulierungin der Beratung
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 20 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung: Aniwhite/shutterstock.com
ISBN 978-3-647-90098-8
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Vorwort
1Einleitung
1.1Das Dritte liegt in der Luft
1.2Zur Geschichte triadischen Denkens
2Konzeptueller Ausgangspunkt: Mit dem Dritten sieht man besser …
2.1Von der Dyade zur Triade
2.2Drei, vier, fünf … viele
2.3Von der Triade zur Triangulierung und zum triangulären Raum
3Triadische Wirklichkeiten
3.1Die drei Ebenen triadischer Realität
3.2Lebensweltliche Triaden
3.3Arbeitsweltliche Triaden
3.4Beraterische Triaden
4Triadisches Arbeiten in der Supervision
4.1Die supervisorische Thematisierung lebensweltlicher Triaden
4.2Die supervisorische Thematisierung arbeitsweltlicher Triaden
4.3Supervision als »triadischer Raum« und die Thematisierung der beraterischen Triade
4.4Supervision als »stellvertretende Triangulierung« und Triangulierung höherer Ordnung
5Das »innere Dreieck« und die trianguläre Kompetenz von Supervisorinnen und Supervisoren
6Kurzer Epilog: Triangulierung als Erkenntnis und Ethos
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mit gestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Vorwort
Triaden, also Beziehungen zwischen dreien, prägen unser Leben von Anfang an. Nicht nur in der Familie, sondern in allen Organisationen, die unser Leben begleiten: Kindergarten, Schule, Arbeitswelt etc. Wir, die Autoren, gehen davon aus, dass soziale Schieflagen und Konflikte, die Anlässe zur Beratung bilden, aus Störungen in lebensund arbeitsweltlichen Triaden entspringen. Auch die Beratung selbst kann als das Hinzukommen eines Dritten und als »Arbeit am Dritten« verstanden werden.
Seit seiner Habilitation über »Trianguläre Kulturen in Organisationen« Anfang der 2000er Jahre (Tietel, 2003) und der zeitgleich absolvierten Supervisionsausbildung im Berliner »Triangel-Institut« hat Erhard Tietel den Versuch unternommen, Ansätze triadischen Denkens in der Psychologie, Soziologie sowie in verschiedenen Beratungstraditionen aufzugreifen und für die Supervision fruchtbar zu machen. Ein Resultat hiervon ist die Systematisierung der Figur der Triade und der Dynamiken in Triaden, wie sie im zweiten Kapitel präsentiert werden. Doch erst in der Diskussion und langjährigen Kooperation mit Stefan Busse in der Supervisionsausbildung des »Basta-Instituts« in Leipzig, das Triaden und Triangulierung zu einem expliziten Ausbildungsbaustein gemacht hat, ist eine Konzeption entstanden, die Beratung selbst grundlegend triadisch denkt und konzipiert. Aus der Verknüpfung von beraterischer Erfahrung, Tietels Zettelkasten und Busses Leidenschaft zu konzeptionell-begrifflichem Denken ist eine triadische Grundlegung der Supervision (Beratung) entstanden, die hier erstmals vorgelegt wird.
Diese beginnt mit der Unterscheidung dreier Ebenen triadischer Realität: lebensweltlichen, arbeitsweltlichen und beraterischen Triaden und setzt sich fort in der beraterischen Thematisierung dieser Triaden sowie der Begründung der Beratung selbst als »triadischer Raum«. Überlegungen zur Supervision als »stellvertretender Triangulierung« und zur triangulären Kompetenz von Supervisorinnen und Supervisoren runden dieses triadisch fundierte Beratungskonzept ab. »Mit dem Dritten sieht man besser« verweist auf die beraterische Kunst, Ratsuchenden zu ermöglichen, sich besser in ihren mannigfaltigen »triadischen« Beziehungen im Lebens- und Arbeitsalltag zu orientieren. Hierfür – und das macht Beratung so herausfordernd – müssen Berater auch sich selbst »triangulieren«.
Stefan Busse und Erhard Tietel
1
Einleitung
»Die Triade ist die erste Gruppe im Leben eines Menschen, Vorläufer aller späteren Gruppen. Die psychische und die soziale Geburt des Menschen gehen Hand in Hand. Was wir Gemeinschaftsgefühl nennen können, wurzelt in der Triade. Es beinhaltet die Fähigkeit, gleichzeitig zu mehreren Personen unterschiedliche Beziehungen haben und alle zusammen als Gemeinschaft wahrnehmen und erleben zu können.«
(Müller-Pozzi, 1995, S. 129)
Triadisches Denken und Arbeiten gehören zum beraterischen Selbstverständnis, ja zum Kern beraterischer Identität von Supervisorinnen und Supervisoren (Weigand, 1982; Gotthardt-Lorenz, 1994).1 Der »Dreieckskontrakt« zählt inzwischen zu den Essentials der Supervision, die »ausgewogene Balancierung institutioneller Dreiecke« kann Möller (2000, S. 270) zufolge als »das wichtigste Gütekriterium gelungener Supervision« gelten. So sehr organisationale Dreiecke, triadisches Denken und Triangulierung auch zum Kernbestand beraterischen Arbeitens gehören, so wenig existiert bislang eine Gesamtschau, die die Felder, die Gegenstandsbereiche und die Arbeit von Beraterinnen und Beratern unter dem Aspekt der Triade und der Triangulierung in ein zusammenhängendes, schlüssiges und praxisrelevantes Konzept gießt. Einen solchen Grundriss triadischen Arbeitens in der Supervision (aber auch angrenzender arbeitsweltlicher Beratungsformate wie Coaching oder Organisationsberatung) legen wir mit diesem Band vor. Damit haben wir weniger eine methodische Anleitung zum triadischen Handeln in Arbeitswelt und Beratung im Sinn, sondern eine konzeptionelle Grundlegung triadischen Arbeitens selbst.
1.1Das Dritte liegt in der Luft
Triadisches Denken wird in den letzten Jahrzehnten weit über das Feld der Beratung hinaus zu einer zentralen gesellschaftlichen Herausforderung, was wesentlich mit dem Wandel der Moderne zur sogenannten »reflexiven Moderne« zu tun hat. Ulrich Beck und Kollegen gehen davon aus, dass im Übergang zur »reflexiven Moderne« die »Institutionen fortgeschrittener westlicher Gesellschaften vor der Herausforderung [stehen], eine neue Handlungs- und Entscheidungslogik zu entwickeln, die nicht mehr dem Prinzip des ›Entweder-oder‹, sondern dem des ›Sowohl-als-auch‹ folgt« (Beck, Bonß u. Lau, 2004, S. 16). In den gesellschaftlichen Bereichen, die im Fokus des vorliegenden Buchs stehen – Lebenswelt, Arbeitswelt und Beratung – wird zunehmend deutlich, dass wir es mit einer Pluralität von Familien-, Lebens- und Arbeitsformen zu tun haben, in denen die traditionellen Normen und Rollensysteme kaum noch greifen und immer mehr Aspekte menschlichen Lebens der interpersonellen Aushandlung, der Kommunikation und Koordination zwischen Personen und Gruppen aufgebürdet werden. Menschen müssen lernen, triadisch zu verstehen und triangulär zu handeln, sie sind aufgefordert, sowohl in sich als auch zwischen sich dem Sog der Spaltung und Vereinfachung zu widerstehen und immer wieder neu um eine trianguläre Balance zu ringen. Stellt man sich den Herausforderungen des triadischen Denkens – mit Pluralisierungen und Ambivalenzen reflexiv umzugehen – nicht, gerät man in die Fänge der Vereinfachung, des Fundamentalismus, Nationalismus, Populismus und Autoritarismus. Die alte Logik des Dualismus (entweder – oder, gut – böse, Freund – Feind, ihr – wir …) feiert hier ihre Wiederauferstehung – zum Leidwesen von Demokratie und Humanität.
1.2Zur Geschichte triadischen Denkens
Die Einsicht in die zugleich öffnende wie strukturierende Bedeutung der Triade reicht bis in die Frühzeit soziologischen, psychoanalytischen und systemischen Denkens zurück. Wegbereiter soziologischen Verständnisses triadischer Verhältnisse ist Georg Simmel, der in seiner im Jahr 1908 erschienenen »Soziologie« eine differenzierte Analyse triadischer Verhältnisse vorgelegt hat, die u. a. Grundideen der Mediation vorwegnimmt. Entlang der Doppelfunktion des Dritten, sowohl zu verbinden als auch zu trennen, analysiert Simmel die »Einigungsformen« des Vermittlers, des Unparteiischen und des Schiedsrichters sowie die »Trennungsformen« des »lachenden Dritten« (»Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte«) und des »Teile und Herrsche« (Simmel, 1908/1992; Tietel, 2003).
Doch nicht nur die soziale Ordnung trägt triadische Züge, auch die entwickelten Formen des menschlichen Seelenlebens erfordern eine triadische Struktur, die im konflikthaften Durchlaufen und Auflösen des Ödipuskomplexes (Freud, 1923/1987) erworben wird. Melanie Klein (1928/1991) entdeckte, dass die ödipale Triade vielfältige Vorläufer in der frühen Triangulierung besitzt. Der Begriff »Triangulierung« wurde in den 1970er Jahren durch Abelin (1971) im Gefolge der Zuwendung zum Vater als triangulierendem Dritten in der »Mutter-Kind-Symbiose« zu einem festen Bestandteil des psychoanalytischen Denkens. Die Formulierung eines »triangulären Raumes« durch Britton (1989) kann als weiterer Meilenstein angesehen werden.
Auch im Umfeld systemischer Ansätze gibt es eine eindrucksvolle Tradition der Thematisierung triadischer Verhältnisse. Kerr und Bowen (1988; eigene Übers.) zufolge ist »die kleinste emotionale Einheit« die Triade. Und wie die Psychoanalyse davon ausgeht, dass »nur wenige Entwicklungsschritte so anspruchsvoll für die seelischen Funktionen [sind] wie das Voranschreiten von einer Zweierzu einer Dreierbeziehung« (Fonagy, 1998, S. 141), sieht man auch in der systemischen Familientherapie »die Triade […] als eine in der Menschheitsentwicklung bisher kaum bewältigte soziale Situation« an (Bosch, 1983, S. 30). So schreibt denn auch Virginia Satir (1973, S. 74): »Meiner Meinung nach ist nichts schwieriger als die Beziehung zwischen drei Menschen.« Aus dem systemischen Kontext zu nennen ist noch Haleys (1980) Konzeption »perverser« Dreiecke, das von Selvini-Palazzoli et al. (1978) in der Analyse von Allianzen und Koalitionen in Organisationen aufgegriffen wurde. Bündnisse, Koalitionsbildungen und vor allem die sogenannte »Triangulation« sind zentrale Konzepte bei Minuchin, Rosman und Baker (1991) zu psychosomatischen Krankheiten in der Familie und im familientherapeutischen Ansatz Satirs (1973, 2002). Die begriffliche Nähe von »Triangulierung« und »Triangulation« hat im beraterischen Diskurs zu viel Verwirrung geführt, bezeichnet Triangulierung in psychoanalytischer Perspektive doch einen höchst anspruchsvollen Entwicklungsschritt und bedeutet Triangulation bei Minuchin et al. (1991) die Verstrickung eines Kindes in die konflikthafte elterliche Beziehung, sodass es nicht umhin kommt, für den einen oder anderen Elternteil Partei zu ergreifen und auf diese Weise in Loyalitätskonflikte verstrickt oder zum Sündenbock gemacht wird.
1Wir beziehen uns in diesem Buch vor allem auf das Beratungsformat Supervision, weil es hier einen mittlerweile 30-jährigen Diskurs über die Bedeutung von Triaden, Triangulierung sowie triadischem Denken und Arbeiten gibt und die supervisorische Identität in besonderer Weise von der Idee der Triangulierung geprägt ist. Kann Supervision so als Vorreiter triadischen Denkens gelten, hält dieses in den letzten Jahren auf vielfältige Weise auch in andere Beratungsansätze Einzug.
2
Konzeptueller Ausgangspunkt: Mit dem Dritten sieht man besser …
Triadisches Denken bzw. eine triadische Epistemologie versteht sich zunächst einmal als Ergänzung und Alternative zur zweiwertigen Logik des Denkens »mit ›Ja/Nein‹-Entscheidungen« (Giesecke, 2007, S. 273–279). Der »triadische Blick« auf soziale Zusammenhänge differenziert und vervielfältigt die Wahrnehmung von sozialen Phänomenen, wenn anstelle von dyadischen Beziehungen triadische Konstellationen identifizierbar werden. So erschließt sich die Dynamik im System Schule differenzierter, wenn man nicht allein auf Lehrer-Schüler- oder Lehrer-Eltern-Interaktionen fokussiert, sondern das Dreiecksverhältnis zwischen Lehrer, Schüler und Eltern untersucht. Zugleich begrenzt triadisches Denken die Komplexität: Wenn man eine mehrdimensionale und komplexe Dynamik (beispielsweise ein Netzwerk) auf eine zentrale Dreiecksstruktur bzw. auf eine Reihe relevanter Dreiecke reduziert, wird diese überschaubarer und angemessener analysierbar.
So ist das Dreieck Lehrer-Schüler-Eltern natürlich nur ein Ausschnitt aus einem Netzwerk mit vielen weiteren Akteuren, dessen komplexe Dynamik weder überschaubar noch präzise fassbar ist. Löst man jedoch methodisch die Komplexität eines sozialen Systems in seine Dreiecksbeziehungen auf (Eltern-Eltern-Lehrer, Schüler-Schüler-Lehrer, Eltern-Elternsprecher-Schulleitung, Lehrer-Schulleitung-Schulaufsicht etc.) und findet man heraus, welche Dreiecke für das Problem (oder den Konflikt), das zur Klärung ansteht, relevant sind, dann kommt man einem Verständnis näher (Hessisches Kultusministerium, 2013). Denn nun kann man gezielt die emotionale und soziale Dynamik in den betreffenden Dreiecken untersuchen und einer Klärung oder Lösung näherbringen.
Wenn wir, so Buchholz (1993, S. 8), »auf etwas aus wenigstens drei Blickpunkten schauen […], können wir einigermaßen sicher sein, dass wir einen Zipfel der Wirklichkeit erwischt haben«. Wenn sich so die Welt auch nicht in Dreiecke aufzulösen vermag, so gehen wir hier jedoch davon aus: Mit dem Dritten sieht man besser … Bis sich das genauer erschließt, müssen wir zunächst eine Reihe triadischer Grundbegriffe und -konstellationen skizzieren.
2.1Von der Dyade zur Triade
In welcher Weise triadisches Denken nicht nur zu einer kognitiven Reduktion von Komplexität, sondern gegenüber dem zweiwertigen Denken zunächst einmal zu einer erheblichen Differenzierung führt, erschließt sich, wenn man dem figurativen Unterschied zwischen einer Dyade und einer Triade nachgeht. Die Dyade besteht aus zwei Elementen (z. B. Personen), zwischen denen eine Beziehung besteht (siehe Abbildung 1).
In der Dyade bestehen zwei Bewegungsmöglichkeiten:
–Entweder aufeinander zu bis zur potenziellen Verschmelzung, wodurch sie in eine symbiotische Einheit mündet (psychoanalytisch gesehen: die Rückkehr in das intrauterine Paradies der Ungetrenntheit).
–Die andere Bewegungsmöglichkeit ist die zentripetale, die Bewegung voneinander weg, bis die Entfernung so groß wird, dass die Beziehung abreißt und zwei Monaden (z. B. zwei getrennte Personen) ihrer Wege gehen.
Abbildung 1: Einfache Dyade zwischen zwei Personen
Paarbeziehungen sind häufig mit dem Ringen um eine Balance zwischen Nähe und Distanz beschäftigt, dem Oszillieren zwischen der Tendenz zur Verschmelzung und der (Gegen-)Tendenz zu Unabhängigkeit und Autonomie. Der Wunsch nach Verschmelzung weckt Angst vor Abhängigkeit und Ich-Verlust, und der Wunsch nach Unabhängigkeit weckt Trennungs- und Einsamkeitsängste.
In der Triade haben wir es nun mit einer enormen Vervielfältigung der Beziehungen zu tun (siehe Abbildung 2). Zwar kommt gegenüber der Dyade nur ein Element (z. B. eine Person) hinzu, aus einer Beziehungslinie werden aber unversehens vier Beziehungen: die drei Dyaden (A–B, A–C und B–C) sowie die Beziehung aller drei zusammen (also A–B–C).
Abbildung 2: Triade zwischen drei Elementen (Personen)
Alles, was für die Dyade gilt, gilt auch für die dyadischen Beziehungen in einer Triade, erweitert um die Konstellationen, die (mindestens) drei Akteure/Personen voraussetzen. So gibt es in der Triade die Möglichkeit zu unmittelbaren bzw. Teilhabe-Beziehungen (jedes Mitglied einer Triade hat an zwei Beziehungen unmittelbar teil) und mittelbaren oder »Umweg-Beziehungen« (z. B. zwischen A und C, wenn A zwar eine unmittelbare Beziehung zu B, aber nur über diesen auch eine – mittelbare – Beziehung zu C hat). In einer Triade kann es ausgewogene Beziehungen zwischen allen dreien geben, aber auch den Wunsch nach einer »exklusiven« Beziehung (Nur du und ich – wir brauchen den anderen nicht) oder zumindest nach einer »privilegierten« Beziehung (Wenn ich schon nicht der/die Einzige sein kann, will ich wenigstens der/die Wichtigste sein). Eifersuchtsgefühle, Rivalität und Neid können aufkommen, wenn meine »beste Freundin« ihrerseits – und sei es nur in meiner Fantasie – eine andere beste Freundin hat. All diese Beziehungsfiguren setzen mindestens drei Personen voraus. Weiterhin kann in einer Triade der Dritte wichtige Funktionen für die je anderen übernehmen: Er kann als Bote Nachrichten überbringen, er kann vermitteln oder schiedsrichten, um einen Zusammenhalt zu