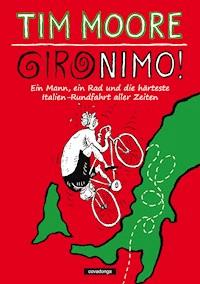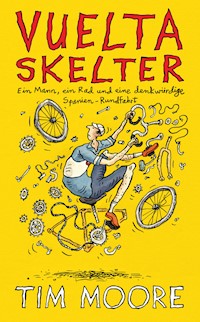9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Covadonga
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Eine irrsinnige Solo-Expedition: 9.000 Kilometer auf dem Iron Curtain Trail von der Arktischen See ans Schwarze Meer - mit einem DDR-Klapprad. Tim Moore, bereits als extrem tollkühner und -patschiger Held etlicher urkomischer Abenteuertrips in Erscheinung getreten, erklimmt einen neuen Gipfel des leichtsinnigen Übermuts. Er nimmt sich vor, die 9.000 Kilometer entlang des einstigen Eisernen Vorhangs abzuradeln, und setzt sich dazu auf ein altes DDR-Klapprad mit mickrigen 20-Zoll-Laufrädern und lächerlichen zwei Gängen. Bekannt dafür, keiner Unannehmlichkeit aus dem Weg zu gehen (und jeder Unannehmlichkeit zu begegnen), beginnt er seine Reise am nördlichsten Punkt der russisch-norwegischen Grenze genau rechtzeitig, um den brutalen Zenit des arktischen Winters zu erleben und sein tapferes MIFA 904 fortan durch die endlose Eishölle der finnischen Tundra prügeln zu dürfen. Moore schläft in Banktresoren, herrschaftlichen Palästen und original erhaltenen sowjetischen Jugendherbergen, er schlägt sich mit wodka-befeuerter Feindseligkeit, rumänischen Erdrutschen und einer überaus knödellastigen Diät herum. Aber der Abenteurer aus England und sein niedliches Fahrrad aus volkseigener Produktion halten durch - dank der Gastfreundschaft von lappländischen Rentierzüchtern und serbischen Rockstars sowie den magischen Segnungen eines deutschen Energydrinks. Und irgendwann, nach drei Monaten, zwanzig durchquerten Ländern und einem Temperatursprung um 58 Grad Celsius, holpern die beiden tatsächlich an ihr Ziel, die bulgarische Schwarzmeerküste - spürbar älter und weiser geworden, aber vor allem älter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
TIM MOORE
MIT DEM
KLAPPRAD
IN DIE KÄLTE
Abenteuer auf dem Iron Curtain Trail
Aus dem Englischen von Olaf Bentkämper
Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel »The Cyclist Who Went Out in the Cold. Adventures along the Iron Curtain Trail« bei Yellow Jersey Press, London. Yellow Jersey Press ist ein Teil der Unternehmensgruppe Penguin Random House.
© Tim Moore 2016
Gemäß UK Copyright, Designs and Patents Act 1988
1st Tim Moore der Urheber dieses Werkes.
Tim Moore:
MIT DEM KLAPPRAD IN DIE KÄLTE – Abenteuer auf dem Iron Curtain Trail
Aus dem Englischen von Olaf Bentkämper
© der deutschsprachigen Ausgabe: Covadonga Verlag 2017
Covadonga Verlag, Spindelstr. 58, D-33604 Bielefeld
ISBN (Print): 978-3-95726-017-8
ISBN (E-Book): 978-3-95726-021-5
Cover-Illustration: Adam Hancher
Übersichtskarten und Illustrationen im Innenteil: Michael A. Hill
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar
Covadonga ist der Verlag für Radsportliteratur.
Besuchen Sie uns im Internet: www.covadonga.de
Mein besonderer Dank gilt: der wundervollen Raija Ruusunen, Ed Lancaster und dem ECF, Stephen Hilton, den diversen Samaritern aus Hossa, Peter Meyer und allen anderen bei MIFA, Matt, Fran und Nick von Yellow Jersey, Peter Milligan, meiner gesamten Familie, Genosse Timoteja und Oberstleutnant Stanislaw Petrow.
Tim Moore ist Britanniens unermüdlicher Jedermann-Abenteurer: Er ist bereits mit einem störrischen Vierbeiner durch Spanien gewandert (»Zwei Esel auf dem Jakobsweg«) und einmal quer durch Europa gereist, um alle Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer zu treffen, denen die ultimative Schmach widerfuhr (»Null Punkte«), er hat fast eine richtige Tour de France gemeistert (»Alpenpässe und Anchovis«) und ist, gehandicapt durch ein hundert Jahre altes Fahrrad mit Holzfelgen, die Strecke des berüchtigten Giro d’Italia 1914 abgeradelt (»Gironimo!«). Für dieses Buch begab er sich nun, unter fahrlässiger Missachtung des natürlichen Alterungsprozesses und des letzten Funkens an gesundem Menschenverstand, auf eine Odyssee, die noch ambitionierter – und wesentlich dümmer – war als all diese Trips zusammen. Irgendwie lebt er noch immer in London.
INHALT
1. Auf nach Norden
2. Finnisch-Lappland
3. Der Winterkrieg
4. Nordösterbotten
5. Zentral- und Südfinnland
6. Russland
7. Estland und Lettland
8. Litauen und Kaliningrad
9. Polen
10. Deutsche Ostseeküste
11. Innerdeutsche Grenze
12. Tschechische Republik, Deutschland und Österreich
13. Ungarn, Slowenien und Kroatien
14. Serbien
15. Rumänien
16. Serbien (2)
17. Bulgarien und Mazedonien
18. Bulgarien (2)
19. Griechenland, Türkei und Bulgarien
1. AUF NACH NORDEN
»Sie verstehen, wie es hier ist, das Wetter?«
Der betagte Norweger mit der Charlie-Brown-Ohrenklappenmütze war der erste Fußgänger, dem ich begegnete, seit ich in Kirkenes aufgebrochen war, einer kleinen Hafenstadt, die sich tapfer in die nordöstlichste Ecke Europas kauerte. Mit seinem dritten und lautesten Versuch war es ihm endlich gelungen, sich durch einen heulenden Blizzard und die vielen wärmenden Schichten, die um meinen Kopf gewickelt waren, verständlich zu machen.
Es war eine ernüchternde Replik auf meine vorausgegangene Erkundigung, wie weit es bis zum jenseits der finnischen Grenze gelegenen Näätämö wäre, der nördlichsten Ansiedlung der Europäischen Union und weit und breit dem einzigen Ort, der mir eine Unterkunft für die Nacht und damit eine Alternative zu einem einsamen Tod in polarer Finsternis in Aussicht stellte. Mein Verständnis dessen, wie es hier war, das Wetter, war nach meinem Dafürhalten recht solide für einen Absolventen der Klugscheißer-Akademie für Klimaforschung: Unsere Unterhaltung trug sich 400 Kilometer nördlich des Polarkreises zu, und das im Winter. Gleichwohl hatten sich meine Kenntnisse im Laufe der vergangenen 18 Stunden noch erheblich erweitert, und zwar auf eine Weise, die auf den entblößten Partien meines Gesichts gefrorene Tränen aus Schmerz und Schrecken hinterlassen hatte. Ich nickte kraftlos, dabei acht Prozent meiner körperlichen Reserven aufbrauchend.
»Warum sind Sie dann MIT FAHRRAD unterwegs?«
Der Weg zur einsamen Unterkühlung hatte unter grausam anderen Umständen seinen Anfang genommen. Im August zuvor saß ich vor einem Café in Florenz und ließ einen weiteren Tag an vorderster Front des abseitigen Reisejournalismus ausklingen. In diesem Fall war ich daran gescheitert, unter einer innerstädtischen Brücke und unter den wachsamen Blicken einer Hundertschaft ortsansässiger Zuschauer Riesenwelse zu fangen. Mein Handy klingelte: Es war der Deutschland-Korrespondent des Guardian, und er bat mich um meine Meinung über etwas, von dem ich, statt mir wie sonst nur zu wünschen, dass es so wäre, tatsächlich noch nie gehört hatte. Entsprechend kurz fiel unsere Unterhaltung aus, gerade lang genug, um meinem Gesprächspartner eine griffige Schlagzeile zu liefern: »Teilzeitradler weiß nichts über den neuen Iron Curtain Trail.«
Am nächsten Tag machte ich mich auf den Heimweg. Den üblichen Billigflieger hatte ich für diese Reise gegen die vierrädrige Frucht einer Geizkragen-Midlife-Crisis eingetauscht: einen zweitürigen, nicht ganz schrottreifen 18 Jahre alten BMW, den ich unlängst günstig erworben hatte. Es war eine nachdenkliche Fahrt, teils aufgrund meiner nachlässig gewählten Route, teils weil sich der Kühlerschlauch löste, wann immer ich Gas gab. In Norditalien fand ich mich auf weiten, gewundenen Abschnitten der Straßen wieder, auf denen ich zwei Jahre zuvor gefahren war, als ich auf einem 99 Jahre alten Fahrrad mit hölzernen Felgen auf den Spuren des Giro d’Italia von 1914 gewandelt war. In Frankreich begegnete ich einigen der alpinen Anstiege wieder, derer ich mich noch, weitaus vager, von meiner Rundreise auf der Strecke der Tour de France 2000 erinnerte. Und die ganze Zeit geisterte mir die Idee im Kopf herum, den besagten Iron Curtain Trail, einen Radwanderweg entlang des früheren Eisernen Vorhangs, in Angriff zu nehmen.
Welch herrlich kühles und belebendes Gegenmittel wäre eine solche Reise doch zu diesem sonnenverdörrten südeuropäischen Sommer, dem ich aktuell ausgesetzt war und der noch dazu durch regelmäßige Gesichtsduschen aus Frostschutzmittel verschönert wurde, die ich jedes Mal verpasst bekam, sobald ich in einer Parkbucht die Motorhaube öffnete. Dazu gesellten sich nostalgische Erinnerungen an eine dreimonatige Reise quer durch Skandinavien und weite Teile des Ostblocks, die ich 1990, nur wenige Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer, mit meiner Frau unternommen hatte. Dieses ebenso überambitionierte wie unterbudgetierte Abenteuer hatte, wie mir nun klar wurde, die Vorlage für sämtliche meiner anschließenden Reisen geliefert. Wir schlugen uns mit gestohlenem Speck durch und wechselten uns ab am Steuer eines – hmmm – zweitürigen, 18 Jahren alten Saab.
Auf die damalige Reise zurückblickend, zogen vor meinem geistigen Auge wiederkehrende Bilder ausgedehnter, durch eine versiffte Windschutzscheibe betrachteter Ebenen vorüber. Die Aussicht, unbeschwert durch eine so wundervoll flache Gegend zu radeln, übte ungemeinen Reiz aus auf einen Mann, der nun durch eine andere versiffte Windschutzscheibe auf einige der grausamsten Steigungen unseres Kontinents blickte: Steigungen, die er sich mit einem Rad hinaufgequält hatte, als er entweder schon ein wenig zu alt für ein solches Unterfangen gewesen war oder aber viel zu alt. Andererseits war dieser Mann inzwischen zwei Jahre älter als viel zu alt, und 6.700 Kilometer, die Gesamtdistanz des Iron Curtain Trail, wie der Korrespondent des Guardian der vorliegenden Pressemitteilung entnommen hatte, waren das Doppelte dessen, was er jemals zuvor am Stück geschafft hatte.
Ich kehrte heim mit einer neuen Obsession und der Befähigung, in einer Auswahl von fünf kontinentalen Sprachen um demineralisiertes Wasser zu bitten. Als ein Kind des Kalten Krieges – den ich zudem viele Jahre als richtiger Erwachsener erlebt hatte – konnte ich noch immer nicht fassen, dass man heute unbesorgt kreuz und quer entlang des Todesstreifens herumreisen konnte. Meinem jüngeren Ich wäre das völlig undenkbar erschienen. Mit zwölf hatte ich ein holzverkleidetes Kurzwellenradio aus russischer Fabrikation erstanden und endlose Stunden damit verbracht, den geisterhaften Pausenzeichen von Propagandasendern aus sowjetischen Satellitenstaaten zu lauschen, Endlosschleifen zehntöniger Trompetenfanfaren, unterbrochen von der schmeichlerischen Stimme eines Überläufers, die verkündete: »Hier ist Radio Prag, Tschechoslowakei.« Ich war davon gleichermaßen fasziniert wie verängstigt. Damals wäre man kurzerhand dafür ins Gulag geschickt worden, Wrigley’s Juicy Fruit hinter den Eisernen Vorhang zu schmuggeln, oder aber man wäre erschossen worden bei dem Versuch, darüber hinwegzuklettern. Heute konnte ich den einstigen Todesstreifen mit dem Rad passieren, wie es mir gefiel.
Darüber hinaus verlief dieser Iron Curtain Trail entlang der gesamten Länge des, wie Sie mir sicher zustimmen werden, herrlichsten Kontinents unseres Planeten, dessen Vielfalt an Kultur, Geschichte, Klima und Geografie seinesgleichen sucht – das alles in einem handlichen Paket! Schon jetzt dermaßen Feuer und Flamme, dass es keinen Weg mehr zurück gab, kontaktierte ich die European Cycling Federation, die bürokratischen Overlords dieses und eines Dutzend weiterer »EuroVelo«-Langstreckenradwege, die unseren schönen Kontinent durchziehen. Der Iron Curtain Trail firmierte, wie ich bald erfuhr, unter dem offiziellen Namen EuroVelo-Route 13 und verlief durch nicht weniger als 20 Länder zwischen Kirkenes in Norwegen und dem Endpunkt Zarewo an der bulgarischen Schwarzmeerküste.
Nachforschungen im Netz förderten ein paar anregende Fakten über die Route zutage, die zu absolvieren ich mich mittlerweile emotional verpflichtet fühlte. Lange Passagen der 6.700 Kilometer, die der EV13 umfasste, waren bislang noch nicht ausgeschildert worden, angefangen mit den kompletten 1.700 Kilometern durch Finnland. Andere Abschnitte waren nur vage durch gepunktete Linien verzeichnet, insbesondere in Russland, wo die Route sich eine Zeitlang einen Weg durch das Landesinnere bahnte, um einen langen Streifen entlang der Ostseeküste zu meiden, der wegen einer Vielzahl an atomaren und militärischen Einrichtungen für Ausländer gesperrt war. Nicht minder aufregend war die Entdeckung, dass bisher noch niemand den EV13 in seiner ganzen Länge bewältigt hatte – sofern man bereit war, von einem gesponserten Team großzügig ausgestatteter E-Bike-Fahrer abzusehen (was ich ohne weiteres war) und mitleidlos einen Deutschen mittleren Alters dafür zu missachten, nicht ganz am richtigen Ort gestartet zu sein (was mir nicht schwerfiel).
Ich überzeugte den Lektor meines Verlags und bereinigte meinen Terminkalender. Dann schickte ich der ECF eine E-Mail, um sie mit meinem bahnbrechenden Vorhaben zu beeindrucken und um mich zu erkundigen, ob einige der fehlenden Teile des EV13 inzwischen ergänzt worden wären. In den Wochen darauf beschämte mich Ed Lancaster von der ECF mit seiner freundlichen und unschätzbaren Hilfe, allerdings hatte mich seine allererste Reaktion auf mein Ersuchen mit Regungen ganz anderer Art erfüllt: »Ich halte es an dieser Stelle für geboten, darauf hinzuweisen, dass wir die Gesamtdistanz inzwischen mit 10.000 Kilometern veranschlagen«, las ich, den Kiefer auf maximales Klaffen ausgehängt, »also vielleicht ein bisschen mehr, als Sie sich ausgerechnet hatten.« Ein bisschen mehr. Also ziemlich genau 50 Prozent mehr. Demnach nicht das Doppelte dessen, was ich bisher maximal am Stück gefahren war, sondern das Dreifache. Ich hatte seit einem Jahr kaum ein Pedal bewegt und in nur wenigen Monaten stand mein, hüstel, elfundvierzigster Geburtstag an.
Meine Frau hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, mein bevorstehendes Abenteuer Freunden und Bekannten gegenüber fröhlich als »Fahrt ohne Wiederkehr« anzukündigen. Das sanft nagende Tröpfeln dieser Prognose schwoll nun jäh zu einem Strom ätzenden Konzentrats, das ein zerklüftetes, dampfendes Loch in meine Moral fraß. Zehntausend Kilometer bedeuteten nicht nur eine Fahrt ohne Wiederkehr, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit direkt ins Grab. Aber es war nichts mehr zu machen: Meine Verpflichtung war seit kurzem nicht mehr nur emotionaler Natur, sondern auch vertraglich festgehalten. Nicht nur das, ich hatte auch schon ein Rad gekauft. Und was für eins.
Die MIFA-900-Serie wurde 1967 bei der Leipziger Frühjahrsmesse vorgestellt, begleitet von dem, was in der Deutschen Demokratischen Republik als großer Werberummel durchging – ich stelle mir dabei eine Schar bebrillter Herren in grauen Anzügen vor, die ausdruckslos applaudieren, während ein mehr schlecht als recht als Hostess getarnter Stasi-Offizier sorgfältig Intensität und Kadenz des Beifalls jedes einzelnen Individuums notiert. Oberflächlich gesehen stand das 20-Zoll-Rad mit faltbarem Rahmen und tiefem Einstieg der neuen Generation kompakter Stadtfahrräder, die damals im Westen lanciert wurde, in nichts nach – erst zwei Jahre zuvor war mit dem Dawes Kingpin das Genre der Klappräder geboren worden und das MIFA 900 ging sogar 18 Monate früher in Produktion als das berühmte Raleigh Twenty.
Doch hob man das erste MIFA 900 – genau genommen ein 901 – von der ruckelnd rotierenden Drehbühne, kam man nicht umhin, die eine oder andere Unzulänglichkeit zu bemerken. Zum einen hatte das Rad keine Gangschaltung. Ihm fehlten die Verstrebungen, welche die anfälligen offenen Rahmen seiner westlichen Pendants verstärkten, und es war zudem mit einem sichtlich unzureichenden Klappscharnier ausgestattet. Besonders hervorstechend war der einzelne Bremshebel, der einen Metallstab betätigte, mit Hilfe dessen ein stabiler Gummiklotz durch ein Loch im Schutzblech gegen das Vorderrad gedrückt wurde. Diese erschreckend lausige »Stempelbremse« war ein Rückschritt in die Zeit der Hochräder – eine Zeit, als Bremsprobleme die Hauptursache für 3.000 radbedingte Todesfälle im Jahr waren und etwa 3.012 Menschen ein Rad besaßen.
Die Mitteldeutschen Fahrradwerke, deren Akronym dem MIFA seinen Namen gab, stellte die 900er-Serie bis zum Fall der Mauer her. Die Entwicklung des Modells im Verlauf dieser 22 Jahre zeigt auf anschauliche Weise, wie es um den Staatssozialismus sowjetischer Prägung bestellt war: Es gab keine Entwicklung. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ab 1973 wurden die Zierstreifen auf den Schutzblechen, die bis dahin in der gleichen Farbe wie der Rahmen gehalten waren, einheitlich in einem ökonomischeren Genossenrot lackiert. Ab 1986 wechselte man zum weniger genossenschaftlichen, dafür noch ökonomischeren Schwarz. 1977 wurde außerdem mit dem 904 ein echtes Aushängeschild vorgestellt, mit Gepäckträger vorne und hinten, durchschlagskräftigem 29-Millimeter-Geschütz und einer herkömmlichen, nichtantiquierten Vorderrad-Felgenbremse. Aber die große Mehrheit der 900er war weiterhin mit Stempelbremse ausgestattet, und keines bot eine Gangschaltung oder einen Rahmen, der nicht sofort nachgab, wenn man gut im Futter war.
Auf den ersten Blick hätte solch archaische Schäbigkeit unweigerlich zum kommerziellen Scheitern führen müssen – insbesondere, da ich mir das Geschütz nur ausgedacht habe. Aber in der DDR war Kommerz kein Faktor. Frei nach Henry Ford: Die DDR-Bürger konnten jedes Fahrrad haben, das sie haben wollten, solange es das MIFA 900 war. Und nicht nur die DDR-Bürger – das 900 wurde den Genossen im gesamten Ostblock untergejubelt und zum konkurrenzlosen Standard pedalgetriebener Flitzer von Vietnam bis Kuba. Die Folgen dieses internationalen Monopols waren durchaus frappierend. 1977 wurden 150.000 Raleigh Twentys hergestellt – das annus mirabilis dieses letzten großen globalen Wurfs der britischen Fahrradindustrie, von dem letztlich insgesamt etwas mehr als eine Million Stück verkauft wurden. Von der 900er-Serie aber waren es laut www.foldingcycling.com allein im Jahr 1978 mehr als 1,5 Millionen, die das MIFA-Werk in Sangerhausen verließen. Als 1990 das letzte vom Band rollte, waren mehr als drei Millionen gebaut worden. Lässt man China mal außen vor, wird man es schwer haben, eine Maschine in der Geschichte der Radherstellung zu finden, die diese Zahl übertrifft. Ich habe es versucht und bin gescheitert.
Und nachdem ich gescheitert war, wollte ich eins haben. Genauso war es mir auf jener Reise 1990 ergangen, als ich eine tiefe mütterliche Zuneigung zu den vielen Trabants entwickelte, die verwaist auf sämtlichen osteuropäischen Straßen standen, mit zerbrochenen Scheinwerfern und offen stehenden Bakelit-Türen, mitleidig belächelt von den VWs und Audis, die sie abgelöst hatten und nun geschmeidig vorbeisausten. Auch vom Trabbi wurden drei Millionen gefertigt, auch er war ein allgegenwärtiges, aber ungeliebtes hässliches Entlein, ein weiterer semi-funktionstüchtiger, billig zusammengeschusterter Anachronismus. Und jeder einzelne ein kleines Stück großer Geschichte, ein Symbol des gleichmacherischen sowjetischen Experiments, das auf seinem Höhepunkt ein Drittel der Erdbevölkerung einbezog. Ich war so aufgewachsen, Osteuropäer entweder mit Furcht oder Mitleid zu betrachten, je nachdem, ob sie vor einer endlosen Parade von Raketenwerfern salutierten oder aber dafür vermöbelt wurden, Levi’s-Jeans zu tragen. Doch wie affektiert erschienen mir meine jugendlichen Regungen nun, als wir an all den Plastebombern vorbeifuhren. Dieses dämliche Kühlergrill-Grinsen war das wahre Gesicht des sogenannten Reich des Bösen. So einen albernen, plumpen kleinen Schrotthaufen musste man einfach ins Herz schließen, es sei denn natürlich, man hatte mal einen besessen. Wie auch immer, einigen wir uns einfach darauf, dass das MIFA 900 ein Art Trabbi auf zwei Rädern war, und das war der Grund, warum ich eines schönen Tages ein schwarz abgesetztes Schutzblech durch den verschneiten Eingang des nördlichsten Hotels in Europa schob.
Ich hatte das Hotel mit der Absicht, dort zu übernachten, lange im Voraus gebucht, aber ganz Kirkenes war gerade dick eingemummelt auf dem Weg zur Arbeit, als ich mein in Plastikfolie eingeschlagenes Rad an vereisten Bürogebäuden und Lagerhäusern vorbeischleppte. Der nächtliche Schneesturm hatte sich gelegt, doch seine Auswirkungen lagen tief und frisch und gleichmäßig auf dem Startort meiner Reise, einer archetypisch skandinavischen Studie freudlosen und öden Wohlstands. Meine schweren Arctic-Stiefel rangen um Halt: Wenn ich schon Schwierigkeiten hatte, hundert Meter in diesen robusten Tretern zu laufen, wie sollte ich da auch nur hundert Kilometer auf den daumengroßen Gummiklötzchen zweier Klappradreifen durchstehen?
Mein Körper, der auf der Busfahrt durch die Nacht von den panischen Manövern des im Schneetreiben um Kontrolle ringenden Fahrers mehrfach aus dem Schlaf gerissen worden war, sehnte sich nach Ruhe. Doch in dem Moment, als ich endlich auf das Hotelbett sank, um eine Mütze voll Schlaf zu nehmen, schaltete sich mein Gehirn ein: Missionsmodus aktiviert! Mechanisch raffte ich mich auf und ergab mich dem Klemmbrett schwingenden inneren Herrn meines Schicksals und seiner zackig vorgetragenen Checkliste. Duschen! Jawohl, Sir. Schichtweise Kleidung anlegen! Jawohl, Sir. Geräuschvoll zum Frühstück rascheln, Büfett verheeren, Rad auspacken und montieren, Gepäcktaschen anbringen, Mütze auf, australische Nordlichtbeobachter verstören, Arktis erobern! Wie üblich machte sich dieser dubiose Sir aus dem Staub, sobald ich das Rad nach draußen und die Hoteltreppe hinunter getragen hatte, und überließ mich bar jeder Lebenskraft und Disziplin meinem Schicksal.
Der Hotelier steckte den Kopf zur Tür hinaus und blies angesichts der äußeren Bedingungen die Backen auf, dann charakterisierte er mit vorbildlicher Effizienz meinen Reisegefährten: »Kleines Fahrrad.«
Auch den vordringlichen Mangel meiner Reiseplanung brachte er mit ähnlicher Bündigkeit auf den Punkt: »Sommer ist gut für Fahrrad. Jetzt ist nicht gut.«
Ich wusste, dass der erste Wegpunkt der Route die Straße vorbei am Flughafen war, und bat ihn, mir den Weg zu beschreiben. Er tat dies mit spürbarem Widerwillen, dann verfiel er in einen nachdrücklichen, inständigen Tonfall: »Zu kalt. Nehmen Sie bitte Taxi, zum Flughafen ist nur wenige Kilometer!«
Er zog sich kopfschüttelnd zurück, dann wandte ich meine wächserne, verzagte Miene den jungen, pudelbemützten Schneepflugfahrern zu, die auf dem Parkplatz gegenüber den Schnee zu riesigen Haufen zusammenschoben. Irgendwo unter meiner Sturmhaube versuchte ich, mir ein Lächeln abzuringen.
Das erste Straßenschild, an dem ich direkt hinter Kirkenes vorbeigekommen war, war ein Wegweiser, der nach Süden wies. Ich hatte eine Weile gebraucht, ihn zu entschlüsseln. Die Buchstaben waren kyrillisch und die festgezurrten Zugbänder meiner Kapuze hatten die Außenwelt zu einem winzigen, fleeceumrahmten Schlitz verengt. Murmansk. Ich wusste nicht viel über diesen Ort, aber er hatte einen angemessen eisigen, an John Le Carré gemahnenden Klang an sich. Welch sinnfälliges Stichwort für tiefgründige Grübeleien zum Auftakt meiner Reise: die zerronnenen Träume einer sozialistischen Utopie und der Abermillionen, die als Folge davon gelitten hatten; die allgegenwärtige Gefahr nuklearer Auslöschung, welche die erste Hälfte meines Lebens begleitet hatte; die grundlegende Stimmung hier oben an den zuckenden Ohren des russischen Bären in einer Zeit von Spannungen zwischen Ost und West, wie es sie seit den Tagen des Eisernen Vorhangs nicht mehr gegeben hatte. Inzwischen hatte es nicht mal mehr geschneit, aber dennoch – und obwohl ich erst zwei Kilometer und eine einzige Erhebung hinter mich gebracht hatte – war ich bereits zu erschlagen und erschüttert gewesen für derlei komplexe Betrachtungen. Nun, da sich die Dämmerung über die einsame Winterlandschaft legte, schaltete mein Verstand gänzlich ab und wurde überbrückt von einem primitiven, benommenen Überlebensinstinkt.
Mühsam schlich und schlitterte ich voran, blinzelte durch eisige Sturmböen auf die grimmige, graue Barentssee, die kümmerlichen Skelette eingeschneiter Birken und mein Garmin-GPS, dessen schreckliche Daten kaum lesbar waren angesichts der verschmierten Schlieren, die ich bei meinen Bemühungen hinterließ, das Display mit matter, dreifach behandschuhter Hand sauber zu wischen. In fünf grauenvollen Stunden hatte ich 36 Kilometer zurückgelegt; dem alten Herrn zufolge lag Näätämö noch mindestens 20 weitere entfernt.
Im Hotel in Kirkenes hatte ich zwei Liter kochendes Wasser mit Energydrink in Pulverform gemixt und in meinen CamelBak-Trinksack gefüllt; ich nahm einen matten Zug aus dem Mundstück und fand es von Eis verstopft vor. Ich senkte den rechten Arm zurück Richtung Lenkerhandschuh und begegnete einer seltsamen Steifheit im Ellenbogen. Benommen begriff ich, dass vereister Schweiß die Ärmel meines Anoraks im rechten Winkel schockgefroren hatte. Nun denn, Scheiß auf die soziale und geopolitische Geschichte aus der Zeit des Eisernen Vorhangs. Ich hatte hier meinen eigenen Kalten Krieg zu führen.
2. FINNISCH-LAPPLAND
Zwei Stunden später lag ich erschlagen auf einem Bett und stieß schwache Rentierhackrülpser in Richtung einer Zimmerdecke aus, die mit den Mücken des Vorsommers übersät war. Sämtliche Möbel hatte ich gegen die Heizung unterm Fenster geschoben und mit feuchter Wolle und klammem Polyester drapiert. Die beiden Bettpfosten krönte derweil meine jämmerliche letzte Untersocken-Verteidigungslinie: zwei umgestülpte Supermarkt-Plastiktüten, die in sauren Schwaden ihre widerwärtige Feuchtigkeit ausdünsteten.
Mich damit abfindend, möglicherweise nie wieder klar denken zu können, versuchte ich es ein letztes Mal. Was hatte mich dieser Tag gelehrt? Dass fünf Stunden auf dem Heimtrainer – und eine Runde durch einen Londoner Park auf dem Rad, das jetzt im Flur abtaute – selbst gemessen an meinen historisch unterirdischen Maßstäben keine hinreichende Vorbereitung waren. Dass ich echt eine Menge von Finnland sehen würde und zwar in schneebedingt zähfließender Zeitlupe: Mehr als 1.650 Kilometer lagen noch vor mir, und mein Schnitt lag aktuell bei 8,2 km/h. Dass ich durch dieses Land nicht unter dem frenetischen Jubel der Bevölkerung fahren würde. In erster Linie, weil es keine Bevölkerung gab: Näätämö befand sich hoch oben in der Provinz Inari, einer Region etwa halb so groß wie Holland, in der 6.783 Menschen leben – 4.500 davon in zwei Städten. Auch war, sofern meine Herbergsmutter entsprechende Rückschlüsse zuließ, generell wenig Frenetisches von den Finnen zu erwarten.
Die kleine alte Dame hatte auf meine recht aufsehenerregende Ankunft an ihrer Rezeption reagiert, indem sie eine Hand hob, während sie ihren Blick unverändert verdrießlich auf eine Seifenoper und deren mit zahlreichen Umlauten garnierte Untertitel heftete. Ich zitterte und tropfte geschlagene zwei Minuten, bis eine Werbeunterbrechung ihr gestattete, den neuesten – und, wie ich bald feststellte, einzigen – Gast des Rajamotelli Näätämö zu begrüßen. Ich habe genug Interviews mit Automobilrennfahrern gesehen, um zu wissen, dass Finnen mit einer sehr begrenzten Palette an Gesichtsausdrücken operieren. Dennoch war ich ernsthaft beeindruckt von ihrer steinernen Indifferenz gegenüber meinem Rad, das ihr Linoleum mit einer Lache körnigen Schmelzwassers nässte, und insbesondere auch gegenüber meiner Wenigkeit – einer, wie mein Schlafzimmerspiegel bald enthüllte, durchaus denkwürdigen Erscheinung, die von halbgefrorenem Schnodder überzogen war.
Die letzten Lektionen des Tages hatten sich in rascher Folge entfaltet. Ein randvoller Teller Rentier-Burger mit Pommes und Preiselbeeren lehrte mich, dass ich möglicherweise in den endlosen Weiten zwischen entlegenen finnischen Weilern verhungern, dazwischen aber stets bestens versorgt sein würde. Die Gewohnheit der Wirtin, eine Näherung dessen, was ich soeben zu ihr gesagt hatte, ausdruckslos zu wiederholen (Handtücher? Hantöcher. Essen? Össen. Fahrrad hier? Farradier.), deutete darauf hin, dass sich die Kommunikation in den vor mir liegenden Wochen kompliziert gestalten würde. Neben »Rentier« war »Sauna« unsere einzige gemeinsame Vokabel – beides
3. DER WINTERKRIEG
»Bitte, irgendwas. Brot? Ich sitze auf einem Fahrrad. Es gibt keine Geschäfte. Bitte.«
Zwei Tage unterwegs und ich bettelte schon um mein Leben. Die Vermieterin der Ferienhütte am See erwies sich am Telefon als widerwillige Samariterin; ich hatte soeben ihre Erklärung unterbrochen, dass der Preis von 85 Euro pro Nacht ihre Gäste keineswegs berechtigte, einen Anspruch auf Bettwäsche, Handtücher oder Nahrung jeglicher Art zu erheben. Bis zur Hütte waren es noch mehr als 20 Kilometer, das Tageslicht war eisig, fahl und brüchig, und der nächste Ort, wo ich etwas zu essen kaufen könnte, war die Stadt, von der aus sie mit mir sprach, weitere 60 Kilometer entfernt. Der einzige Trost war, dass Finnlands tiefe Verbundenheit mit Mobiltelefonie mir selbst hier, am einsamen, eisigen Arsch der Welt, eine Signalstärke von drei Balken bescherte.
Ein leidgeprüfter Seufzer knisterte aus dem Lautsprecher, schließlich gefolgt von Worten: »Ein paar andere Leute sind auch noch da. Ich rede mit ihnen und vielleicht sie geben Ihnen was zu essen.«
Für einen Radfahrer ist Schnee wie Sand. Falls Sie mal am Strand Rad gefahren sind, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich das auf Geschwindigkeit und Leichtigkeit des Vorankommens auswirkt. Jeder Kilometer war eine Quälerei aus Keuchen und Schlittern, ein weiterer Kampf im aussichtslosen Unterfangen, eine feindliche Umgebung zu bezwingen. Ich blickte durch meinen vliesgerahmten Schlitz auf vereiste Seen und Wälder, mein gedämpftes Schnauben war der einzige Laut in einem tiefgekühlten Reich weißer Stille. Ich sah meine ersten Rentiere, eine schwermütige, graubraune Kolonne, die mit hängenden Geweihen auf ihrer einsamen Wanderschaft in den Schmortopf eines Bauern durch den Schnee stapfte. Vielleicht ein Mal in der Stunde knatterte ein Auto vorbei, gesteuert von einem Stoiker, der mit ausdrucksloser Miene und einer Kippe zwischen den Lippen unter einer Seemannsmütze hinweglugte. Um mein Band mit der Menschheit nicht abreißen zu lassen, grüßte ich jeden einzelnen von ihnen, wobei ich mit meinen mehreren Schichten an Handschuhen, die wiederum in Lenkerstulpen steckten (so der Name dieser am Lenker befestigten Ofenhandschuhe), nicht mehr zustande brachte als ein Zwinkern. Bis dann die Temperaturen auf minus 13 Grad sanken und meine Lider anfingen festzufrieren.
Bevor ich aufgebrochen war, hatte ich mich über die Risiken und Vorzüge von Radtouren bei extrem kalter Witterung informiert, die online von einer tapferen Bruderschaft von »Eisrad«-Enthusiasten erläutert wurden. Die Vorzüge erschienen mir vage und gering an der Zahl und beschränkten sich auf eine Handvoll rhetorischer Fragen, die nach harschen Entgegnungen schrien: »Suchst du einen Ort, um zu reflektieren und runterzukommen?« »Willst du deine eigenen Grenzen austesten?« »Reizt es dich, dir deinen ganz persönlichen Weg durch die arktische Wildnis zu bahnen?« Eigentlich nicht. Nö. Ganz und gar nicht.
Die Nachteile hingegen lasen sich wie eine endlose Litanei der Gefahren und der Not. In den brutalen Tagen, die vor mir lagen, wurde ich regelmäßig mit den entsetzlichsten unter ihnen konfrontiert. Die meisten drehten sich um die selbstmörderisch launenhaften Reaktionen von Körper und Geist auf extreme Kälte. Man denke nur Captain Oates aus Robert Scotts Expeditions-Team: Als er auf dem traurigen Rückmarsch der Unterlegenen im Wettlauf zum Südpol Erfrierungen erlitt, schlief er fortan mit den Füßen außerhalb des Zelts, weil er die Schmerzen, wenn seine Mauken drinnen auftauten, einfach nicht ertragen konnte. Hut ab – da hatten Durchblutung und Nervensystem wahrlich ein meisterliches Zusammenspiel demonstriert. (Schon tragisch, wenn man bedenkt, dass Oates, hätte er bloß ein paar Plastiktüten unter den Socken getragen, nur 13 Tage später zusammen mit allen anderen hätte verhungern können.)
Dann ist da noch jene todesbegrüßende Bewusstseinstrübung namens Hypothermie. Als Reaktion auf intensive, aber an sich noch
4. NORDÖSTERBOTTEN
5. ZENTRAL- UND SÜDFINNLAND
Bei strahlendem Sonnenschein und mit dem Gepäck im Begleitwagen fuhr ich durch ein ganz anderes Finnland, eine Welt unbeschwerter Geschwindigkeit und ungeahnter Kilometerleistung. Der Matsch zog sich zurück, lief in grobkörnigen braunen Bächen den Rinnstein entlang und schrumpfte auf dem Straßenbelag zu nassen Rorschach-Mustern. Nach zwei Wochen ständigem Knirschen und Malmen unter den Reifen gewöhnten sich meine Ohren an das neuartige Trommeln von Spikes auf Asphalt. Lastwagen bliesen mir die ersten Staubwolken ins Gesicht. Kleckse aus Farbe und Leben bereicherten die tote Palette des Winters: eine zaghafte Knospe, eine blaue Flasche, die eine oder andere große rote Scheune, Skandinaviens architektonisches Geschenk an den Mittleren Westen der USA. Tatsächlich fühlte ich mich nun alle naselang an Amerika erinnert: die endlose Weite, die heruntergekommenen Gehöfte, vor denen rostige Pick-ups standen, das Gejammer der Steel-Gitarren, das aus den meisten der vorüberkommenden Fahrzeuge klang. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hatten sogar die trostlosen, verschlafenen Ortschaften etwas von Fargo an sich.
Zugegeben, abseits der Straße hatte sich Finnland kaum verändert: Im Schatten war es immer noch deutlich unter null und die Landschaft lag unter einer dicken weißen Decke verborgen. Aber immerhin befanden sich jetzt Menschen in ihr, die ihre Langlaufski ein letztes Mal vor dem Frühling herausholten oder die Stille mit dröhnenden Schneemobilen störten. Mindestens ein Mal am Tag kam ich an einem alten Kerl mit Ohrenklappenmütze vorbei, der mit einem Schneeschieber neben seinem Briefkasten stand und mich mit dem Blick bedachte, den ich in den folgenden Monaten noch häufig zu sehen bekommen würde, einem Blick neugieriger Verachtung, der sagte: Wie kann man sich bloß so einen Quatsch antun? Als würde man mit dem Tretboot die Isle of Wight umrunden oder in einer Ritterrüstung einen Marathon laufen. Schon jetzt war nicht zu übersehen, dass das epische Ausmaß meines Unterfangens unweigerlich von seiner innewohnenden Torheit untergraben werden würde.
Von nun an würde ich stets im Laufe des Vormittags unter infernalischem Hupen von meiner Begleitcrew überholt werden, oder auch ohne derlei akustischen Horror, sofern gerade mein ausnehmend nüchterner und konzentrierter Sohn am Steuer saß (erklärend sollte ich hinzufügen, dass dies, seitdem er im Monat zuvor seine Führerscheinprüfung bestanden hatte, nicht nur das erste Mal war, dass er auf der falschen Seite der Straße fuhr, sondern dass er überhaupt am Verkehr teilnahm). Kurz danach würde ich an einer Bushaltestelle mehrere Supermarkt-Fertigburger vertilgen und es fast genießen, nun da das Mittagessen nur eine Mahlzeit war und kein dem Tod vorbeugender Imperativ, den ich mir mit steifen Pfoten in die bibbernde Schnauze fummelte. Viele flache und leichte Kilometer später würde ich an unserer Unterkunft für die Nacht eintreffen, wo die beiden bereits die Sauna anwärmten oder ein Feuer entzündeten oder, bei einer unvergesslichen Gelegenheit, mit dem Hundeschlitten übers Eis flitzten.
Meine Frau hatte eine Ersatzkurbel mitgebracht, um deren Beschaffung ich meine Freunde Matthew und Jim gebeten hatte, nachdem Harri seiner Reparaturarbeit nur eingeschränkte Gewähr beschieden hatte. Als sich die alte Kurbel endgültig verabschiedete, tat sie dies dank eines kleinen Wunders just erst in dem Moment, als ich eines späten Nachmittags an dem ländlichen Gästehaus eintraf, wo wir verabredet waren. Der Betreiber nahm freundlicherweise den Wechsel vor, nachdem er mein unbedarftes Gehämmer auf der Veranda so lange ertragen hatte, wie er eben konnte. Danach ging er wieder hinein, um uns ein Mahl von sternewürdiger Komplexität zuzubereiten. Sein Name war Jarkko und ich erachte ihn als das zweitimposanteste menschliche Wesen, das mir je begegnet ist, knapp hinter dem Vietnam-Veteranen, mit dem ich mal in einem Wald in Kentucky den Sommer von 1775 nachgespielt habe. Jarkko sprach fließend Englisch und nutzte es, um seine lehrreichen und unterhaltsamen Ansichten über Geschichte und Literatur zum Ausdruck zu bringen. Er ist ein ausgewiesener Weinkenner, allwissender Naturkundler und Schiffsingenieur, der außerdem die umfangreichste Steckschlüsselgarnitur sein eigen nennt, die ich je gesehen habe. Abgesehen davon richtete Jarkko es ein, dass wir im Howling Wolf Inn unterkamen.
Wenn Sie die Route 5223 auf Google Street View erkunden, wie ich es gerade getan habe, erblicken Sie einen sanft gewundenen bewaldeten Korridor, gerahmt von der rötlich vergoldeten Pracht des finnischen Herbstes. Das ist nicht die 5223, wie ich sie in Erinnerung habe. Ich erreichte ihren einsamen Beginn als bereits erschöpfte, ja, geradezu fast unkenntliche Gestalt. Früher an diesem Nachmittag, viel früher, hatte ich ein dreieckiges Warnschild passiert, auf dem unter einem großen Ausrufezeichen das Wort »Kelirikko« geschrieben stand. Fünf vergnügliche Minuten lang spekulierte ich über dessen Bedeutung. Nicht detonierte Molotows? Mumin-Keulung? Vielleicht hatten Menschen aufgehört sich zu fragen, ob sie ziellos herumlaufen sollten, und taten es nun auf der Straße. Weitere, deutlich weniger vergnügliche sechs Minuten machten mich mit der, wie ich später erfuhr, in diesen Breiten üblichen saisonalen Schneeschmelze sowie deren dramatischen Auswirkungen auf unbefestigte Straßen bekannt. Wikipedia fasst die damit einhergehenden Herausforderungen prägnant zusammen: »Die einzigen brauchbaren Fahrzeuge während der kelirikko sind Luftkissenboot, Hydrokopter oder Fluggeräte wie zum Beispiel Hubschrauber « Und damit begann meine zweirädrige, dreistündige Ein-Mann-Hommage an den deutschen Rückzug aus Stalingrad.
Die Begleitcrew holte mich ein, als ich gerade mühsam einen Anstieg aus halbgetrocknetem Zement hinaufschlitterte, mir aufmunternde Worte sowie drei Snickers anbietend. Ein paar Stunden später rief mein Sohn an, als ich just das MIFA auf die 5223 schob.
»Sorry, bis zum Howling Wolf ist es doch ein bisschen weiter, als wir dachten.«
»Ein bisschen?«
»Naja, ziemlich viel sogar. Außerdem ist die Straße unbeschreiblich, viel schlimmer als die andere. Wir haben eine Radkappe verloren.«
Ich hörte meine Frau in dringlichem Tonfall etwas sagen.
»Ach ja, die Dame hier meinte, wie sollten uns vor Bären in Acht nehmen. Also im Ernst, nicht im Scherz. ›Böse Bären‹, sagte sie. Und da sind noch ein paar … kchchchchggghhh … mmk.« Ein finales Piepsen, dann Stille. Ich schaute aufs Display: Zum ersten und einzigen Mal in Finnland hatte ich kein Netz.