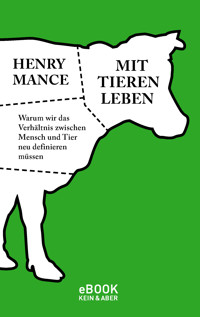
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wir verwöhnen unsere Haustiere, und abends grillen wir Rindersteaks. Wir sehen uns Naturdokumentationen an und wissen gleichzeitig, dass die meisten Nutztiere ein elendes Leben führen, bis sie auf unseren Tellern landen.
Henry Mance zeigt uns, wie wir diese Widersprüche auflösen und einen respektvolleren Umgang mit allen Arten dieses Planeten etablieren können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
HENRY MANCE ist preisgekrönter Journalist bei der Financial Times, wo er auf lange Reportagen spezialisiert ist und eine wöchentliche satirische Kolumne schreibt. Bei den British Press Awards 2017 wurde er zum »Interviewer des Jahres« gekürt. Mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern lebt er in London.
ÜBER DAS BUCH
Wir verwöhnen unsere Haustiere, und abends grillen wir Rindersteaks. Wir sehen uns Naturdokumentationen an und wissen gleichzeitig, dass die meisten Nutztiere ein elendes Leben führen, bis sie auf unseren Tellern landen.
Henry Mance zeigt uns, wie wir diese Widersprüche auflösen und einen respektvolleren Umgang mit allen Arten dieses Planeten etablieren können.
Für Eliza, die sich früher für einen »Very-tarier« hielt, und Cleo, die manchmal glaubt, sie sei ein Tiger.
Vorwort
Liebe ist die äußerst heikle Erkenntnis, dass etwas anderes als man selbst real ist. Liebe … ist die Entdeckung der Wirklichkeit.
Iris Murdoch
Um in dieser Welt den Anschein gezielten Handelns aufrecht zu erhalten, muss man daran glauben, dass etwas falsch oder richtig ist.
Joan Didion
Ich sah, wie die besten Köpfe meiner Generation von Katzenvideos zerstört wurden. Katzen, die über gebohnerte Fußböden schlittern, in Kartons springen oder den Abstand zum Dach des Nachbarhauses falsch einschätzen. Es waren die goldenen Jahre des Internets, bevor die Impfgegner und Anti-Anti-Faschisten aufgetreten sind und alles verdorben haben.
Diese Videos sagen etwas über uns aus. Wir halten uns für Tierfreunde. Wir verschlingen Naturdokumentationen und herzerwärmende Geschichten über die erstaunlichen Fähigkeiten von Tieren. Wir erwärmen uns für Politiker, die mit Tieren posieren – ihre Haustiere würden vermutlich eher wiedergewählt werden als sie selbst.
Doch unsere Tierliebe kommt mit Selbstzweifeln daher. Wir wissen, dass sich unsere Gesellschaft in eine andere Richtung bewegt hat. Wenn man uns drängt, werden wir zugeben, dass die meisten Nutztiere wahrscheinlich kein gutes Leben haben, und dass viele Wildtiere ihren Lebensraum verlieren. Wir würden es zwar lieber sehen, wenn die Situation eine andere wäre, doch das ist der Preis, den wir für unseren Wohlstand zahlen.
Also denken wir nicht viel über Tiere nach. Obwohl sie das Material für die meisten unserer Nahrungsmittel und Kleidungsstücke liefern, obwohl sie zum Aufstieg und Fall menschlicher Gesellschaften beigetragen haben, und obwohl sie wahrscheinlich noch immer hier sein werden, wenn wir verschwunden sind, machen wir uns kaum Gedanken über ihre Existenz.
Unser Planet scheint den Menschen zu gehören. Da ich in der Stadt lebe, wie ein Großteil der Weltbevölkerung es heute tut, kann ein ganzer Tag vergehen, an dem ich kaum ein Tier sehe. Ich gehe an einigen Tauben vorbei, verscheuche eine Fruchtfliege und hebe meine Katze Crumble behutsam von der Ecke der Zeitschrift, die ich gerade lesen will – und dann mache ich so weiter wie bisher. Tiere tauchen in klischeehaften Darstellungen und witzigen Logos auf, aber nicht als fühlende Wesen, die auf diesem Planeten in der Mehrzahl sind. Wir sind eine Gattung unter etwa 500 Primaten, 6400 Säugetieren und grob geschätzt etwa sieben bis acht Millionen Tieren. Wie häufig wird uns das bewusst?
Wenn wir uns mit Tieren befassen, teilen wir sie in Arten und Gruppen auf: Kühe, Hunde, Füchse, Elefanten und so weiter. Und wir weisen ihnen einen Platz in unserer Gesellschaft zu: Kühe gehören auf den Teller, Hunde aufs Sofa, Füchse in die Mülltonne, Elefanten in den Zoo, und Millionen wilder Tiere bleiben irgendwo da draußen, bis sie hoffentlich in einer der nächsten Dokumentationen von David Attenborough auftreten werden. Diese Fähigkeit zur Kategorisierung hat sich als außerordentlich nützlich erwiesen: Sie hat es uns ermöglicht, uns mit Nahrung zu versorgen, Gefährten zur Unterhaltung zu finden und uns vor gefährlichen Tieren zu schützen. Sie hat verhindert, dass wir jedes Mal eine philosophische Debatte führen müssen, wenn wir ein Sandwich essen wollen. Sie hat uns davor bewahrt, uns schuldig zu fühlen, nur weil wir existieren.
Doch diese Kategorien sind instabil. Tatsächlich sind sie gerade dabei, sich aufzulösen. Fast täglich werden wir mit neuen Erkenntnissen über unsere Mitgeschöpfe konfrontiert. Von Tieren, die wir als Nahrungsmittel betrachten – vor allem Schweine und Kühe –, weiß man mittlerweile, dass sie mental und sozial komplexe Wesen sind. Tiere, die wir lange für entbehrlich gehalten haben – wie Wölfe und Biber –, haben sich als unverzichtbar für unsere Umwelt erwiesen. Tiere, die wir besonders schätzen – wie Jaguare und Orang-Utans –, sind durch den menschlichen Fortschritt heimatlos geworden.
Derartige Kategorien sagen mehr über uns selbst aus als über die Tiere. Je mehr wir die Tiere um ihrer selbst willen lieben, desto brüchiger werden unsere Kategorien. In der westlichen Welt sind wir größtenteils überzeugt, dass es falsch ist, wenn manche Japaner Wale, manche Südkoreaner Hunde und manche Kambodschaner Ratten essen. Aber versuchen Sie mal zu erklären, warum es in Ordnung ist, Schweine und Kühe zu verspeisen anstatt Wale und Hunde, und Sie verirren sich in einem philosophischen Kaninchenbau – wie der Auftragskiller in Quentin Tarantinos Pulp Fiction, der argumentiert, ein Hund könne kein schmutziges Tier sein, da er »Persönlichkeit« besitze. Schweine haben auch Persönlichkeit. Warum ist es dann in Ordnung, 1,5 Milliarden Schweine im Jahr umzubringen, aber ein Frevel, einen Hund zu schlachten? Warum ist es in Ordnung, Schweine in kahlen Gehegen zu halten, nicht aber Hunde? Warum ist es moralisch falsch, ein Dutzend Wale zu jagen, nicht aber, Fischernetze zu verwenden, in denen sich hunderte Delfine verfangen?
Einfach gesagt: Weil die Tierliebe einer der Grundwerte der westlichen Gesellschaft ist, und das rationale Denken ein anderer. Doch unsere Behandlung von Tieren entspricht keinem dieser Werte; sie ist von Tradition und Trägheit geprägt. Niemand würde das drohende Massenaussterben wilder Tiere gutheißen, schon gar nicht die Tiere selbst. Wie sollen wir der nächsten Generation erklären, was direkt vor unseren Augen geschieht? Charles Darwin befand, dass schamhaftes Erröten die menschlichste aller Ausdrucksformen sei – was passend ist, denn wir haben genug Grund zum Erröten.
Bevor das Coronavirus uns befallen hat, haben Optimisten gesagt, dass wir in der besten Zeit leben, die es für den Menschen jemals gab – wenn man sich eine Zeit aussuchen könnte, in der man leben möchte, dann sollte es jetzt sein. Aber würden sich andere Lebewesen auch so entscheiden? Würden Sie heute als ein nichtmenschliches Säugetier geboren, wäre es sehr wahrscheinlich, dass Sie sich in einem Massentierhaltungsbetrieb wiederfinden würden, in einer beengten, unnatürlichen Umgebung. In einem großen Molkereibetrieb produziert eine Kuh vielleicht vier mal so viel Milch wie vor einem Jahrhundert, doch ihre Lebenserwartung ist deutlich gesunken. Als Wildtier wären Sie weit größerer Gefahr ausgesetzt als noch vor einigen Generationen, dass Ihr Lebensraum zerstört wird oder sich das Klima so sehr verändert, dass Sie sich nicht mehr anpassen können. Seit den 1970er-Jahren haben sich die Wildtierpopulationen im Durchschnitt um zwei Drittel verringert, wie der Living Planet Index (LPI) belegt. Und weil der Tierhandel vor allem in Asien stark zugenommen hat, bestünde außerdem die Gefahr, dass Sie in Gefangenschaft geraten und unter grausamen Bedingungen gehalten werden würden. Wir stellen uns vielleicht vor, wie ein Hund im heutigen Amerika zu leben, auf dem Sofa herumzulungern, Biokekse zu futtern und einen drolligen Instagram-Account zu haben, falls wir zufällig reinkarniert werden sollten, doch es ist mindestens zwanzig Mal wahrscheinlicher, dass wir als Hühner in einer Legebatterie enden. Wenn ein Tier sich eine Zeit aussuchen könnte, in der es leben wollte, würde es sich dann für heute entscheiden? Ich glaube kaum.
Was würde geschehen, wenn wir über Tiere nachdächten – über alle Tiere? Würde sich unsere Nahrungsversorgung, unser Umgang mit der Umwelt und unser Blick auf Tiere im Zoo verändern?
Wie viele andere Leute verliebte ich mich in Tiere, weil ich sie wunderbar fand. Meine Familie besaß einen Hund, und meine Eltern nahmen mich mit in den Zoo. Wir sahen uns das Grand-National-Pferderennen im Fernsehen an, und ich war verblüfft, dass Pferde ohne Reiter disqualifiziert wurden; war es nicht bemerkenswert, dass sie schneller liefen, wenn der Jockey heruntergefallen war? Auf der Universität war ich für eine kurze Zeit Vegetarier, aus Umweltschutzgründen, bis ich eines Tages in einem Drop-down-Menü die falsche Option auswählte und infolgedessen auf einem Langstreckenflug nur ein paar rohe Karotten zum Abendessen serviert bekam. In meinen Zwanzigern entdeckte ich die Fotografie. Ich war besessen davon, eine Hummel im Flug, einen Grashüpfer aus nächster Nähe und andere wundersame Tiere festzuhalten. Ganz im Geiste von George Best gab ich 90 Prozent meines Geldes für Kameralinsen aus, den Rest verplemperte ich einfach.
Tiere zu fotografieren lohnt sich besonders. Ein halbes Dutzend glänzender silberner Fische, die auf einem Dock liegen. Ein Orang-Utan auf Borneo, der lässig von Ast zu Ast schwingt. Ein junges Nilpferd auf einer Farm in Kolumbien, die früher dem Drogenbaron Pablo Escobar gehörte, der im Gegensatz zu mir rohe Karotten als Nahrung für die Seele ansah. Je genauer man unsere Mitgeschöpfe betrachtet, desto erstaunlicher erscheinen sie einem. Auf einem Fotoausflug stand ich einmal an Deck eines Boots und beobachtete die Papageientaucher, die sich gegen den Nordseewind stemmten, um zu ihren Nistplätzen zurückzugelangen, als ich hörte, wie ein kleiner Junge seinen Eltern mit ernster Miene zuflüsterte: »Ich liebe die Papageientaucher.« Ich liebe die Papageientaucher auch, dachte ich. Doch was hatte ich eigentlich für sie getan, außer Fotos zu machen? Hatte meine Bewunderung einen Nutzen für sie? Hatte ich ihnen irgendetwas zurückgegeben für das Vergnügen, das sie mir bereiteten? Ich war ein Tierfreund in der Theorie, aber vermutlich nicht in der Praxis.
Heutzutage gehen wir mit dem Wort Liebe sehr großzügig um, wir lieben alles mögliche, von unseren Eltern bis zu den neuen Tischsets. Iris Murdoch war der Auffassung, Liebe sei ein Leitbegriff der Moralphilosophie, eine Kraft, die uns unsere Ichbezogenheit überwinden lässt. Für sie beruhte Liebe vor allem auf der Fähigkeit, anderen unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Denn wenn wir das Wohlergehen anderer bedenken, werden wir uns ihnen gegenüber richtig verhalten. Obgleich Murdoch dabei an die Liebe zwischen Menschen dachte, lässt sich ihr Gedanke problemlos auf unseren Umgang mit anderen Lebewesen übertragen. Wir sind aufgefordert, Liebe nicht als etwas anzusehen, das wir bekennen, sondern das wir praktizieren, indem wir die Einzigartigkeit anderer Lebewesen achten und über unsere eigene Voreingenommenheit nachdenken.
Ich beschloss, mich selbst auf die Probe zu stellen. Ich wollte herausfinden, ob meine Tierliebe sich auch in meinem Verhalten niederschlug, oder ob sie eher theoretisch war – wie meine Vorliebe für Arthouse-Filme. Über die Wunder und die Schönheit der Tierwelt zu staunen, während man sich Naturdokumentationen ansieht, ist ja ganz nett, doch ich wollte etwas tun. Ich wollte ergründen, welchen Platz sie in unserer Welt einnehmen. Ich wollte mich mit der Realität von Bauern- und Schlachthöfen, Zoos und Tierhandlungen, Ozeanen und Wäldern konfrontieren. Verhielt ich mich Tieren gegenüber fair? Wenn nicht, konnte ich mich ändern? Das würde mein »Animal Test« sein. Diese Erfahrung sollte mich aus meiner Blase herausholen, und sie hat meine Lebensweise auf vielfältige Weise verändert. Ich glaube, das kann uns allen gelingen.
Doch zunächst müssen wir uns die Frage stellen, warum wir Tiere überhaupt fair behandeln sollten?
Es gibt ein berühmtes psychologisches Experiment, bei dem Kinder je einen Marshmallow vorgesetzt bekommen und anschließend allein in einem Raum bleiben. Zuvor hat man ihnen gesagt, wenn sie warteten und den Marshmallow nicht gleich aufäßen, bekämen sie einen weiteren. Im Durchschnitt halten Vorschulkinder weniger als zehn Minuten durch, bevor sie den Marshmallow essen. Das Experiment veranschaulicht eine grundlegende menschliche Erfahrung – unseren ständigen Kampf, unsere Begierden im Zaum zu halten und Pläne für die Zukunft zu machen.
Aber wie typisch menschlich ist das eigentlich? Bei einem vergleichbaren Test mit Schimpansen zeigte man ihnen die Belohnungen, die sie erhalten würden, wenn sie geduldig warteten. Die Schimpansen schnitten dabei ungefähr so gut ab wie die Kinder – manche widerstanden der Versuchung sogar zwanzig Minuten lang. Sie verwendeten sogar dieselbe Taktik wie die Kinder und lenkten sich mit Spielsachen ab, um die Süßigkeit nicht zu essen. Ein afrikanischer Graupapagei, dem man bedeutete, auf eine schmackhaftere Nuss zu warten, konnte sich fünfzehn Minuten lang beherrschen. Derartige Experimente legen nahe, dass zumindest einige Tiere einen Begriff von Zukunft haben – sie können verschiedene Optionen abwägen und das ausüben, was wir bei Menschen gern als freien Willen bezeichnen.
Über die Jahrhunderte haben Denker von Aristoteles bis Karl Marx versucht herauszufinden, zu welchen Dingen nur der Mensch in der Lage ist. Einst waren wir die einzige Gattung, die Werkzeuge herstellen kann. Dann beobachtete Jane Goodall, wie ein wildlebender Schimpanse ein Stöckchen nahm, um damit Termiten aus einem Bau zu angeln. Heute wissen wir, dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Vorkommnis handelte: Eine Theorie besagt sogar, dass Kobras das Spucken erlernten, um sich gegen Werkzeug schwingende Primaten zu verteidigen. Andere Tiere verwenden nicht nur Werkzeuge, sie stellen sie auch her. In neueren Experimenten bastelten Krähen aus Neukaledonien Werkzeuge aus verschiedenen Einzelteilen zusammen, um an Futter in einer Kiste zu gelangen. Es scheint ihnen Spaß zu machen, mit Werkzeug zu hantieren.
Andere Tiere erfassen auch abstrakte Konzepte. Keas, große Papageien, die in Neuseeland leben, besitzen einen Instinkt für statistische Wahrscheinlichkeiten. Die Forscher zeigten ihnen zwei Gläser mit jeweils unterschiedlichen Anteilen schwarzer und oranger Stäbchen, von denen sie die schwarzen wie eine Währung gegen Leckereien eintauschen konnten. Wenn der Forscher nun aus beiden Gläsern ein Stäbchen zog, ohne dass sie es sehen konnten, wählten die Keas immer die Hand, die in das Gefäß gegriffen hatte, in der mehr schwarze als orange Stäbchen enthalten waren.
Vogelgehirne sind zwar klein, doch deutlich leistungsstärker, als die Menschen einst angenommen haben. Einige Papageien und Schimpansen sind dazu in der Lage, Wörter zu benutzen: Nachdem man ihm die Wörter »grün« und »Banane« beigebracht hatte, verwendete ein Schimpanse den Ausdruck »grüne Banane«, um eine Gurke zu bezeichnen. Präriehunde haben unterschiedliche Warnrufe für Kojoten, Hunde, Menschen und Rotschwanzbussarde. Und wenn man ihnen ein Objekt zeigt, das sie noch nie zuvor gesehen haben, verwenden sie unabhängig voneinander immer denselben Ruflaut, um es zu beschreiben. Komplexe Kommunikation findet sich nicht nur bei Säugetieren. Hummeln können sich gegenseitig mitteilen, wo eine Nektarquelle zu finden ist – in Form eines Tanzes, der sich an der Position der Sonne orientiert. Sie können sich mehrere Tage lang unterschiedliche Orte merken. Forscher haben sich sogar eine Form von »Bienenfußball« ausgedacht: In einem Experiment erhalten die Bienen Zuckerwasser, nachdem sie einen Ball in ein Loch befördert haben. Eine Biene, die noch nie mit einer derartigen Aufgabe konfrontiert war, findet dennoch den kürzesten Weg, um das Tor zu machen. In natürlicher Umgebung konnte sie keine derartige Erfahrung machen. Dennoch »scheint sie das gewünschte Ziel zu erfassen und nicht nur das Verhalten anderer Bienen nachzuahmen«, sagt der Psychologieprofessor Lars Chittka von der Queen Mary University of London. Spinnen benutzen alle ihre acht Beine, um ein Netz zu spinnen, und wenn sie eines ihrer Beine verlieren, was häufig vorkommt, sind sie immer noch in der Lage, ein gleichartiges Netz zu spinnen. Eine Interpretation besagt, dass sie eine Vorstellung davon haben, was sie konstruieren wollen, und ihr Verhalten den Umständen anpassen. Ihre Gehirne mögen klein sein, aber sie sind außerordentlich effizient in der Nutzung ihrer Kapazitäten.
Wir können mittlerweile mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass einige Tiere sich selbst in einem Spiegel erkennen, ein Zeichen dafür, dass sie ihre eigene Existenz begreifen, und eine Voraussetzung dafür, die Emotionen ihrer Mitgeschöpfe zu verstehen. Tiere können nützliches Verhalten erlernen und weitergeben: Als in Großbritannien Milchflaschen mit Verschlüssen aus Aluminiumfolie eingeführt wurden, fanden Blau- und Kohlmeisen bald heraus, wie man sie aufpickt, und diese Technik verbreitete sich im ganzen Land. Aufgrund anderer Umweltbedingungen oder einfach aus Experimentierfreude kommt es vor, dass eine Gruppe von Walen oder Elefanten eigene Praktiken entwickelt, die sie von anderen Gruppen unterscheiden – so wie sich menschliche Gesellschaften voneinander unterscheiden.
Tiere sind also intelligent, aber was können sie fühlen? Wir können nicht in den Kopf eines Gorillas schauen, ebenso wenig wie in den Kopf eines anderen Menschen. Wir können ihn nicht fragen, was er empfindet. Aber wir können das Verhalten von Tieren beobachten und ihre Körper studieren, ohne von vornherein davon auszugehen, dass ihre Fähigkeiten beschränkt sind. Außerdem können wir versuchen, eine Erklärung für ihr Verhalten zu finden, beispielsweise indem wir Tests verwenden, bei denen die Tiere eine Wahl treffen müssen, um etwas über ihre Vorlieben herauszufinden. Der Mensch fühlt Schmerzen, weil er darauf spezialisierte Nervenenden, ein Zentralnervensystem und den Neocortex hat. Andere Säugetiere verfügen über ähnliche Strukturen. Vögel haben eine Hirnregion, die dieselben Funktionen auszuüben scheint. Darüber hinaus sind viele Tiere dazu in der Lage, ein Vermeidungsverhalten auszubilden, wenn sie einem schmerzhaften Stimulus ausgesetzt werden – oder sie sind bereit, einen Preis dafür zu zahlen, um den Schmerz zu lindern, so wie wir uns in die nächste Apotheke schleppen, wenn wir schlimmes Kopfweh haben.
Wenn Afrikanische Elefanten sich nach einer längeren Zeit wiedertreffen, passen sie ihre Begrüßung daran an, wen sie begrüßen und wie gut sie denjenigen kennen. »Selbst streng wissenschaftlich betrachtet, kann keinerlei Zweifel daran bestehen, dass die Elefanten Freude empfinden, wenn sie sich wiedersehen«, schreibt Cynthia Moss, eine der Pionierinnen in der Verhaltensforschung zu Elefanten. »Sie ist vielleicht nicht mit menschlicher Freude vergleichbar, aber es ist Elefantenfreude, und sie spielt eine bedeutende Rolle in ihrem sozialen System.«
Noch 1987 konnte man im Oxford Companion to Animal Behaviour lesen, dass Tiere »nur ein begrenztes Spektrum an Grundemotionen« vorweisen: Angst, Freude, eventuell auch Wut. Auch an meiner Universität gab es Vertreter dieser Meinung. Wenn man Trauer allerdings dadurch definiert, dass man sich nach dem Ableben eines Verwandten anders als vorher verhält, dann sind Afrikanische Elefanten fähig zu trauern. Wale ebenso. 2018 starb ein Orca-Kalb vor der Küste von British Columbia, und seine Mutter tauchte mehrmals in die Tiefe, um es wieder heraufzuholen. Ihr muss klar gewesen sein, dass das Kalb tot war, dennoch behielt sie es über siebzehn Tage und 1000 Seemeilen bei sich. Andere Orcas und Delfine haben ihre toten Kälber noch eine Woche lang bei sich behalten. Wir wissen zwar nicht, wie weit verbreitet dieses Verhalten in der Tierwelt ist, doch der Mutterinstinkt beschränkt sich nicht auf Säugetiere – auch manche Schlangen beschützen ihre Jungen.
Fairness scheint eine der komplexen Strategien zu sein, die nur unter Menschen vorkommt. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass einige Primaten und Hunde ebenfalls eine Vorstellung von Fairness haben – beim Teilen von Futter beispielsweise. Es könnte tatsächlich sein, dass wir nicht die einzige Spezies sind, die sich willentlich altruistisch gegenüber den Vertretern anderer Arten verhält: Die Wissenschaftlerin Joyce Poole hat dokumentiert, wie eine Elefantin neben einem Hirten mit einem gebrochenen Bein Wache stand. (Man muss fairerweise hinzufügen, dass die Elefantin für das gebrochene Bein verantwortlich war, wenn auch unabsichtlich.)
Haben Tiere Stimmungsschwankungen? Menschen reagieren anders auf uneindeutige Stimulationen, wenn sie vorher einen positiven Anreiz erfahren haben – deshalb kaufen Leute Lotterielose, wenn sie gerade guter Laune sind. Schweine sind optimistischer gestimmt und erkunden neue Objekte mit mehr Eifer, wenn sie gut untergebracht sind und reichlich Platz und Stroh haben. Auch Bienen können sich optimistisch verhalten.
Sind Tiere Individuen? Jeder Haustierbesitzer kennt die Antwort. Eines meiner Lieblingsbeispiele stammt von dem chinesischen Künstler Ai Weiwei, der in Peking mit über vierzig Katzen lebt: »Eine von ihnen weiß, wie man Türen öffnet … wäre ich dieser Katze nicht begegnet, wüsste ich nicht, dass Katzen Türen öffnen können.«
Ich habe mit verschiedenen Katzen zusammengelebt, von denen nur eine Freude daran hatte, Fangen mit Papierschnipseln zu spielen, die ich im Zimmer herumwarf. Zweifellos sind sie alle Individuen gewesen.
In der Humanpsychologie setzt sich die Persönlichkeit eines Menschen aus Verhaltensmustern zusammen, die über einen längeren Zeitraum stabil bleiben und die sich vom Durchschnitt der Bevölkerung unterscheiden. Vor einigen Jahrzehnten ist Wissenschaftlern bei der Beobachtung von Kohlmeisen in den Niederlanden und wilden Dickhornschafen in Kanada aufgefallen, dass einige Individuen entsprechende Verhaltensmuster aufwiesen – sie waren beispielsweise besonders wagemutig oder angriffslustig. Schon das Wort »Persönlichkeit« scheint sich speziell auf den Menschen zu beziehen. Einige Forscher fühlen sich so unwohl bei der Vorstellung, dass Tiere Persönlichkeit haben könnten, dass sie absurde sprachliche Umwege eingehen und von »Verhaltenssyndromen« sprechen. Doch die Evolution arbeitet mit individuellen Variationen.
»Wir glauben, der Mensch sei etwas Besonderes. Wenn man sich die biologischen Voraussetzungen von Verhalten anschaut, unterscheiden sich die grundlegenden Systeme von Säugetieren und Fischen nur wenig«, sagt der Verhaltensbiologe Niels Dingemanse von der Ludwig-Maximilian-Universität München und einer der Pioniere der Tierpersönlichkeitsforschung. »Wenn wir beobachten, dass Fische exakt dieselbe Stressreaktion wie Menschen haben, finden wir das erstaunlich. Es ist nicht erstaunlich. Wenn es eine optimale Form der Entwicklung gibt, warum sollte diese sich nicht bei verschiedenen Spezies ausbilden?«
Um den Graben zwischen uns und anderen Lebewesen zu überbrücken, müssen wir vor allem begreifen, dass wir nicht so schlau sind, wie wir denken. In einer klassischen Studie aus dem Jahr 1977 wurden Kunden befragt, welche von vier Nylonstrumpfhosen die beste Qualität habe. Obgleich alle vier Paare identisch waren, sagten die meisten Kunden, die Strumpfhosen, die ganz rechts lagen, hätten die beste Qualität. Auf die Frage, warum dies so sei, antworteten sie mit einer Beschreibung der Verarbeitung, keiner von ihnen erwähnte die Position. Wir Menschen machen uns oft etwas vor, was unsere eigenen Instinkte angeht.
Vielen von uns fällt es instinktiv nicht schwer, Ähnlichkeiten zwischen Menschen und anderen Säugetieren in Bezug auf Intelligenz, Emotionen und soziale Beziehungen zu akzeptieren. Schwieriger wird es bei Fischen, Vögeln und Insekten, weil sie sich im Aussehen so stark von uns unterscheiden. Dennoch gibt es Eigenschaften und Fähigkeiten, die weiter in die Evolutionsgeschichte zurückreichen, als wir bislang angenommen haben. 2016 haben der Neurologe Todd Feinberg und der Evolutionsbiologe Jon Mallatt die These aufgestellt, dass nicht nur Menschen einen Erfahrungsbegriff haben, und nicht einmal nur Säugetiere und Vögel, sondern jedes Tier mit einer Wirbelsäule. Das Bewusstsein, argumentieren sie, existiert bereits seit mindestens 520 Millionen Jahren, lange bevor es Wälder und Säugetiere gab. Es entstand im Kambrium, als die ersten fischartigen Wirbeltiere in den Ozeanen schwammen.
Das Bewusstsein ist ein nur schwer greifbares Konzept; es näher zu definieren, ähnelt einem Puzzle, bei dem die einzelnen Teile verdeckt auf dem Tisch liegen. Es genügt zu sagen, dass das Bewusstsein die Fähigkeit beinhaltet, Informationen zusammenzubringen, die die verschiedenen Sinnesorgane liefern, und diese Informationen über die Welt und die momentane Situation, in der sich das Tier befindet, zu verarbeiten. Feinberg und Mallatt stellten anhand von Fossilienfunden fest, dass die ersten Wirbeltiere hochauflösende Facettenaugen hatten, deren Bilder anschließend im Gehirn verarbeitet wurden. Sie konnten sich also ein Bild von der Welt machen. Der Auslöser für diese Entwicklung scheint das Auftreten der ersten Raubtiere auf dem Grund der Ozeane gewesen zu sein – Würmer, die andere Würmer fraßen; daraus entwickelte sich ein Wettrüsten um die am besten ausgebildeten Sinnesorgane und die schnellste Verarbeitungsgeschwindigkeit. Einige der Wirbellosen – wie Insekten, Krebse und Oktopusse – scheinen unabhängig von den Wirbeltieren ein Bewusstsein entwickelt zu haben. Das bedeutet, dass es offensichtlich möglich ist, die Welt mit den Augen einer Krähe, eines Dorsches oder eines Krebses zu sehen. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte man eine derartige Vorstellung als aberwitzig abgetan.
Es kommt vor, dass Veranstalter Wettkämpfe zwischen einem Olympiaschwimmer und einem Hai oder einem geschickten Leistungssportler und einem Schimpansen organisieren. Natürlich verlieren die menschlichen Teilnehmer dabei immer. Tiere können so vieles besser als wir: Hunde können Krankheiten riechen, sogar das Coronavirus, und Schildkröten können über tausende Meilen zu ihrem Ziel navigieren (auch wenn sie sich unterwegs oft verirren, genauso wie Menschen mit einem GPS-Gerät). Vögel, Fische, Reptilien und Amphibien besitzen Rezeptoren für ultraviolettes Licht. Hummeln sind womöglich in der Lage, Farben zu sehen, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Könnte es nicht auch sein, dass Tiere Erfahrungen machen und Emotionen haben, die uns nicht zugänglich sind? Oder das die Intensität ihrer Eindrücke stärker ist als bei uns?
Die Überlegenheit des Menschen ist mittlerweile nicht mehr unstrittig. Afrikanische Elefanten besitzen deutlich mehr Neuronen als wir; andere Säugetiere haben eine ähnliche Gehirnstruktur. Fische, Vögel und Insekten besitzen weniger Neuronen, sie haben keine Großhirnrinde, doch ihre Gehirne scheinen durchaus in der Lage zu sein, viele vergleichbare Funktionen auszuführen. Heute wissen wir, dass Papageien und Oktopusse Intelligenz entwickelt haben, wir können also Tiere nicht mehr danach beurteilen, wie nahe sie dem Menschen genetisch stehen. Eines Tages, falls oder wenn die Menschen ausgestorben sind, werden andere Spezies – womöglich die Nachkommen der Ratten oder der Krähen – sich zu der dominanten Art entwickeln, die diesen Planeten beherrscht, wie wir es heute tun. Um den US-amerikanischen Naturschützer Aldo Leopold zu zitieren: »Auf der Odyssee der Evolution sind Menschen nur die Mitreisenden anderer Lebewesen.«
Als ich ein Kind war, taten die Erwachsenen die Tierdarstellungen in Disney-Filmen gern als »zu vermenschlichend« ab. Für Wissenschaftler bedeutet »anthropomorphisieren« die Annahme, dass ein Tier, das sich ähnlich wie wir verhält, es auch aufgrund derselben Emotionen tut. Wie alle Mutmaßungen ist auch diese problematisch. Doch Frans de Waal, einer der führenden Primatologen, sagt, es sei weitaus riskanter, nicht zu anthropomorphisieren. Was unsere Fähigkeiten und Emotionen angeht, sei es am sinnvollsten, wenn wir uns in einem Kontinuum mit anderen Tieren sehen würden. Die Tatsache, dass wir nicht genau bestimmen können, welche Emotionen Tiere haben, sagt mehr über die Beschränktheit unserer wissenschaftlichen Methoden aus als über die Grenzen ihrer Erfahrungen.
Dennoch gibt es einige Dinge, die eventuell nur auf den Menschen beschränkt sind. De Waal glaubt, dass (komplexe) Sprache die einzige »spezifisch menschliche« Fähigkeit ist. Der Verhaltensforscher Con Slobodchikoff, der die verschiedenen Warnrufe der Präriehunde identifiziert hat, ist anderer Meinung. Allerdings gibt es keinen Beleg dafür, dass Tiere über etwas kommunizieren, dass sich gestern ereignet hat. Das Wissen um die eigene Sterblichkeit könnte ebenfalls »spezifisch menschlich« sein; und zweifellos übertreffen wir andere Tiere, was Selbstwahrnehmung und Zukunftsplanung angeht. Feinberg und Mallatt verweisen darauf, dass die Form von Bewusstsein, die Vögel, Fische und Insekten besitzen, nicht so ausgeprägt ist wie die des Menschen – daher ist es wahrscheinlich, dass sie nicht über ihre eigenen Gefühle nachdenken können.
Vom moralischen Standpunkt scheint der wesentlichste Unterschied zwischen Menschen und anderen Lebewesen darin zu bestehen, dass wir die Macht haben, über das Schicksal anderer Spezies zu entscheiden. Wir halten die Leben von Milliarden von Tieren in unseren Händen – Säuger, Vögel, Fische, Insekten und so weiter – und das Schicksal von Millionen von Arten. Irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Menschen den Punkt überschritten, an dem sie entscheidenden Einfluss auf die Hälfte der eisfreien Gebiete der Erde genommen haben. Durch den Klimawandel, die Zerstörung natürlicher Lebensräume und die rücksichtslose Ausbeutung von Rohstoffen sind wir heute die dominante Kraft auf dem Planeten Erde. Wissenschaftler bezeichnen diese Epoche als Anthropozän, um sie von den vorhergehenden zu unterscheiden. Konkret bedeutet das, dass unsere Fußabdrücke überall sichtbar sind: Jede andere Spezies reagiert auf unsere Präsenz, unseren Bedarf an Ressourcen, unseren Ausstoß an Schadstoffen, Plastikabfällen und Treibhausgasen. Diese Welt ist vom Menschen geprägt. Mit Macht geht auch Verantwortung einher.
Tiere gut zu behandeln, nützt auch uns. Unser Wasser wäre nicht sauber, unser Kohlenstoff würde nicht aus der Atmosphäre abgebaut, unsere Küsten wären nicht vor Fluten geschützt – ohne die Ökosysteme, in dem andere Lebewesen eine entscheidende Rolle spielen. Viele unserer Nutzpflanzen würden nicht gedeihen, wenn Insekten und Vögel sie nicht bestäuben würden. Charles Darwin fand, keine andere Spezies habe eine »so bedeutende Rolle in der Weltgeschichte gespielt« wie der Regenwurm, der den Ackerbau erst möglich machte. Es kommt einem geradezu albern vor, weiter aufzuzählen, was Tiere für uns getan haben, denn ohne sie hätten wir rein gar nichts. Jeder, der glaubt, der Mensch könne eigenständige Kolonien auf dem Mars errichten, sollte etwas Zeit mit einem Ökologie-Handbuch verbringen – und mit einem Haustierhalter.
Doch unsere Denkweise macht es uns schwer, die Existenz anderer bewusster Lebewesen zu akzeptieren. Als ich Wirtschaftswissenschaften an der Universität studierte, behandelte man die Natur immer noch als Unterpunkt der Ökonomie, und nicht etwa umgekehrt. Außerdem galt es als selbstverständlich, dass das Leben der Tiere keinen eigenständigen Wert hat. Wenn wir bereit sind, dafür zu bezahlen, dass Tiere existieren – weil wir sie gerne mit dem Fernglas beobachten oder weil sie unsere Pflanzen bestäuben –, na schön. Ansonsten stellt ihr Verschwinden keinen wirtschaftlichen Verlust dar. Nicht zum ersten Mal erweist sich die Wirtschaftstheorie als ungenügend. Wenn wir einsehen, dass manche Tiere ein Bewusstsein haben, Schmerz empfinden und soziale Beziehungen unterhalten, müssen wir ebenfalls einsehen, dass ihr Leben wertvoll ist. Jane Goodall reagierte auf den Tod von Flo, einem wildlebenden Schimpansenweibchen, das sie elf Jahre lang kannte, mit den Worten: »Selbst wenn ich nicht da gewesen wäre, um ihre Geschichte aufzuschreiben, und nicht in ihre Privatsphäre eingedrungen wäre, wäre Flos Leben dennoch bedeutsam und wertvoll gewesen, sinnerfüllt, voller Energie und Lebensfreude.«
Es gibt andere Bücher, die davon handeln, was Tiere für uns tun können. Dieses Buch handelt davon, was wir für die Tiere tun können. Und davon, wie wir ihre Welterfahrung berücksichtigen können, während wir unsere eigene Gesellschaft unablässig weiterentwickeln.
Wir schütteln oft den Kopf und stellen fest, dass die Beziehung des Menschen zu anderen Lebewesen verwirrend und problematisch ist. Das ist eine Ausrede. Ob Tiere nun einen Sinn für Fairness haben oder nicht, wir haben ihn ganz sicher, und wir haben die Möglichkeit, danach zu handeln. Wenn wir andere Lebewesen zu schätzen wissen – im Urlaub, auf Geburtstagskarten und in Naturdokumentationen –, können wir nicht ignorieren, dass sie in Massentierhaltung gehalten werden oder vom Aussterben bedroht sind.
Für mich hat sich alles verändert, als meine Töchter geboren wurden. Schon bald waren sie von Stofftieren umzingelt. Da gab es einen Hasen mit überlangen Schlappohren, einen gehäkelten Panda, dick genug, um als Türstopper zu fungieren, eine Eule, die Töne von sich gab, wenn man ihr in den Nacken blies, einen Tukan in völlig falschen Farben, eine Giraffe mit langen Gummibeinen, an denen man nuckeln konnte, einen Plastik-Oktopus ohne Arme, mit dessen Kopf man Badewasser schöpfen konnte, und vieles mehr. Noahs Arche, made in China. Jede Familie kennt das. Unsere Spielsachen hatten sich nach und nach angesammelt, als Geschenke, Leihgaben und Erbstücke. Natürliche Hierarchien waren aufgehoben: der Marienkäfer war so groß wie der Löwe, die Kuh ebenso exotisch wie das Zebra. Eliza und Cleo kümmerte das nicht. Für sie waren all diese Tiere harmlos und unversehrt, sie waren Spielgefährten der Menschen. Ich fühlte mich unbehaglich.
Rudyard Kipling, Beatrix Potter und Walt Disney haben dafür gesorgt, dass Kinder seit Jahrzehnten romantisierenden Vorstellungen von Tieren ausgesetzt sind. Ich versichere Ihnen, dass ich nicht einer dieser Pedanten bin, die darauf beharren, dass Peter Rabbit niemals ein Jackett tragen würde, dass Peppa Wutz einen ganzen Ferkelwurf an Geschwistern hätte, und der Tiger, käme er tatsächlich zum Tee, zuerst das kleine Mädchen verschlingen würde. Natürlich sind Bilderbücher irreführend: Die meisten Bauernhöfe sind keine kleinen, idyllischen Orte, und Wölfe und Oktopusse sind nicht unheimlich. Diese Dinge haben mich nie gestört.
Was mich störte, war das Gesamtbild. In Kindergeschichten sind Menschen und Tiere austauschbar: Micky Maus, Winnie Pu, der Bär Paddington, Peppa Wutz – sie alle sind Tiere mit genauso viel Persönlichkeit und moralischem Wert wie jeder Mensch. Ein Kind würde aus all diesen Büchern, Videos und Spielzeugen schließen, dass Menschen Tiere verstünden. Das Kind denkt: Bestimmt haben die Erwachsenen längst herausbekommen, wie man mit anderen Tieren zusammenlebt, und werden es mir bald beibringen. Bestimmt würden die Erwachsenen mir keine Gummigiraffen schenken, ohne dafür zu sorgen, dass die echten Giraffen nicht aussterben. Wäre es nur so. In den Büchern von Eliza und Cleo bin ich schon einigen Wieseln begegnet, aber ich glaube nicht, dass ich jemals ein echtes Wiesel gesehen habe. Ich begann mich zu fragen, wie ich meinen Kindern unser Verhältnis zu Tieren erklären würde, und mir wurde klar, dass ich es lieber sein lassen sollte.
Zunächst einmal haben die Menschen rekordverdächtig viele Großtiere ausgerottet, indem sie sie jagten. Als unsere Spezies Australien besiedelte, begannen andere Säugetiere zu verschwinden – beispielsweise acht Meter lange Eidechsen und 300 Kilo schwere Kängurus. Elefanten, Giraffen und Nashörner stellen für uns den Inbegriff der Wildtierwelt dar. Doch wenn wir uns an der bisherigen Entwicklung orientieren, könnten diese Tiere und andere von der gleichen Größe in zwei Jahrhunderten ausgestorben sein, wodurch die Kühe zu den größten Landlebewesen avancieren würden. In 45 Millionen Jahren ist es nicht vorgekommen, dass die größten Lebewesen so klein waren. Ich betrachtete den Spielzeugtiger meiner Töchter und wunderte mich. Ich fürchtete mich vor dem Tag, an dem sie mich fragen würden, warum Tiere eigentlich aussterben. Noch vor wenigen Generationen hätte man unser Verhältnis zu Tieren als hierarchisch und überlegen bezeichnet. Heute ist es von Schuld geprägt.
Was Tiere betrifft, sagen einem die Elternratgeber zwar, wie man dafür sorgt, dass die Kinder einen gefahrlosen Umgang mit ihnen haben, aber das ist auch schon alles. Verständlicherweise geht es in den Ratgebern um andere Dinge, beispielsweise darum, wie man mit vier Stunden Schlaf auskommt, ohne den Verstand zu verlieren. In Büchern über die Tierwelt kann man jedoch einiges über Elternschaft lernen. Sie vermitteln einem, wie prägend die ersten Eindrücke sind. Lachse kehren zu dem Fluss zurück, in dem sie gezeugt wurden. Albatrosse brüten ebenfalls an ihrem Geburtsort. In Utopia (1516) bemerkt Thomas Morus, dass gerade geschlüpfte Küken denjenigen, der sie füttert, »als Mutter« ansehen. Spätere Forschung hat gezeigt, dass viele Vögel sich emotional an das erste bewegliche Objekt binden, das sie wahrnehmen. Wenn ein Entenküken einen Mensch sieht, läuft es ihm nach und folgt nicht länger seiner Entenmutter. Und inwieweit sich Hunde für Menschen erwärmen können, entscheidet sich in den ersten Wochen. Diese ersten Erfahrungen finden in einer Phase statt, in der die Barriere zwischen den Arten noch am leichtesten überwunden werden kann.
Beim Menschen ist es anders, doch auch wir bestimmen, was für die nächste Generation als normal gilt. Wie nie zuvor sind wir gezwungen, unsere Welt zu erklären. »Sind Eulen echt oder nur erfunden?«, fragte Eliza mich eines Tages. »Warum bekamen die Dinosaurier keine Babys mehr?«, kam wenige Tage später. »Warum leben so viele Tiere im Zoo?«, fragte Cleo. Ich versuchte sie mit einem Foto abzulenken, auf dem ein Adler in einen See herabstößt. »Ist der Fisch traurig, wenn der Adler ihn auffrisst?«, fragte Eliza. Kinder aufzuziehen, kann eine Zeit der Erneuerung sein – eine Zeit, in der man sich fragt, wer wir auf diesem Planeten sein wollen. Oder eine Zeit der Trägheit – in der wir uns zwar Sorgen über den Rückgang der Bienen- und anderer Insektenpopulationen machen, aber dennoch den Rasen mähen, um eine saubere Spielecke für unsere kleinen Menschen zu schaffen.
Allen Eltern fällt auf, dass Kinder die Tierwelt erkunden wollen. Krabbelkinder interessieren sich mehr für lebendige Tiere als für Spielsachen. Die Namen der Tiere gehören zu den ersten Wörtern, die unsere Babys lernen, die Laute, die sie machen, zu den ersten Tönen. Mittlerweile gilt es als Teil ihrer moralischen Erziehung, Kinder mit Tieren zusammenzubringen. Ich würde zwar nicht unbedingt sagen, dass ich meinen Töchtern etwas über Tiere beibringe, um sie vor einer kriminellen Karriere zu bewahren, aber es kann sicherlich nicht schaden. Nur, was soll ich ihnen beibringen?
Wir sind uns weitgehend einig, dass einige Dinge nicht für Tierliebe stehen: Stierkämpfe, Hunde zu schlagen oder Bären in winzigen Käfigen zu halten, um ihnen zu dubiosen medizinischen Zwecken Gallenflüssigkeit zu entnehmen. All das ist schändlich, und in vielen Ländern gibt es keine Gesetze dagegen. Und selbst wenn es ein Gesetz gibt, stehen die Tiere, die keine Stimme haben, nicht unbedingt weit oben auf der Prioritätenliste der Gesetzeshüter. Doch dabei handelt es sich nicht um Gewissensfragen, und wenn Sie dieses Buch lesen, sind Sie vermutlich bereits davon überzeugt, dass es keine gute Idee ist, Kosmetik an Affen zu testen. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, wir müssen nur Geld an eine Tierschutzorganisation spenden.
In Südkorea gibt es über 750000 Hundefleischfarmen, wo die Hunde in kleinen Metallkäfigen gehalten werden, bevor sie mit einem Stromschlag getötet werden. Diese Hunde – darunter auch Corgis, Pudel und Labradore – sind chronischem Stress ausgesetzt, und weil Hunde dem Gesetz nach keine Nutztiere sind, gelten für sie nicht einmal die Tierschutzregeln für Hühner. Doch die meisten Südkoreaner essen kein Hundefleisch mehr, daher werden die Hundefleischfarmen wohl eingehen.
Ich habe mich für die Themen interessiert, über die wir uns noch keine Meinung gebildet haben, oder über die wir eine Meinung haben, aber nicht danach handeln. Von Anfang an war mir klar, das Fairness gegenüber Tieren für mich zweierlei bedeutete: Ich wollte nicht, dass Tiere unnötig leiden – wobei ich im Nachhinein gar nicht weiß, was »unnötig« in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Und ich wollte nicht, dass Tiere aussterben oder ihre Populationen sich weiter verringern. Mein Ausgangspunkt war, dass wir Menschen vernünftige und vielleicht auch einschneidende Korrekturen in unserer Lebensweise vornehmen sollten, um dies zu erreichen.
Sofort wurde es kompliziert. Sollen wir Ratten töten, um seltene Vögel zu schützen? Sollen wir Rotwild schießen, damit die Wälder wachsen können? Tierschützer sagen nein, Naturschützer sagen ja. Es stellte sich heraus, dass die Sorge um einzelne Tiere oder um eine ganze Spezies einem philosophischen Frontalzusammenstoß gleicht. »Naturschützer können keine Tierschützer sein. Tierschützer können keine Naturschützer sein«, schrieb der US-amerikanische Philosoph Mark Sagoff in einem Essay von 1984. Sagoff argumentiert, dass es Naturschützern um den Erhalt der ökologischen Integrität geht, während Tierschützer das Leid von Tieren verringern wollen. Dabei interessieren sie sich nicht für die gesamte Spezies, weil eine Spezies keine Emotionen hat – im Gegensatz zu individuellen Tieren. Einer Spezies kann man nicht in den Magen boxen oder ihr soziale Beziehungen verwehren. Wir können annehmen, dass Lonesome George, die letzte Pinta-Island-Schildkröte, die auf den Galapagosinseln lebte, bei seinem Ableben 2012 keine existenzielle Trauer über das Ende seiner Subspezies verspürte. Falls doch, müssen wir uns bei ihm entschuldigen – mittlerweile hat man andere Hybriden seiner Spezies gefunden.
Die Spaltung zwischen Natur- und Tierschützern besteht seit Jahrzehnten, und sie hat praktische Konsequenzen. Tierschutzorganisationen – wie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), mit 6,5 Millionen Mitgliedern und Unterstützern, und die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) – konzentrieren sich auf Tiere, die unter menschlicher Kontrolle auf Farmen und in Laboratorien leben. Naturschutzorganisationen – wie der WWF und Greenpeace – konzentrieren sich auf Wildtiere. Tier- und Naturschützer streiten sich vor allem darüber, ob es richtig ist, Tiere zu erlegen, um die Umwelt vor Schaden zu bewahren. Dabei kann es sich um invasive Spezies handeln, oder die Populationen können sich rasant vergrößert haben, weil natürliche Feinde ausgerottet wurden. Naturschützer akzeptieren die scheinbare Grausamkeit der Natur – Löwen erlegen Gazellen und so weiter –, während Tierschützer oft den Versuch machen, individuelle Wildtiere zu retten, beispielsweise indem sie ihnen Futter geben. Die Spaltung schadet beiden Seiten: Tierschützer setzen sich dem Vorwurf aus, sie hätten keine Ahnung davon, was ein natürliches Habitat ausmacht, und die Naturschützer verprellen diejenigen unter ihren Unterstützern, die daran glauben, dass Tiere ein Innenleben haben.
Auf jene Debatten werde ich später zurückkommen. Aber so viel sei gesagt: Diese Spaltung macht in meinen Augen keinen Sinn. Ohne den Naturschutz ist die Tierethik unvollständig. Das Motto von PETA lautet: »Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, dass sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten.« Hier geht es darum, wie Tiere nicht leben sollen. Aber wie sollen sie leben? Die Antwort liegt auf der Hand: an Orten, die die Evolution für sie vorgesehen hat und an denen sie möglichst nicht unter der Kontrolle der Menschen stehen – wie die Nationalparks, für die die Naturschützer eintreten. In der Wildnis leiden Tiere zwar gelegentlich, doch auch das menschliche Leben kann mitunter erbärmlich sein, und dennoch halten wir es für lebenswert. Die Naturschützer würden eine andere Sicht einnehmen, wenn sie das Leben der Tiere mehr achten würden – Biologen würden es beispielsweise nicht mehr als Kavaliersdelikt ansehen, Tiere als Proben zu sammeln –, doch es ist ebenso wahrscheinlich, dass das Ökosystem in manchen Fällen Vorrang vor individuellen Tieren hätte. Im Kosciuszko-Nationalpark in New South Wales, in dem sich auch die höchstgelegene Stadt Australiens befindet, haben Politiker die Verwaltung daran gehindert, Wildpferde zu erlegen. Das hat zur Folge, dass jedes Jahr voraussichtlich ein Fünftel der Wildpferde verhungern wird. So kann Tierliebe nicht verstanden werden. Ohne ein funktionierendes Ökosystem kann es weder Tierschutz noch Tierethik geben, und ohne große Tierpopulationen kann es kein funktionierendes Ökosystem geben.
Die Spaltung zwischen Tierschutz und Naturschutz gibt nicht wieder, wie die Menschen denken. Die meisten Tierfreunde, die ich kenne, wollen das Beste für individuelle Tiere, und gleichzeitig auch für ganze Populationen und Arten. Wir erfreuen uns an Videos mit Katzen und Tigern. Wir sind empört darüber, dass Affen in Käfigen eingesperrt und ihre Wälder gerodet werden. Wir wollen weder, dass Orcas in SeaWorld gehalten werden noch dass sie aussterben. Zumindest in der Theorie ist es uns nicht egal, was mit den Tieren geschieht, ob sie nun wildlebend oder domestiziert sind. Letztendlich basieren Tierethik und Naturschutz auf derselben Überzeugung: dass nicht nur der Mensch die Welt erlebt und sie mit Schönheit füllt, sondern dass nichtmenschliches Leben ebenfalls berücksichtigt werden muss. Ein bestimmtes Tier zu lieben heißt fast immer, dass man das Fortbestehen seiner Spezies auf diesem Planeten befürwortet. Trotz ihrer historischen Spaltung stimmen Tier- und Naturschützer doch in den meisten Punkten überein. Sie wollen so weitreichende Veränderungen umsetzen, dass es kontraproduktiv wirkt, wenn sie sich gegenseitig bekämpfen. Sie sind wie die zwei Mäuse aus dem Kinderbuch, die sich über ein Stück Käse derart in die Haare kriegen, dass sie nicht bemerken, wie die Ratte sich damit davonmacht.
Dieses Buch soll dazu beitragen, Tierethik und Naturschutz zusammenzubringen. Es geht darum, das unverantwortliche Leid, das Menschen Tieren zufügen, abzuschaffen. Es geht auch darum, zu akzeptieren, dass Wildtiere Schmerzen ertragen müssen, genauso wie sie Freude empfinden (obwohl wir in diesem Buch Menschen begegnen werden, die der Ansicht sind, dass wir letztlich einen Weg finden werden, um die Lebensbedingungen von Wildtieren zu verbessern, so wie wir auch unsere eigenen verbessert haben).
Sich um Tiere zu sorgen, ist nicht dasselbe wie gerne Zeit mit ihnen zu verbringen, auch wenn sich beides häufig überschneidet. Aber nicht immer. Joe Exotic, der exzentrische Tierzüchter aus Oklahoma, der seinen eigenen Zoo gegründet und in der Netflix-Serie Tiger King aufgetreten ist, genießt es offensichtlich, mit Tigerbabys herumzutollen, doch es ist zweifelhaft, inwiefern er um ihr Wohlergehen besorgt ist. Der australische Philosoph Peter Singer hat die meiste Zeit seiner Karriere gegen Tierquälerei gekämpft, doch zum Erstaunen vieler seiner Bewunderer ist er nicht besonders gern mit Tieren zusammen. Es ist ein Unterschied, ob wir andere Lebewesen mit unseren Augen sehen, oder ob wir versuchen, uns selbst durch ihre Augen zu sehen.
Als Singer 1975 das Animal Liberation Movement gründete, sagte er, dass es mehr Altruismus erfordern würde als jede andere Befreiungsbewegung: Menschen würden sich nicht für andere Menschen engagieren, sondern für andere Arten. Die Artenbarriere sowie unsere Vorbehalte gegenüber anderen Lebewesen könnten abgebaut werden. Wir wollten sicherlich nicht, dass unser Wohlstand auf Kosten von leidenden Tieren ginge – ebenso wenig wie wir Ausbeuterbetriebe oder Kinderarbeit dulden könnten.
Tiere fair zu behandeln sollte jedem leicht fallen, der der Überzeugung ist, dass wir gemeinsame Wurzeln haben. Doch das ist nicht immer so. Nehmen wie Charles Darwin, der unseren Blick auf die Tierwelt entscheidend geprägt hat. Er widerlegte die These, dass der Mensch sich grundlegend von anderen Arten unterscheidet und ihnen überlegen ist. Die Suche nach unseren gemeinsamen Vorfahren führte später dazu, das Verhalten von Schimpansen zu beobachten und die Übereinstimmungen zwischen ihnen und uns zu erforschen. Darwin hasste Tierquälerei, und in seiner Funktion als Friedensrichter bestrafte er die Missetäter.
Dennoch entwickelte er keine spezielle Ethik über das Zusammenleben mit Tieren. »Du interessierst dich nur für das Jagen, deine Hunde und das Rattenfangen, und du bist eine Schande für dich selbst und deine ganze Familie«, sagte sein Vater zu ihm, vermutlich als er mit achtzehn Jahren das Medizinstudium hinwarf. Darwin stellte sich nicht auf die Seite der Kritiker der Jagd, denn er liebte es zu jagen, und er interessierte sich nicht für die vegetarische Bewegung des 19. Jahrhunderts. Er aß Fleisch; tatsächlich hatte er keinerlei Bedenken, einige der Schildkröten zu verspeisen, denen er auf den Galapagosinseln begegnete, obwohl man ihm gesagt hatte, dass sie bereits Gefahr liefen, durch die Jagd ausgerottet zu werden und er ihr Fleisch als »völlig geschmacklos« beschrieb. Für Darwin stand die Neugier an erster Stelle. Er erinnerte sich daran, wie er auf einer der Inseln, die heute zu Chile gehören, einen sehr seltenen Fuchs erblickte: »Indem ich mich leise von hinten anschlich, gelang es mir, ihm mit meinem Geologenhammer auf den Kopf zu schlagen. Dieser Fuchs … ist heute im Museum der Zoologischen Gesellschaft ausgestellt.« Darwin tötete auch Vögel und Eidechsen, um herauszufinden, wovon sie sich ernährten, und trat für die Vivisektion – das Aufschneiden von lebenden Tieren im Laboratorium – ein, solange diese aus triftigen Gründen vorgenommen wurde. Wie viele unserer Zeitgenossen war er dazu in der Lage, das Leid von Tieren zu verdrängen. »Dieses grauenvolle Thema macht mich ganz krank, also werde ich nichts weiter darüber sagen, denn sonst werde ich heute nacht nicht schlafen können«, schrieb er über die Vivisektion an einen Freund. Darwin besuchte gerne den Londoner Zoo – und vermachte ihm seine Sammlung von Vögeln und Säugetieren –, obwohl die Lebensbedingungen der dort untergebrachten Tiere meist niederschmetternd waren. Ein junges Orang-Utan-Weibchen namens Jenny, das Darwin besonders gerne beobachtete, als er 1838 über die Emotionen von Tieren forschte, starb bereits zwei Jahre nach seiner Ankunft an einer Krankheit, was keineswegs untypisch war. Darwin trat vehement gegen die Sklaverei ein, doch was das Tierwohl betraf, war er kein Visionär.
Der Darwinismus wird gemeinhin mit dem brutalen, amoralischen Kampf ums Überleben assoziiert. Sein Begründer überließ es den folgenden Generationen, herauszufinden, was seine wissenschaftlichen Erkenntnisse für unsere Beziehung zu anderen Lebewesen bedeuten.
Die gute Neuigkeit besteht darin, dass die Menschen häufig ihr Verhalten ändern, sobald sie die Zeit gefunden haben, über Tiere nachzudenken. Einer der berühmtesten britischen Naturschützer war Peter Scott, der Sohn des Polarforschers Robert Falcon Scott. Der 1909 geborene Peter war einer der Gründer des WWF, er entwarf das berühmte schwarz-weiße Panda-Logo. Außerdem war er ein Vogelliebhaber, der viele Naturschützer inspirierte. Doch er ging fast sein ganzes Leben lang auf Vogeljagd: »Zu jagen gehört zu den menschlichen Instinkten, gejagt zu werden zu den Instinkten der Vögel«, schrieb er. Es klingt wenig überzeugend, dass der Instinkt von Vögeln an Vorderlader angepasst ist, und als Peter in den Vierzigern war, erkannte er, wie sinnlos und brutal das Abschießen von Vögeln war, und vollzog eine bemerkenswerte Kehrtwende.
Ähnlich erging es John Mackey, dem Gründer von Whole Foods. Er verbrachte Jahre damit, die Supermarktkette als Vegetarier zu leiten, bevor er sich fragte, ob er mit gutem Gewissen Eier und Milch verzehren könne, angesichts der Zustände, die in Geflügelfarmen und Molkereibetrieben herrschen. Bevor er Veganer wurde, sagte er später, »habe ich einfach weggeschaut. Ich glaube, ich wollte mir darüber gar nicht bewusst werden.«
Meiner Erfahrung nach können wir unsere Sichtweise auf Tiere nur verändern, indem wir uns selbst weiterentwickeln. Es ist ein Prozess, der mit Unbehagen beginnt. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal zufällig einen Kollegen traf, der gerade seinen Hund hatte kastrieren lassen. »Ich glaube, ich verstehe jetzt, wo das Problem liegt«, sagte er. »Es ist fast so gruselig wie in The Handmaid’s Tale.« Es ist die unbehagliche Erkenntnis, dass wir die Kontrolle darüber haben, was mit anderen Spezies geschieht.
Bevor ich für dieses Buch zu recherchieren begann, war ich Vegetarier und hatte eine diffuse Liebe zur Natur. Heute bin ich Veganer, befürworte das Jagen und Fischen unter bestimmten Bedingungen und bin überzeugt davon, dass wir große Teile unseres Planeten anderen Spezies zur Verfügung stellen sollten. Sie werden vielleicht zu anderen Schlüssen kommen. Ich schreibe häufig: »Wir denken«. Das soll nicht etwa heißen, dass alle Menschen dasselbe denken. Tatsächlich habe ich kaum eine Familie getroffen, in der sich alle einig sind, was das Thema Tiere betrifft. Doch wir sollten alle viel mehr über Tiere nachdenken als wir es heute tun, und wenn wir es tun, werden wir vieles finden, über das wir uns einig sein können.
Im folgenden Kapitel fasse ich zusammen, wie sich die Haltung des Menschen gegenüber Tieren in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat, bis hin zur Veganerbewegung, die in den letzten Jahren viel Zulauf bekommen hat. Anschließend beschäftige ich mich damit, wie wir heute noch das Töten von Tieren rechtfertigen: mit Viehzucht, Fischerei, medizinischer Forschung und der Jagd. Was braucht es tatsächlich, um eine Welt mit acht Milliarden menschlichen Omnivoren zu ernähren? Im zweiten Teil des Buchs geht es um verschiedene Formen der Tierliebe. Ich reiste nach San Francisco, Kolumbien, Indonesien, in die Mongolei und die britische Provinz, um mit Zoobetreibern, Naturschützern, Biologen und Haustierbesitzern zu sprechen. Zum Schluss biete ich einige praktische Vorschläge an, wie wir – als Individuen und als Gesellschaften – eine Welt gestalten können, die nicht nur besser für uns, sondern auch für andere fühlende Lebewesen ist. Einige Tiere haben bereits unsere Wertschätzung. Nun müssen wir diesen Weg weiter verfolgen.
Für mich ist es eine Geschichte der Erkenntnis und der Hoffnung – von Nebenwegen, die womöglich zum Mainstream werden können. »Der Geist ist ein Chaos aus Entzücken, aus dem eine zukünftige Welt und mehr stille Freude entstehen wird«, schrieb Darwin während seiner Reise auf der Beagle. Unser Geist ist das, was uns am meisten von anderen Lebewesen unterscheidet. Und er kann uns auch am besten dabei helfen, ein ausgewogenes Verhältnis zu ihnen zu entwickeln.
Früher dachte ich, das meiste, was wir falsch machen, sei keine bewusste Entscheidung, sondern nur eine Folge unseres mangelnden Interesses für das Leben der Tiere. Heute bin ich überzeugt, dass es ein großer Fehler ist, die Konsequenzen unseres Handelns nicht zu überdenken. Wir können so leben, dass es unserer grundsätzlichen Zuneigung zu anderen Arten entspricht. Wir können uns darüber klar werden, was Tiere uns zu bieten haben und was wir ihnen schuldig sind. Indem wir öfter und konkreter über Tiere nachdenken, können wir unsere Befangenheit überwinden.
Eine kurze Geschichte der Menschen und anderer Tiere
Wenn die Leute sagen: »Wir dürfen nicht sentimental werden«, kann man davon ausgehen, dass sie etwas Grausames vorhaben. Und wenn sie hinzufügen: »Wir müssen realistisch sein«, heißt das, dass sie damit Geld machen werden.
Brigid Brophy
Früher habe ich gedacht, die Menschen seien ursprünglich gleichgültig gegenüber Tieren gewesen, doch im Laufe von Jahrtausenden seien sie allmählich mitfühlender geworden. Falsch. Unser Verhältnis zu Tieren – genauer gesagt: zu anderen Tieren – ist so irrlichternd wie der Flug einer Biene, die um einen Lavendelbusch tanzt.
Unsere Evolution verlief Seite an Seite mit anderen Tieren. Zuerst haben sie uns gejagt, dann wurden wir selbst zu Jägern. Die frühesten bekannten Höhlenmalereien fand man in Indonesien, sie sind 40000 Jahre alt und stellen die Jagd auf Schweine und Büffel dar. Die meisten der Darstellungen in Lascaux, Frankreich, die etwa 18000 Jahre alt sind, zeigen ebenfalls Tiere, sogar ein Wollnashorn ist dabei. Wir haben etwas getan, das keine andere Tierart tut: Wir haben bestimmte Tiere gezüchtet, um sie zu essen, oder damit sie uns Gesellschaft leisten. (Kühe, Schweine, Schafe und Ziegen wurden bereits vor mindestens 8000 Jahren domestiziert – Katzen und Hunde ebenfalls.)
Es ist also wenig überraschend, dass für viele der frühen menschlichen Gemeinschaften eine spirituelle Verbindung zwischen Menschen und anderen Tieren bestand. Diese Weltsicht scheint in einigen Punkten eher mit der heutigen Forschung zu Tieremotionen und -bewusstsein übereinzustimmen als unsere Haltung. Unsere Vorväter glaubten, dass Menschen und Tiere (sowie Pflanzen und unbelebte Objekte) eine Seele und ein Bewusstsein hätten, und dass Tiere sogar einen separaten menschlichen Körper besäßen. Einige Menschen konnten sich zeitweilig in ein Tier verwandeln; einige Tiere besaßen wiederum schamanische Kräfte. In den Schöpfungsmythen vieler Völker werden die Menschen als Nachkommen anderer Tiere betrachtet, oder Tiere gelten als Helfer der Menschen. Bei den Kayapó, einem indigenen Stamm, der heute noch im brasilianischen Amazonasgebiet lebt, glaubt man, dass eine Ratte die Menschen zum Mais geführt habe. Es ist offensichtlich, dass sie einen ganz anderen Blick auf Ratten haben als wir. Derartige Überzeugungen hinderten die Menschen jedoch nicht daran, Tiere zu töten – denn diese Gemeinschaften lebten von der Jagd. Doch sie waren sich zumindest theoretisch darüber bewusst, dass sie den Tieren Respekt und Fürsorge schuldeten.
Noch heute finden sich ähnliche Überzeugungen bei vielen indigenen Völkern von Kanada bis zur Kalahari-Wüste. Eine Voraussetzung ist der Glaube, dass es direkte, negative Konsequenzen für die Menschen hat, wenn man Tieren nicht den nötigen Respekt entgegenbringt. Aspekte des animistischen Glaubens gingen in den Hinduismus und den Buddhismus ein und bereiteten den Boden für die westliche Vegetarierbewegung.
Die alten Ägypter beerdigten mumifizierte Katzen, Hunde, Krokodile und andere Tiere neben den Verstorbenen – einige waren geliebte Haustiere, andere sollten im jenseits als Nahrung dienen, einige waren Gaben für die Götter. Dabei handelte es sich nicht etwa um ein Randphänomen: Archäologen schätzen, dass bis zu 70 Millionen Tiere gezüchtet wurden, um als Opfergaben verwendet zu werden, was einer Massentierhaltung gleichkommt. Wie viel Wohlstand die Menschheit auch erlangt hat, wir wollen nicht von unseren Tieren getrennt werden. Vieles spricht dafür, dass wir während unserer Evolution eine Vorliebe für sie entwickelt haben, und dass die Gene, die uns dafür prädestinieren, zumindest mit einigen Tierarten zusammenzuleben, sich als vorteilhaft erwiesen haben.
Einige antike griechische Denker wie Pythagoras und Porphyrios waren aus ethischen Gründen Vegetarier. Doch sie waren in der Minderheit. Jahrhunderte lang galt in Europa die Überzeugung, dass der Mensch sich grundsätzlich vom Tier unterscheidet. Diese Unterscheidung war eng mit den Glaubenssätzen der Kirche verbunden. Im Gegensatz zu den Kulturen, die Tiere als Helfer ansahen, die die menschliche Existenz erst ermöglichten, wird die Schlange in der Bibel beschuldigt, Eva in Versuchung geführt zu haben. Der Mensch hat nichts gemein mit den wilden Tieren und nur er kann Erlösung erfahren. Thomas von Aquin glaubte, Gott habe die Tiere zum Nutzen der Menschen erschaffen. Im 17. Jahrhundert versicherte der französische Philosoph René Descartes seinen Lesern, dass Tiere keine Seele hätten – ihre Schreie seien nur mechanische Reaktionen, wie der Stundenschlag einer Uhr. Bevor es moderne Anästhesie gab, war diese Auffassung äußerst hilfreich für Biologen. In einem französischen Labor hätten die Wissenschaftler »mit vollkommener Gleichgültigkeit Hunden Schläge erteilt«, erinnerte sich ein bestürzter Beobachter namens Nicolas Fontaine. »Sie haben die armen Tiere an ihren vier Pfoten auf Bretter genagelt, um sie zu vivisezieren und die Zirkulation ihres Blutes zu beobachten, was damals in aller Munde war.«
Einige europäische Philosophen behaupteten, für den Menschen bestehe die Gefahr nicht darin, Tiere zu missachten, sondern sie zu respektieren. Descartes argumentierte, wenn die Menschen dächten, ihre Seelen würden sich nicht von denen der »Bestien« unterscheiden, dann würden sie glauben, »wir hätten daher nach diesem Leben nichts zu fürchten noch zu hoffen, nicht mehr als die Fliegen und die Ameisen«. Der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza befürchtete, wenn die Menschen freundlich zu Tieren seien, würden sie auch sich selbst bald als Tiere ansehen – und damit die gesamte Zivilisation gefährden. (Da es das 17. Jahrhundert war, verurteilte er das zunehmende Mitgefühl gegenüber Tieren als »weibliche Schwäche«. Adam und Eva, Teil 2, nur dass Eva dieses Mal von einem Haushund anstelle einer wildlebenden Schlange verführt wurde.) Im England der frühen Neuzeit war es sogar ein Tabu, sich als Hund zu verkleiden – beispielsweise in einer Theateraufführung. Den Menschen war sehr daran gelegen, ihren besonderen moralischen Status zu demonstrieren.
Descartes’ Versuch, andere Lebewesen als seelenlose »Automaten« abzutun, wurde durch die wissenschaftliche Forschung widerlegt. Er wusste, dass Menschen und »Bestien« dieselben Organe hatten (einer seiner englischen Zeitgenossen, der Schriftsteller Gervase Markham, behauptete, er habe nicht ein Pferd mit einem Gehirn gefunden, obgleich er mehrere Pferdeköpfe aufgeschnitten hatte). 250 Jahre später würde Darwin beweisen, dass Menschen und Tiere nicht nur vergleichbare Gehirne besitzen, sondern auch dieselbe Entstehungsgeschichte teilten.
Die Menschen erkannten, dass Tiere Emotionen haben, selbst wenn Descartes’ Philosophie etwas anderes besagte. Im Jahr 1667 schnitt der englische Wissenschaftler Robert Hooke einen lebenden Hund auf, direkt vor den Augen des versammelten Publikums in der Royal Society. Seinem eigenen Bericht nach »entfernte [er] alle Rippen und öffnete den Bauch.« Anschließend führte er einen Blasebalg in die Lunge des Hundes ein, um ihn am Leben zu erhalten. »Ich wollte einige Untersuchungen zum Vorgang der Respiration vornehmen«, berichtete er. Das Experiment war erfolgreich. Aber Hooke konnte das Leid des Hundes nicht ignorieren. Er war so erschrocken über »die Tortur, die die Kreatur erlitt«, dass er sich weigerte, das Experiment zu wiederholen.
Viele Menschen sorgten sich nun nicht mehr darum, von Tieren angegriffen zu werden, oder dass die Zivilisation zusammenbräche, wenn sie ihnen mehr Mitgefühl entgegenbringen würden. Wir haben keine Belege für all die zahllosen Momente, in denen die Verbundenheit von Mensch und Tier deutlich wurde, doch wir wissen, dass Anne Boleyn ihren Hund so sehr liebte, dass keiner außer Heinrich VIII. es wagte, ihr von seinem Ableben zu berichten. In seinem großartigen Buch Man and the Natural World (1983) zeigte der britische Historiker Keith Thomas, wie die Mauer zwischen Menschen und anderen Tieren im Lauf der Jahrhunderte Risse bekam. Als die Menschen in die Städte zogen, begannen sie, die Tiere nicht länger nur als Wirtschaftsgut, sondern auch als Gefährten anzusehen. (Ich habe Thomas gefragt, warum er sich so sicher sei, dass die Landflucht dafür verantwortlich war. Er erzählte mir von seiner eigenen Kindheit auf einem Bauernhof in Wales in den 1930er- und 40er-Jahren, als die Hunde nicht ins Haus durften und die Pferde geschlagen wurden, wenn ein Karren während der Kornernte im matschigen Boden steckenblieb. »Mitgefühl war überhaupt nicht vorhanden«, erinnerte er sich.) Im 17. Jahrhundert kehrten Reisende aus Indien als überzeugte Vegetarier zurück – und lösten einen frühen Trend aus. Anders ausgedrückt: Selbst wenn die meisten Religionen behaupteten, die Menschen müssten keine Rücksicht auf die Gefühle der Tiere nehmen, waren viele Europäer doch gewillt, es zu tun.
Das Aufkommen von Tierrechten in der westlichen Welt wird oft mit dem englischen Philosophen Jeremy Bentham in Verbindung gebracht. Er wurde 1748 geboren, aß gerne Fleisch, trug Stiefel aus Robbenfell und trat im Namen der medizinischen Forschung dafür ein, Tauben mit Stromschlägen zu töten. Er schrieb vergnügt über »Schildkröten-Diners«, die im ausgehenden 18. Jahrhundert in England äußerst beliebt waren. Sie bestanden aus mehreren Gängen mit Speisen, die aus Schildkröten zubereitet wurden, die man lebend aus der Karibik herbeigeschafft hatte. Doch 1789 schrieb Bentham den einen Satz nieder, der seither am häufigsten von Tierrechtlern zitiert wurde: »Die Frage ist nicht ›Können sie denken?‹ oder ›Können sie sprechen?‹, sondern ›Können sie leiden?‹«
Dieser Satz verliert einiges an Durchschlagskraft, wenn man bemerkt, dass er nur eine Fußnote war. Tierschützer von heute übersehen eventuell auch, dass Bentham zu dem Schluss kam, die Menschen seien berechtigt, Tiere zu töten und zu essen, wenn der Tod der Tiere »schneller [und] weniger schmerzhaft ist [als] der unvermeidliche Lauf der Natur« (Er fügte die strittige Bemerkung hinzu: »Sie haben niemals einen Nachteil davon, tot zu sein.«) Als Utilitarier zweifelte er sogar daran, dass Menschen natürliche Rechte besäßen.
Dennoch leitete Benthams Frage einen Wende ein und veränderte unser Denken über Tiere. Ja, andere Tiere mögen anders aussehen, anders denken und sich anders verhalten als wir. Ja, die Bibel behauptet vielleicht, die Menschen seien allen anderen Lebewesen überlegen. Doch Bentham verglich die Situation der Tiere mit der Sklaverei: Ebenso wie schwarze Haut kein Grund dafür sei, dass man einen Menschen foltern dürfe, würde man eines Tages erkennen, dass Tiere nicht gequält werden dürften, nur weil sie sich physisch von den Menschen unterscheiden. Ihr Wohl müsse berücksichtigt werden.
Damals gab es auf der ganzen Welt keine Gesetze, die die Misshandlung von Tieren verhinderten. Die Engländer versammelten sich, um zuzusehen, wie ein Bulle oder ein Bär an einen Pfahl gebunden und von Hunden angegriffen wurde. Die Hunde wurden extra gezüchtet, sie besaßen einen starken Kiefer, damit sie sich an der Schnauze des Bullen festbeißen konnten; heute nennt man sie Bulldoggen. (Die Schilderungen lassen offen, ob der Bulle jemals eine Chance hatte.) Bullen zu quälen war aus kulinarischen Gründen erlaubt: Man dachte, ihr Blut würde verdünnt und das Fleisch somit weicher. Die Bullenhatz fand auch an Hochzeiten statt. Nachdem der Adel das Interesse daran verlor, warf man den Gegnern der Bullenhatz vor, sie würden der arbeitenden Bevölkerung jeglichen Spaß verderben wollen.
Großbritannien war der westliche Vorreiter für Tierschutzaktivismus, was nicht allzu überraschend ist, wenn man seinen Status als erste Industrienation und Pionier der Urbanisierung bedenkt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts nutzte ein angesehener, aber aufgeblasener Anwalt namens Thomas Erskine





























