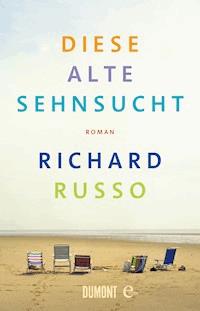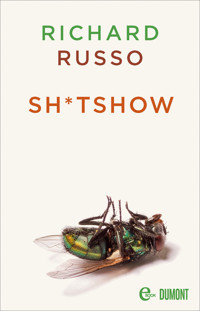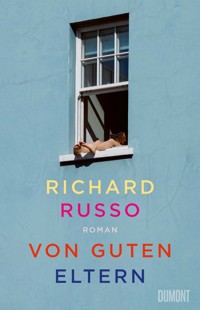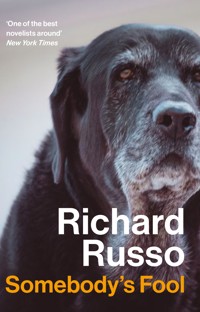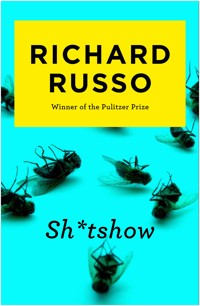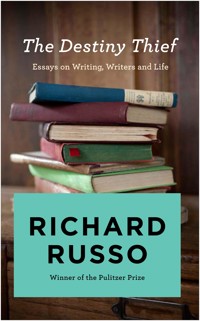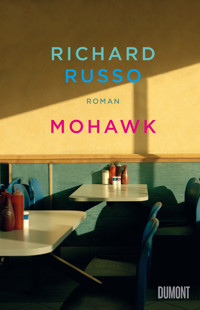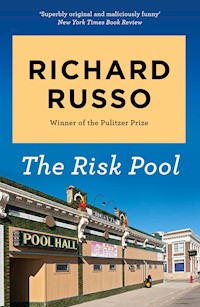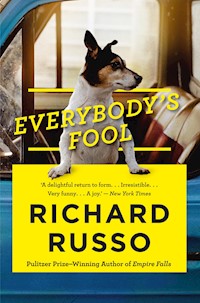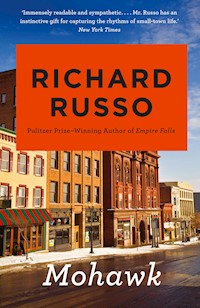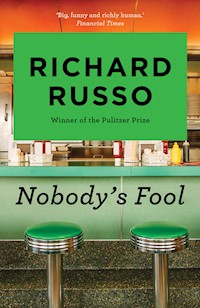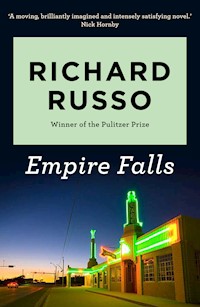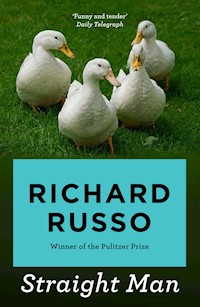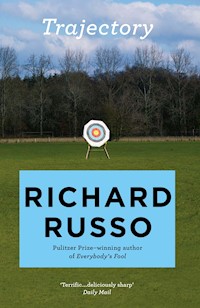12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
William Henry »Hank« Devereaux Jr. ist Vorsitzender der Englischfakultät einer kleinen Universität in Pennsylvania und daran gewöhnt, sich den Ernst des Lebens mit den Waffen der Ironie vom Leib zu halten. Eigentlich ist er ein gemachter Mann. Er ist glücklich verheiratet, Vater zweier Töchter, hat vor Jahren einen Roman veröffentlicht, der immerhin ein Kritikererfolg war, und bestimmt die Geschicke der Universität entscheidend mit. Eigentlich. Denn auf einmal kommt diese eine Woche, in der wirklich alles schiefgeht: Hank gerät mit seinen Kollegen aneinander, die Fakultät ist von Budgetkürzungen bedroht, er zweifelt an seiner Ehe, und dann ist da noch die Sache mit seiner Prostata … ›Mittelalte Männer‹ ist die Charakterstudie eines Mannes um die fünfzig, der gern den Weg des geringsten Widerstands geht und schließlich doch einsehen muss, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als Verantwortung zu übernehmen. Ein hochkomischer Roman, der die Absurdität des Lebens illustriert, aber auch Raum lässt für abgründige Beobachtungen – ein klassischer Russo mit Herz, Hintersinn und Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 908
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
WILLIAMHENRY »HANK« DEVEREAUXJR. ist Vorsitzender der Englischfakultät einer kleinen Universität in Pennsylvania und daran gewöhnt, sich den Ernst des Lebens mit den Waffen der Ironie vom Leib zu halten. Eigentlich ist er ein gemachter Mann. Er ist glücklich verheiratet, Vater zweier Töchter, hat vor Jahren einen Roman veröffentlicht, der immerhin ein Kritikererfolg war, und bestimmt die Geschicke der Universität entscheidend mit. Eigentlich. Denn auf einmal kommt diese eine Woche, in der wirklich alles schiefgeht: Hank gerät mit seinen Kollegen aneinander, die Fakultät ist von Budgetkürzungen bedroht, er zweifelt an seiner Ehe, und dann ist da noch die Sache mit seiner Prostata …
›Mittelalte Männer‹ ist die Charakterstudie eines Mannes um die fünfzig, der gern den Weg des geringsten Widerstands geht und schließlich doch einsehen muss, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als Verantwortung zu übernehmen. Ein hochkomischer Roman, der die Absurdität des Lebens illustriert, aber auch Raum lässt für abgründige Beobachtungen – ein klassischer Russo mit Herz, Hintersinn und Humor.
© Elena Seibert
RICHARD RUSSO, geboren 1949 in Johnstown, New York, studierte Philosophie und Creative Writing und lehrte an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Für ›Diese gottverdammten Träume‹ (DuMont 2016) erhielt er 2002 den Pulitzer-Preis. Bei DuMont erschienen außerdem ›Diese alte Sehnsucht‹ (2010), ›Ein grundzufriedener Mann‹ und ›Ein Mann der Tat‹ (beide 2017) sowie der Erzählband ›Immergleiche Wege‹ (2018), der SPIEGEL-Bestseller ›Jenseits der Erwartungen‹ (2020) und zuletzt ›Sh*tshow‹ (2020).
MONIKA KÖPFER war viele Jahre als Lektorin tätig und übersetzt heute aus dem Englischen, Italienischen und Französischen. Zu den von ihr übersetzten Autoren zählen u.a. J. L. Carr, Mohsin Hamid, Milena Agus, Fabio Stassi, Richard C. Morais, Theresa Révay und Naomi J. Williams.
Richard Russo
Mittelalte Männer
Roman
Aus dem Englischen von Monika Köpfer
Von Richard Russo sind bei DuMont außerdem erschienen:
Diese alte Sehnsucht
Diese gottverdammten Träume
Ein Mann der Tat
Ein grundzufriedener Mann
Immergleiche Wege
Jenseits der Erwartungen
Sh*tshow
Die englische Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel ›Straight Man‹ bei Vintage Books, Random House Inc., New York.
Copyright © 1997 by Richard Russo
eBook 2021
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Monika Köpfer
Lektorat: Emily Modick
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Lubitz + Dorner
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7111-7
www.dumont-buchverlag.de
Für Nat und Judith
PROLOG
»Es ist schön, einen zu haben. Einen Hund.«
F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby
Zugegeben, leicht mache ich es den anderen nicht. Ich kann unterhaltsam sein, das schon, aber die meisten Menschen wollen nicht unterhalten werden. Sie wollen getröstet werden. Und natürlich mag es sein, dass sich meine Vorstellung von guter Unterhaltung nicht mit der manch anderer deckt. Was Kinofilme betrifft, stimme ich vollkommen mit jenen überein, die meinen: »Ich will einfach nur unterhalten werden.« Diese populistische Haltung belächeln die meisten meiner akademischen Kollegen; sie sei einfältig und das Gegenteil von intellektuell, zeuge von mangelndem analytischen und kritischen Intellekt. Und trotzdem bleibe ich bei der Prämisse: Ich will einfach gut unterhalten werden. Dass mich das, was andere Leute unterhaltend finden, die einfach nur gut unterhalten werden wollen, meistens nicht unterhält, macht uns philosophisch gesehen nicht unbedingt inkompatibel. Es bedeutet einfach nur, dass wir nicht zusammen ins Kino gehen sollten.
Kurzum, ich bin ein ziemlich nerviger Typ, wenn es nach den Menschen geht, die mich am besten kennen. Meinen Eltern zufolge war ich schon als Kind nervig. Sie ließen sich scheiden, als ich in der Mittelstufe war, und sind sich über wenig einig, außer dass ich ein unmögliches Kind war. Ihre jeweiligen Versionen der Anekdote von dem jungen William Henry Devereaux jr. und seinem ersten Hund sind nicht nur in punkto Fakten und Pointe auf unheimliche Weise deckungsgleich, sondern auch in der Art, wie sie sie zum Besten geben. Hier ist sie:
Ich war neun, und das Haus, in dem wir wohnten und das der Universität gehörte, war bereits das vierte, in das wir gezogen waren. Meine Eltern waren akademische Nomaden, und mein Vater, damals wie heute ein akademischer Opportunist, gehörte stets zur Avantgarde der jeweils in Mode gekommenen literaturkritischen Strömung. Damals, in den Fünfzigern, war der New Criticism seiner Ansicht nach schon passé. Bereits in seinen frühen mittleren Jahren war er ordentlicher Professor mit einer stattlichen Liste veröffentlichter Bücher, jedes davon »angesagt« und Gegenstand heißer Debatten auf den Anglisten-Cocktailpartys. Seine bevorzugte akademische Position war die des »renommierten Gastprofessors«, die in der Regel eigens für ihn geschaffen wurde, mit einer Dauer von einem, höchstens zwei Jahren, vielleicht weil es schwer ist, unter Leuten, die einen kennen, »renommiert« zu bleiben. In der Regel beschränkte sich sein Lehrpensum auf ein, zwei Kurse im Jahr, mehr Pflichten hatte er nicht. Darüber hinaus erwartete man von ihm, dass er las und nachdachte und schrieb und publizierte und im Vorwort seines nächsten Buchs die Großzügigkeit der jeweiligen Institution erwähnte, die ihm diese komfortable akademische Existenz ermöglichte. Meine Mutter, ebenfalls Anglistik-Professorin, bekam im Rahmen dieses Package-Deals jeweils eine Anstellung mit vollem Deputat, um für den nötigen Ausgleich zu sorgen.
Die Häuser, in denen wir wohnten, waren immer elegant, alt, mit hohen Decken und luftigen Räumen und befanden sich entweder auf dem Campus oder in dessen Nähe. Jedes war mit Parkett ausgestattet und mit einem rußigen offenen Kamin, wo nur ein Feuer brannte, wenn mein Vater Hof hielt, was entweder freitagnachmittags der Fall war, wenn sich der Salon mit unterwürfigen Nachwuchsdozenten und Doktoranden füllte, oder samstagabends, wenn meine Mutter Dinnerpartys gab – zu Ehren des Fachbereichsleiters oder des Dekans oder aber des aktuellen »Gastschriftstellers« der Universität. Bei all diesen Gelegenheiten war ich das einzige Kind, und ich muss ziemlich einsam gewesen sein, denn ich wünschte mir nichts sehnlicher als einen Hund.
Im Gegensatz zu – wenig überraschend – meinen Eltern. Vermutlich war es in diesen von den Universitäten gestellten Villen auch gar nicht erlaubt, einen Hund zu halten. Als ich neun war, lag ich meinen Eltern bereits seit mindestens zwei Jahren damit in den Ohren. Mein Vater und meine Mutter hofften wohl, meine Sehnsucht würde mit der Zeit abflauen, sie könnten die Sache sozusagen aussitzen. Ich konnte diese Hoffnung in ihren Augen lesen, und das stählte meine Entschlossenheit und intensivierte meinen Wunsch nur noch. Was ich mir zu Weihnachten wünschte? Einen Hund. Was ich mir zum Geburtstag wünschte? Einen Hund. Was außer Schinken wollte ich noch auf meinem Sandwich? Einen Hund. In solchen Momenten tauschten sie einen überaus befriedigenden, zutiefst verzweifelten Blick, und wenn ich schon keinen Hund haben durfte, dann war das das Zweitbeste.
Lange ging es so weiter, bis meine Mutter schließlich einen Hammerfehler machte, der aus emotionaler Erschöpfung und Verzweiflung geboren war. Weit mehr als mein Vater hätte sie ein glückliches Kind vorgezogen. Eines Nachmittags im Frühling, nachdem ich wieder einmal in einer Tour gequengelt hatte, forderte sie mich auf, mich hinzusetzen, und sagte: »Weißt du, einen Hund muss man sich erst verdienen.« Als mein Vater das hörte, stand er auf und ging aus dem Zimmer, die grimmige Erkenntnis, dass meine Mutter gerade ihre Niederlage besiegelt hatte. Ihr Plan war, die Anschaffung eines Hundes an Bedingungen zu knüpfen. Sie würden zahlreich und so herausfordernd sein, dass ich gar nicht in der Lage wäre, sie zu erfüllen, und wenn ich keinen Hund bekäme, wäre ich eben selbst daran schuld. Das war ihre Logik, und dass sie tatsächlich glaubte, ein solcher Plan würde aufgehen, zeigt, dass manche Menschen besser nicht Eltern werden sollten und sie dazu zählte.
Sofort begann ich einen eigenen Plan in die Tat umzusetzen, mit dem Ziel, den Widerstand meiner Mutter zu brechen. Im Gegensatz zu ihrem war meiner einfach und nicht fehlerbehaftet. Kaum war ich morgens aufgewacht, begann ich von einem Hund zu reden, und so ging es weiter, bis ich die Augen zumachte. Sobald meine Mutter oder mein Vater versuchte, das Thema zu wechseln, wechselte ich es zurück. »Wo wir gerade von Hunden sprechen«, pflegte ich zu sagen, während ich einen aufgespießten Happen des Bratens, den meine Mutter zubereitet hatte, vor dem Mund balancierte, und schon legte ich von Neuem los. Mag sein, dass gar niemand von einem Hund gesprochen hatte, aber nun taten wir es eben wieder. Alle zwei Wochen schleppte ich aus der Bibliothek ein halbes Dutzend neue Bücher über Hunde mit nach Hause und ließ sie aufgeschlagen im Haus verteilt herumliegen. Ich deutete auf jeden Hund, an dem wir vorbeikamen oder der im Fernseher oder in einer der Zeitschriften meiner Mutter zu sehen war. Bei jeder Mahlzeit hob ich die jeweiligen Vorzüge einer bestimmten Rasse hervor. Mein Vater hörte mir nur selten zu, aber bei meiner Mutter erkannte ich Anzeichen dafür, dass meine Zermürbungstaktik allmählich ihre innere Abwehrmauer bröckeln ließ, und als ich den Eindruck hatte, dass sie kurz vor der Kapitulation stand, kratzte ich jeden Penny meines gesparten Taschengelds zusammen und kaufte mir in dem überteuerten Heimtierbedarf an der Ecke ein glänzendes, mit schmucken Steinen verziertes Halsband samt passender Leine.
In dieser Zeit, als wir unablässig »gerade von Hunden sprachen«, war ich gewiss kein Musterjunge. Ich sollte mir einen Hund erst »verdienen«, also erkundigte ich mich unermüdlich bei meiner Mutter, wie mein Stand war, wie viel von dem Hund ich mir bereits verdient hatte, aber ich bezweifle, dass sich mein Betragen auch nur im Geringsten verbessert hatte. Wobei ich nicht wirklich unartig war. Ich war einfach nur ein lauter, umtriebiger, stets nach Aufmerksamkeit lechzender Junge. »Herr Rein-Raus« nannte mich meine Mutter, weil ich ständig zwischen den Zimmern hin- und herlief, zur Tür herein und wieder hinaus, die Kühlschranktür aufriss und wieder zumachte. »Henry«, mahnte mich meine Mutter immer wieder flehend, »nun setz dich doch mal hin.« Wann immer ich eine Information benötigte, was häufig vorkam, unterbrach ich meine Mutter beim Lesen oder Korrigieren. Vermutlich um meine Fragen nicht beantworten zu müssen, verbrachte mein Vater die meiste Zeit in seinem von Buchregalen gesäumten Büro auf dem Campus und gesellte sich nur zu den Mahlzeiten zu meiner Mutter und mir, sodass wir im Familienkreis über Hunde sprechen konnten. Schon machte er sich wieder davon, in seliger Unwissenheit, jedenfalls dachte ich das damals, dass seine Frau nach seinem Weggang noch minutenlang mordlüstern seinen leeren Stuhl anstarrte. Er sei kurz davor, sein Buch fertigzustellen, behauptete er – eine unschlagbare Entschuldigung gegenüber einem Menschen, der Büchern und der Wissensaneignung so viel abstrakten Respekt entgegenbrachte wie meine Mutter.
Ganz allmählich dämmerte ihr, dass sie allein auf weiter Flur einen Kampf ausfocht, den sie nicht gewinnen konnte. Inzwischen weiß ich, dass dies nur ein Teil eines ganzen Bündels bitterer ehelicher Erkenntnisse war, aber damals witterte ich nichts anderes als den nahen Triumph. Als sie mir Ende August, eine Zeit, die auch »Hundstage« genannt wird, eine letzte halbherzige Bedingung stellte, ein endgültiger Beweis, dass ich einen Hund verdient hatte, gab ich nach und bemühte mich wirklich, mein Verhalten zu ändern. Es war buchstäblich das Wenigste, was ich tun konnte.
Meine Mutter verlangte von mir, die Fliegengittertür nicht mehr zuzuschlagen. Wobei man wissen muss, dass das Haus, in dem wir damals wohnten, ein akustisches Wunder war, ähnlich dem Flüstergewölbe in der St Paul’s Cathedral, wo selbst gedämpfte Laute über einen weiten, offenen Raum hinweg klar und unversehrt auf der anderen Seite des großen Gewölbes ankommen. Die Fliegengittertür in unserem Haus wurde von einer strammen Feder zugezogen, sodass das Knallen des hölzernen Türrahmens gegen den Türstock wie ein durch einen Gitarrenverstärker gejagter Gewehrschuss mit unverminderter Lautstärke und Klarheit in jedes Zimmer des Hauses, ob oben oder unten, transportiert wurde. In dem Sommer rannte ich jeden Tag Dutzende Male durch diese Tür hinein und hinaus, und meine Mutter meinte, es sei, als wohnten wir in einem »Schießgewölbe«. Sie wünschte, die Tür würde nicht nur mit Platzpatronen schießen. Wenn ich daher bitte daran denken könnte, sie nicht länger laut zuzuschlagen, würde sie dafür sorgen, dass ich endlich einen Hund bekäme. Bald.
Ich besserte mich, das heißt, ich dachte ungefähr bei jedem zweiten Mal daran, die Tür leise zuzumachen. Wenn ich es vergaß, ging ich zurück ins Haus und entschuldigte mich, wobei es sein konnte, dass ich es abermals vergaß. Dennoch, mein Bemühen gepaart mit der Tatsache, dass ich das teure Hundehalsband mit Leine auf Schritt und Tritt mit mir herumtrug, führte dazu, dass meine Mutter am Ende jener Woche des verminderten Türenschlagens ein Einsehen hatte, und mein Vater am Samstagmorgen wegfuhr, ohne mir den Grund zu verraten, wobei ich ihn natürlich kannte. »Was für einen?«, fragte ich meine Mutter flehend, nachdem er weg war. Aber sie behauptete, es nicht zu wissen. »Dein Vater kümmert sich darum«, sagte sie, und ich meinte leichte Bedenken in ihrer Miene wahrzunehmen.
Als er zurückkehrte, verstand ich, warum. Er hatte ihn auf den Rücksitz platziert, und als der Wagen vor dem Haus hielt, erblickte ich den Hund vom Küchenfenster aus; er hatte das Kinn auf die Rückenlehne des Beifahrersitzes gelegt. Ich glaube, er sah mich auch, wobei er es nicht zu erkennen gab. Nicht bemerkt zu haben schien er außerdem, dass der Wagen angehalten hatte, mein Vater ausgestiegen war und die Lehne des Vordersitzes für ihn vorgeklappt hatte. Er musste in den Wagen hineinlangen, den Hund am Halsband nehmen und ihn herausziehen.
Als das Tier seine langen Gliedmaßen entfaltete und vorsichtig und arthritisch aus dem Wagen kletterte, wurde mir klar, dass ich sowohl betrogen als auch ausgetrickst worden war. In der ganzen Zeit, als wir »über Hunde gesprochen« hatten, schwebte mir irgendein Welpe vor. Ein Collie-Welpe, Beagle-Welpe, Labrador-Welpe, Schäferhund-Welpe – aber geschrieben stand das freilich nirgends. Und wenn schon kein Welpe, dann doch ein junger Hund. Ein Bengel, temperamentvoll und mit lauter Flausen im Kopf, ein Hund, dem ich allerlei Tricks beibringen konnte. Dieser Hund war kaum gehfähig. Mit gesenktem Kopf stand er da, als schämte er sich einer Sache, die er vor langer Zeit als Welpe angestellt hatte, und als mein Vater die Wagentür hinter ihm zumachte, meinte ich auch ein Schaudern an ihm wahrzunehmen.
Das Tier war das, was man, nehme ich an, einen stattlichen Hund hätte nennen können. Ein reinrassiger Irish Red Setter, penibel gepflegt, mit vollendeten Manieren, ein Hund von der Sorte, wie man ihn wohl bedenkenlos in einer universitätseigenen Villa halten konnte, ein Hund, mit dem man im Grunde nicht gegen die »Keine Haustiere«-Klausel verstieß, die Sorte Hund, wie ich auf Anhieb sah, die man sich zulegte, wenn man eigentlich keinen Hund oder jedenfalls keine Umstände mit einem Hund wollte. Er hatte, wie ich später erfuhr, einem emeritierten Professor der Universität gehört, der Anfang der Woche in ein Pflegeheim eingewiesen worden war und einen verwaisten Hund zurückgelassen hatte. Der Irish Setter war ein Bild von einem Hund oder ein Hund, den man sich borgte, um Modell für ein Porträt zu sitzen, ein Hund, bei dem man sicher sein konnte, dass er sich nicht bewegen würde.
Sowohl mein Vater als auch der Hund kamen widerstrebend in die Küche, woraufhin mein Vater die Fliegengittertür sehr bedächtig hinter sich schloss. Gern möchte ich glauben, dass er auf der Fahrt Gewissenbisse hatte, aber ich konnte sehen, dass er sich betont souverän geben wollte. Meine Mutter, die meine Riesenenttäuschung auf Anhieb bemerkt hatte, sah mich einen Moment lang an, dann meinen Vater.
»Was?«, fragte er.
Meine Mutter schüttelte nur den Kopf.
Mein Vater schaute von mir zu ihr. Ein heftiges Zittern erfasste die Gliedmaßen des Hunds. Das Tier schien sich auf den kühlen Linoleumboden legen zu wollen, aber vergessen zu haben, wie das ging. Der Setter stieß einen tiefen Seufzer aus, als wollte er für uns alle sprechen.
»Er ist ein braver Hund«, sagte mein Vater in spitzem Ton zu meiner Mutter. »Ein bisschen empfindlich, aber das haben reinrassige Setter nun mal so an sich. Sie sind alle nervös.«
Mein Vater hatte von solchen Dingen im Grunde keine Ahnung. Ganz offensichtlich wiederholte er, was man ihm kurz zuvor bei der Abholung des Hundes erklärt hatte.
»Wie heißt er?«, fragte meine Mutter, vermutlich nur, um etwas zu sagen.
Mein Vater hatte es versäumt, danach zu fragen. Er inspizierte das Halsband nach einem Hinweis.
»O Gott«, murmelte meine Mutter, »o Gott.«
»Wir können ihm doch selbst einen Namen geben«, meinte mein Vater, mittlerweile gereizt. »Das kriegen wir doch gerade noch hin, meinst du nicht?«
»Wie wär’s mit dem Namen einer aus der Mode gekommenen literaturkritischen Strömung?«, schlug meine Mutter vor.
»Er ist eine Sie«, warf ich ein, weil es stimmte.
Es schien meinen Vater aufzuheitern, jedenfalls ein bisschen, dass ich endlich auch etwas sagte. »Was meinst du, Henry?«, wollte er wissen. »Wie sollen wir ihn nennen?«
Dass er zum zweiten Mal das falsche Pronomen verwendete, gab mir den Rest. »Ich will jetzt raus zum Spielen«, sagte ich und war schon bei der Fliegengittertür, ehe jemand etwas einwenden konnte. Sie knallte noch lauter hinter mir zu als sonst. Während ich die Eingangsstufen in einem Satz nahm, ertönte aus der Küche ein Schlag, ein dumpfes Echo des Knallens der Fliegengittertür, und ich hörte meinen Vater sagen: »Was zum Teufel?« Ich stieg wieder die Stufen hinauf, vorsichtig diesmal, wollte mich entschuldigen. Da sah ich durch die Gittertür, wie mein Vater und meine Mutter mitten in der Küche standen und auf den Hund hinabstarrten, der ein Nickerchen zu halten schien. Mein Vater stupste ihn mit der Spitze seines Loafers an der Hüfte an.
Das Grab im Garten hob er mit einer von einem Nachbarn geborgten Schaufel aus. Mein Vater hatte recht zarte Hände und zog sich schnell Blasen zu. Ich bot ihm meine Hilfe an, aber er sah mich nur wortlos an. Als er hüfttief in dem Loch stand, das er soeben ausgehoben hatte, schüttelte er ein letztes Mal ungläubig den Kopf. »Tot«, sagte er. »Noch bevor wir ihm einen Namen geben konnten.«
Ich hütete mich, ihn erneut wegen des unzutreffenden Pronomens zu kritisieren, stattdessen stand ich nur da und dachte darüber nach, was er gesagt hatte, während ich zusah, wie er aus dem Loch herauskletterte und zur hinteren Veranda ging, um den Hund zu holen, der dort mit einem alten Laken bedeckt lag. Daran, wie er die Ränder des Lakens sorgfältig unter das Tier gestopft hatte, konnte ich erkennen, dass es ihm widerstrebte, etwas Totes anzufassen, auch wenn es noch nicht lange tot war. Er fasste das Laken an den beiden Langseiten und ließ den Hund in die Grube hinab, aber als das Tier ungefähr dreißig Zentimeter über dem Grund schwebte, musste mein Vater notgedrungen loslassen. Nachdem es mit einem dumpfen Geräusch unten aufgeschlagen und reglos liegen geblieben war, sah mein Vater zu mir hinüber und schüttelte erneut den Kopf. Dann nahm er wieder sein Werkzeug zur Hand und lehnte sich einen Moment auf den Stiel, ehe er anfing, das Grab wieder zuzuschaufeln. Er schien darauf zu warten, dass ich etwas sagte, also sagte ich: »Red.«
Mein Vater kniff die Augen zusammen, als hätte ich etwas in einer Fremdsprache gesagt. »Was?«
»Wir nennen sie Red.«
In den Jahren, nachdem er uns verlassen hatte, wurde er noch berühmter. Hin und wieder wird er sogar als der »Vater der Amerikanischen Literaturkritik« gerühmt, sofern »rühmen« das richtige Wort ist. Abgesehen von den zahlreichen akademischen Büchern hat er auch seine Memoiren verfasst, ein literarisches Werk, das es sogar auf die Shortlist eines wichtigen Literaturpreises schaffte und Einblick bietet in das Leben mehrerer bedeutender literarischer Persönlichkeiten des zwanzigsten Jahrhunderts, die inzwischen verstorben sind. Häufig ziert sein Konterfei die Seiten von Literaturzeitschriften. Während es eine Phase gab, in der er Rundhalspullover mit Goldkettchen und darüber ein Tweedsakko trug, lässt er sich inzwischen meist in Oxfordhemd, Krawatte und Jackett in seinem von Buchregalen gesäumten Büro an der Universität ablichten. Aber für mich, seinen Sohn, ist William Henry Devereaux sen. dann am realsten, wenn ich mir vor Augen rufe, wie er sich in seinen erdverkrusteten Loafern auf den Stiel einer geborgten Schaufel lehnte und seine schmutzigen, von Blasen übersäten Hände betrachtete, während ich ihm einen Namen für unseren toten Hund vorschlug. Ich nehme an, das Grab für unseren Hund auszuheben war eine der wenigen Erfahrungen in seinem Leben (abgesehen von sexuellen), die nicht einer gedruckten Seite entsprangen. Und als ich vorschlug, den toten Hund Red zu taufen, sah er mich an, als wäre ich einem der Bücher entstiegen, die er vor Jahren zu lesen begonnen und dann wieder weggelegt hatte, weil etwas anderes seine Aufmerksamkeit erregte. »Was?«, fragte er und ließ die Schaufel los, sodass der Stiel genau zwischen meinen Füßen landete. »Was?«
Es ist nie ein leichter Moment für Eltern, wenn ihnen plötzlich aufgeht, dass sie ein Kind gezeugt haben, das die Dinge nie so sehen wird wie sie selbst, ungeachtet der Tatsache, dass es ihr lebendes Vermächtnis ist, ihren eigenen Namen trägt.
ERSTER TEIL
Ockhams Rasiermesser
»Was ich erwartete, war
Donner, Kämpfe,
langes Ringen mit Männern
und Klettern.«
Stephen Spender
1. Kapitel
Als das Nasenbluten endlich aufhört und ich die benutzten Papiertaschentücher entsorgt habe, besteht Teddy Barnes darauf, mich in seinem alten, klapprigen Honda Civic nach Hause zu fahren, einem Wagen, der einfach nicht sterben will, und den Teddy, knauserig, wie er ist, nicht gegen ein neueres Modell austauschen will. Seine Frau June, die ein ausgeprägteres Selbstwertgefühl besitzt, fährt einen neuen Saab. »Der Sitz lässt sich übrigens zurückschieben«, sagt Teddy, als er sieht, dass sich meine Knie fast unter meinem Kinn befinden.
Als wir an einer Kreuzung anhalten, um nach Gegenverkehr Ausschau zu halten, fahre ich mit den Fingern am unteren Rand meines Sitzes entlang und taste nach dem Schalter. »Ach ja, wie denn?«
»Jedenfalls sollte er.« Teddys Stimme klingt akademisch, hilflos.
Mir ist klar, dass sich der Sitz zurückschieben lassen sollte, gebe aber den Versuch auf, ihn dazu zu bringen, weil ich lieber den Anschein erwecke, leiden zu müssen. Ich bin kein geborener Schlechtes-Gewissen-Verursacher, beherrsche diese Rolle aber ganz gut. Ich stoße einen theatralischen Seufzer aus, der Teddy signalisieren soll, dass das hier Quatsch ist, dass meine langen Beine auch bequem unter dem Lenkrad meines Lincolns ausgestreckt sein könnten, der genauso alt und klapprig ist wie Teddys Civic, dafür aber eher für die langbeinigen William Henry Deverauxs dieser Welt gebaut wurde, von denen noch zwei – mein Vater und ich – unter den Lebenden weilen.
Teddy ist ein wahnsinnig vorsichtiger Fahrer und denkt nicht daran, bei spärlichem Gegenverkehr mit seinem kleinen Civic links abzubiegen. »Der Abstand passt einfach nie. Da kann ich nichts für«, erklärt er, als er mein Grinsen bemerkt. Teddy ist so wie ich neunundvierzig, und obwohl seine Züge jungenhafter sind, machen sich auch bei ihm Anzeichen des Alterns bemerkbar. Er war noch nie kräftig, doch seine Brust scheint sich zunehmend nach innen zu wölben, was seinen Bauchansatz betont. Seine Hände sind zart, fast weiblich, unbehaart. Seine dünnen Beine wirken in der Hose verloren. Während ich ihn so ansehe, kommt mir der Gedanke, dass er es ziemlich schwer hätte, noch einmal von vorn zu beginnen – das heißt, neue Dinge zu erlernen, sich mit anderen zu messen, eine Partnerin zu finden. Das ganze Junge-Männer-Programm eben. »Warum sollte ich denn noch mal von vorn anfangen?«, möchte er wissen, und ein ängstlicher Ausdruck hebt seine Krähenfüße hervor.
So wie er mich jetzt ansieht, muss ich meinen Gedanken offenbar laut ausgesprochen haben, obwohl mir das gar nicht bewusst war. »Wünschst du dir nicht manchmal, du könntest das?«
»Was?« Seine Aufmerksamkeit ist auf etwas anderes gerichtet. Nachdem er eine Lücke im Gegenverkehr ausgemacht hat, nimmt er den Fuß von der Bremse, beugt sich vor, lässt den Fuß knapp über dem Gaspedal schweben, nur um zu beschließen, dass die Lücke zwischen den Autos doch nicht so groß ist, wie zuerst angenommen, und sich wieder mit einem frustrierten Seufzer zurückzulehnen.
Angesichts seiner Reaktion muss ich daran denken, ob an dem Gerücht, das über Teddys Frau June in Umlauf ist – sie habe eine Affäre mit einem jüngeren Dozenten –, etwas dran sein könnte. Bis jetzt habe ich ihm keinen Glauben geschenkt, weil Teddy und June eine so perfekte symbiotische Beziehung führen. Bei uns Anglisten haben sie den Spitznamen Ginger und Fred, weil sie mit so viel Anmut, ohne den Hauch von Leidenschaft, ein gemeinsames Ziel verfolgen. In einer von Argwohn, Misstrauen und Rachsucht geprägten Atmosphäre stellen zwei Menschen, die zusammenarbeiten, ein unerschütterliches Kraftfeld dar, und niemand hat diese traurige akademische Wahrheit mehr verinnerlicht als Teddy und June. Daher ist es schwer vorstellbar, einer von ihnen könnte es aufs Spiel setzen. Andererseits muss es auch schwer sein, mit einem Mann wie Teddy verheiratet zu sein, der sich immer so vorsichtig vorbeugt, den Fuß über dem Gaspedal, aber zu ängstlich ist, es durchzudrücken.
Wir stehen in der Church Street, einer Parallelstraße zu der Gleisharfe, die die Stadt Railton in zwei gleichermaßen schmuddelige, unattraktive Hälften teilt. An dieser Stelle ist sie am breitesten, umfasst ungefähr zwanzig Gleise, und auf den meisten stehen ein, zwei rostige Güterwaggons herum. Vor rund einem Jahrhundert, als Railton noch eine boomende Stadt war, deren Einwohner hoffnungsvoll in die Zukunft blickten, wären die Gleise voll gewesen. Aber das war einmal. In der Church Street, wo wir noch immer auf der Linksabbiegespur leerlaufen, gibt es keine einzige Kirche mehr, während es früher, wie ich mir habe erzählen lassen, ein halbes Dutzend gab. Die letzte, ein baufälliges rotes Backsteingebilde, schon lange abbruchreif und mit zugenagelten Fenstern, wurde letztes Jahr abgerissen, nachdem sich ein paar Jugendliche Zugang verschafft hatten und der Boden unter ihnen eingebrochen war. Auf dem großen Grundstück, wo sie sich befand, herrscht jetzt gähnende Leere. Und dieser Umstand, dass so viele mit Müll übersäte Lücken in Railton klaffen, genau wie die zugigen Stellen zwischen den vereinzelten Güterwaggons auf den Gleisen, macht es der Hoffnung nicht eben einfach. In Sichtweite der Kreuzung, wo wir nach wie vor darauf warten, in die Pleasant Street abbiegen zu können, hat ein Mann namens William Cherry, der sein ganzes Leben lang bei Conrail gearbeitet hatte, diesem ein Ende gesetzt, indem er sich mitten in der Nacht auf die Schienen legte. Zuerst vermutete man, er sei einer der Arbeiter, die in der Vorwoche entlassen worden waren, aber dann stellte sich heraus, dass das Gegenteil der Fall war. Er war vor Kurzem mit einer ordentlichen staatlichen Pension samt Betriebsrente in den Ruhestand getreten. Nachbarn, die weniger Glück hatten als er, schüttelten im Fernsehen nur ungläubig den Kopf. Er hatte es doch geschafft, meinten sie.
Als es wirklich sicher ist, als alle entgegenkommenden Autos vorbeigefahren sind, biegt Teddy endlich in die Pleasant Street ein, die ungeachtet ihres Namens die am wenigsten gefällige Straße in Railton ist. Zu beiden Seiten gesäumt von schäbigen ein- oder zweistöckigen Bürogebäuden, ist sie so steil, dass sie im Winter, wenn Schnee liegt, kaum befahrbar ist. Und jetzt, im April, fürchte ich, dass sie für Teddys Civic zu steil ist, der sich im zweiten Gang mit zwanzig Sachen röhrend den Hang hinaufquält. Auf halber Höhe gibt es ein flaches Teilstück und eine Ampel, und als wir anhalten, sage ich: »Soll ich aussteigen und schieben?«
»Nein, er ist einfach noch kalt«, erklärt Teddy mir. »Wirklich, wir schaffen es.«
Er hat zweifelsohne recht. Wir werden es schaffen. Ich wüsste nur gern, warum sich diese Tatsache so entmutigend anfühlt. Unwillkürlich frage ich mich, ob William Cherry ebenfalls fürchtete, dass die Dinge ihren gewohnten Gang gingen, wenn er nicht etwas Drastisches tun würde, um sie daran zu hindern.
»Ich glaub, ich kann’s, ich glaub, ich kann’s, ich glaub, ich kann’s«, skandiere ich, als die Ampel auf Grün schaltet und Teddy den kleinen Civic, der es schon schaffen wird, weiter die Straße hinaufquält. Ein paar Monate zuvor war ich so dumm zu versuchen, die nur leicht schneebedeckte Straße hinaufzufahren. Es war kurz vor Mitternacht, und ich wollte mir auf dem Nachhauseweg vom Campus den zehnminütigen Umweg sparen. In den strengen Wintern ist es in Pennsylvania nicht erlaubt, nachts am Gehsteig zu parken, sodass die Straße verlassen, fast ein wenig unheilvoll anmutete. Mein Wagen war als einziger auf dem fünf Querstraßen umfassenden Steilstück unterwegs, und ich erreichte ohne Zwischenfall den kurzen, flachen Abschnitt, wo Teddy und ich soeben vor der Ampel angehalten haben. Das Büro meines Versicherungsvertreters befand sich genau an dieser Ecke, und es hätte mir gefallen, hätte er mich bei meinem waghalsigen Manöver mit einem Wagen, den er versichert hatte, beobachtet. Als ich bei Grün anfahren wollte, drehten die Reifen durch, und als sie endlich griffen, versuchte ich mich die letzten beiden Häuserblocks entlang die Straße hinaufzukämpfen. Keine dreihundert Meter entfernt vom oberen Ende des Hangs spürte ich, wie die Reifen erneut durchdrehten und das Heck ausschwenkte. Der Motor würgte ab, und als mir klarwurde, dass meine Bremsversuche ins Leere gingen, lehnte ich mich zurück und wurde Zeuge meiner eigenen Dummheit. Sämtliche Geräusche vom Schnee gedämpft, schlitterte mein Wagen in einem stillen, anmutigen Ballett rückwärts die abschüssige Straße hinab, und es schien, ich könnte ihn auf dem flachen Teilstück, direkt gegenüber der Versicherungsagentur, zum Halten bringen, aber nein, er rutschte drei weitere Querstraßen hinunter, während er links und rechts vom Bordstein abprallte wie die Billardkugel von den Banden, um schließlich vor dem Eingang zur Gleisharfe zum Stehen zu kommen. Abgesehen von Gleichgewichtsverlust hatte ich keinen Schaden genommen. Eine Freundin, Bodie Pie, die in einer Wohnung im ersten Stock unweit der Stelle wohnt, wo die Straße ansteigt, und angeblich mein Schlitterballett verfolgt hatte, schwört, sie habe mich wie einen Wahnsinnigen lachen hören, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Die einzige Emotion, die ich im Gedächtnis behalten habe, ist die gleiche, die mich auch jetzt überkommt, da ich mit Teddy dieselbe steile Straße befahre. Der Anflug von Enttäuschung darüber, dass ein solches Drama ohne nennenswerte Konsequenzen bleibt. Teddy ist sich sicher, dass wir es schaffen, und ich bin es auch. Wir haben beide eine Lebenszeitstellung.
Nachdem wir die Stadt verlassen haben, schnurrt der Civic, als wäre er in einen Jungbrunnen gefallen, über die Teerstraße wie ein breit lächelnder Wagen in einem Comic (Ich wusste, ich kann’s, ich wusste, ich kann’s), während die ländliche Gegend von Pennsylvania an uns vorbeisaust. Die meisten Bäume am Straßenrand haben bereits ausgeschlagen. Etwas tiefer im Wald mag es immer noch ein paar schmutzige Schneeflecken geben, aber der Frühling liegt ganz klar in der Luft, und Teddy hat sein Fenster heruntergekurbelt, um die frische Luft hereinzulassen. Sein dünner werdendes Haar flattert im Fahrtwind, und beinahe erwarte ich, neue Knospen auf seinem Schädel sprießen zu sehen. Ich weiß, dass er Rogaine in Betracht gezogen hat, dieses angebliche Wunderhaarwuchsmittel. »Du fährst mich doch nur nach Hause, damit du mit Lily flirten kannst«, sage ich.
Teddy errötet. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er unschuldig in meine Frau verknallt. Sofern man unschuldig verknallt sein kann. Sofern es überhaupt so etwas wie Unschuld gibt. Seit wir unser Haus auf dem Land gebaut haben, hat Teddy nicht mehr so oft Gelegenheit, Lily zu sehen, sucht jedoch immer wieder nach passenden Ausflüchten. An den seltenen Samstagmorgen, an denen wir noch Basketball spielen, holt er mich immer ab. Der Sportplatz liegt nur ein paar Straßen von seinem Haus entfernt, aber er beteuert jedes Mal, die sieben Kilometer Entfernung zu uns hinaus seien kein großer Umweg für ihn. Eines Abends vor gut zehn Jahren beging er in trunkenem Zustand den Fehler, mir seine Schwärmerei für Lily zu beichten. Kaum war es heraus, beschwor er mich auch schon, es ja für mich zu behalten. »Wenn du es ihr erzählst, dann gnade dir …«, sagte er mehr als einmal.
»Sei kein Idiot«, erwiderte ich besänftigend, »natürlich werde ich es ihr erzählen. Sobald ich zu Hause bin, erfährt sie es.«
»Und unsere Freundschaft?«
»Wessen Freundschaft?«
»Unsere. Deine und meine.«
»Was soll damit sein?«, sagte ich. »Ich bin nicht derjenige, der in deine Frau verliebt ist. Also komm mir bloß nicht mit Freundschaft. Eigentlich sollte ich jetzt darauf bestehen, dass wir das vor der Tür klären.«
Er grinste mich trunken an. »Du bist doch Pazifist, vergessen?«
»Das heißt nicht, dass ich dir nicht drohen kann. Es heißt nur, dass du mich nicht ernst nehmen musst.«
Aber ich bemerkte, dass er mich ernst nahm, so wie er alles ernst nahm.
»Du liebst sie nicht so, wie sie es verdient hat«, sagte er mit Tränen in den Augen.
»Woher willst du das denn wissen?«, erwiderte William Henry Devereaux jr. trockenen Auges.
»Ich weiß es einfach.«
»Würde es dich beruhigen, wenn ich dir verspreche, dass ich, sobald ich zu Hause bin, über sie herfalle?«
Es war eine ziemlich absurde Situation: Zwei mittelalte Männer – wir waren auch damals schon mittelalt –, die in einer Bar in Railton, Pennsylvania, saßen und darüber diskutierten, wie viel Liebe genug sei, wie viel mehr jemand verdiente. Teddy entging indes die Absurdität, und ich fürchtete schon, er würde mir einen Fausthieb verpassen. Er musste doch wissen, dass ich ihn auf den Arm nahm, aber Teddy gehört zu der überwältigenden Mehrheit, die glaubt, über Liebe dürfe man keine Witze machen. Mir hingegen ist schleierhaft, wie man keine Witze über Liebe machen und gleichzeitig behaupten kann, man hätte Sinn für Humor.
Seit diesem denkwürdigen Abend bin ich der Einzige, der ab und zu eine Anspielung auf sein Geständnis macht. Er hat es nie zurückgenommen, aber der Vorfall hat nichts von seiner Peinlichkeit verloren. »Ich wünschte, du hättest auch gewisse Gefühle für June«, sagt er jetzt mit einem reumütigen Lächeln. »Dann könnten wir uns auf eine gegenseitige Sehnsucht aus der Ferne verständigen.«
»Sag mal, wie alt bist du noch mal?«, frage ich.
Eine Weile schweigt er. »Wie auch immer«, erwidert er schließlich. »Der wahre Grund, warum ich dich nach Hause fahren wollte, ist …«
»Himmel, das schon wieder.«
Ich weiß, was jetzt kommt. Seit Wochen machen Gerüchte die Runde, die Universitätsleitung plane einen Kahlschlag, der auch vor fest angestellten Professoren nicht haltmachen werde. Wenn das stimmt, wäre theoretisch niemand an der Anglistikfakultät vor einer Kündigung gefeit. Angeblich wird die Hiobsbotschaft den Fachbereichsleitern in ihrem regulären Jahresgespräch vom Verwaltungschef der Universität überbracht. Je nachdem, welchem Gerücht man Glauben schenken möchte, bittet oder aber drängt dieser die Fachbereichsleiter, die Kollegen ihrer Bereiche aufzulisten, die sie als verzichtbar erachten. Wobei Dienstalter und Rang kein Kriterium sein sollen.
»Na gut«, sage ich, »dann schieß los. Mit wem hast du diesmal gesprochen?«
»Mit Arnie Drenker von den Psychologen.«
»Und du glaubst, was Arnie Drenker dir erzählt? Der ist doch unzurechnungsfähig.«
»Er schwört, er muss so eine Liste machen.«
Als ich nicht sofort etwas darauf sage, wendet Teddy einen Moment lang den Blick von der Straße und richtet ihn auf mich. Mein rechter Nasenflügel, der so angeschwollen ist, dass ich ihn aus dem Augenwinkel sehen kann, pulsiert unter seinen forschenden Augen. »Warum weigerst du dich, den Ernst der Lage zu begreifen?«
»Weil wir April haben, Teddy«, erwidere ich. Wir führen Jahr für Jahr die gleiche Diskussion. Im April greift die Paranoia unter dem akademischen Personal um sich, nicht, dass die ganz normale Paranoia nicht ausreichen würde, ihnen auch in entspannteren Monaten selbst einen herrlichen Sonnentag zu verderben. Aber im April ist es immer am schlimmsten. Egal, welche Sauerei sie uns antun wollen, geplant wird sie immer im April, um sie im Sommer auszuführen, wenn wir in alle Winde verstreut sind. Im September ist es dann zu spät, um noch etwas gegen die reduzierten Leistungszulagen zu unternehmen und das gekürzte Reisekostenbudget und die verdoppelte Parklizenzgebühr, die es uns erlaubt, den Bereich vor der Fakultät Moderne Sprachen zu benutzen. Gerüchte über einschneidende Budgetkürzungen, die das akademische Personal betreffen, hat es auch schon in den letzten fünf Jahren zuhauf gegeben, wobei sie dieses Jahr besonders hartnäckig und heftig sind. Dennoch, die Legislative hat in den letzten Jahren immer wieder mit einschneidenden Kürzungen im Höheren Bildungswesen gedroht. Jahr für Jahr macht sich eine hochrangige Lobby-Delegation ins Kapitol auf, um höhere Ausgaben zu erwirken. Jahr für Jahr werden Anschuldigungen erhoben, Leitartikel verfasst. Jahr für Jahr werden die angedrohten Budgetkürzungen umgesetzt, dann wird im allerletzten fiskalpolitischen Moment doch noch Geld aufgetrieben und das geplante Budget – jedenfalls größtenteils – genehmigt. Und jedes Jahr komme ich wieder zu dem Schluss, dass Wilhelm von Ockham (dieser erste große moderne William, der Bedeutendste aller Williams, die es je gegeben hat und je geben wird, der der Menschheit sein famoses Rasiermesser an die Hand gegeben hat, mittels dessen sich einfache Wahrheiten ableiten lassen, der ins Exil gehen musste und sein Leben aufs Spiel setzte, damit uns unsere akademischen Sünden vergeben werden mögen) zu dem Schluss gekommen wäre, dass es dieses Jahr keine »Säuberung« unserer Fakultät geben wird, ebenso wenig wie es letztes Jahr eine gab und nächstes Jahr eine geben wird. Was es nächstes Jahr wahrscheinlich geben wird, ist ein Engerziehen des Gürtels, mehr abgelehnte Sabbaticalgesuche, eine Verlängerung des Einstellungsstopps und ein kleineres Kopierbudget. Ganz sicher wird es nächstes Jahr wieder einen April geben und eine weitere Gerüchterunde.
Teddy sieht mich erneut von der Seite an. »Weißt du eigentlich, was deine Kollegen sagen?«
»Nein. Ja. Ich meine, ich kenne meine Kollegen, also kann ich mir auch vorstellen, was sie sagen.«
»Sie sagen, es ist suspekt, dass du die Gerüchte einfach so abtust. Sie fragen sich, ob du nicht vielleicht schon eine Liste aufgestellt hast.«
Ich seufze theatralisch. »Wenn ich das getan hätte, wäre sie ziemlich lang. Wenn wir je anfangen, das Unterholz in unserem Fachbereich zu lichten, wollen wir wohl kaum bei zwanzig Prozent aufhören.«
»Genau solche Sprüche machen die Leute nervös. Es ist jetzt nicht die Zeit für Scherze. Würdest du mir vertrauen, würdest du mir erzählen, was du weißt, damit ich wenigstens unsere Freunde beruhigen kann.«
»Was, wenn ich nichts weiß?«
»Okay, wie du meinst.« Teddy wirkt, als hätte ich seine Gefühle verletzt. »Als ich noch Fachbereichsleiter war, habe ich dir auch nicht alles erzählt.«
»Doch, hast du«, erwidere ich. »Ich erinnere mich noch genau daran, weil ich nichts davon wissen wollte.«
Als ich sehe, dass ich diesmal seine Gefühle wirklich verletzt habe, lenke ich ein bisschen ein. »Irgendwann diese Woche habe ich meine Besprechung mit Dickie«, sage ich und versuche mich zu erinnern, ob es morgen oder am Freitag ist.
Teddy zeigt keine Reaktion. Er scheint mir gar nicht zugehört zu haben. Apropos Paranoia. Er schaut immer wieder in den Rückspiegel, als hätte er den Verdacht, dass jemand uns verfolgt. Als ich mich umdrehe, bemerke ich, dass uns tatsächlich jemand verfolgt, er klebt an unserer Stoßstange – ein roter Sportwagen, der jetzt auf die linke Spur wechselt, an uns vorbeischießt, um gefährlich dicht und pfeilschnell vor uns einzuscheren und Teddy zu zwingen, auf die Bremse zu treten. Jetzt sehe ich, dass es Paul Rourkes roter Camaro ist, und als der Wagen auf den Standstreifen fährt, folgt Teddy seinem Beispiel, mit vor ohnmächtiger Wut rotem Gesicht. Rourkes Frau, die zweite MrsR., an deren Namen ich mich nie erinnere, sitzt am Steuer, aber sie hat ganz offensichtlich die Anweisungen ihres Mannes befolgt. Normalerweise wirkt sie verträumt und einsilbig, aber hinter dem Lenkrad kommt an ihr etwas Aggressives zum Vorschein. Laut Paul, der lange genug mit der zweiten MrsR. verheiratet ist, um ernüchtert zu sein, ist sie nur dann richtig wach. Häufig braust sie auf dieser Straße nach Allegheny Wells an mir vorbei und bedenkt mich mit einem langen Blick, ehe sie ihn abwendet, allem Anschein nach enttäuscht. Und immer hat sie den gleichen gelangweilten Ausdruck im Gesicht, dem nicht anzumerken ist, ob sie mich erkannt hat.
»Wenn es zu einer Prügelei kommt, nehme ich mir sie vor«, sage ich zu Teddy, der noch immer das Lenkrad umklammert.
»Was zum … hast du das gesehen?«, stößt er hervor. Er sieht zu mir herüber, um sich des gerade Geschehenen zu vergewissern. Wut ist eine der Emotionen, von denen sich Teddy nie sicher ist, ob er sie sich erlauben darf, und er will sich rückversichern, dass es in diesem Moment gerechtfertigt ist.
Rourke steigt träge aus, beugt sich in den Wagen, um zur zweiten MrsR. etwas zu sagen, vermutlich, sie solle sitzen bleiben. Es werde nicht lange dauern. Und das stimmt auch, falls es tatsächlich zu einer Prügelei kommt. Paul Rourke ist kräftig gebaut, und allein schon bei der Vorstellung, mir einen Faustschlag auf meine ohnehin schon verstümmelte Nase einzuhandeln, wird mir schlecht.
Es dauert eine Weile, bis ich mich aus Teddys Civic herausgequält habe. Rourke wartet geduldig und hält mir die Tür auf. Als ich mich aufgerichtet habe, bin ich größer als er, und auch wenn ich dankbar dafür sein kann, ist es in diesem Fall völlig bedeutungslos. Dies ist derselbe Mann, der mich vor einigen Jahren auf unserer Fakultäts-Weihnachtsfeier gegen die Wand geschleudert hat, und die schlechte Nachricht ist, dass es hier weit und breit keine Wand gibt. Wenn er mich jetzt wieder wegschleudert, lande ich im Straßengraben. Die gute Nachricht ist, dass er sich anscheinend damit zufriedengibt, meine demolierte Nase zu betrachten und mich anzugrinsen.
Inzwischen ist auch Teddy ausgestiegen und stößt aufgeregt hervor: »Das war beinahe ein Unfall!« Doch Rourke würdigt ihn nicht einmal eines kurzen Blicks.
»Hallo, Reverend«, sage ich in freundlichem Ton. Als junger Mann war Rourke, bevor er zum Atheismus konvertierte, im Priesterseminar.
»Tut’s noch arg weh?«, möchte er wissen, während er meinen Zinken inspiziert.
»Höllisch«, sage ich, um ihn zufriedenzustellen.
Er nickt wissend. »Gut, das freut mich.«
Als er die Hand hebt, weiche ich automatisch einen Schritt zurück und versuche, nicht zusammenzuzucken. Er hat eine Kamera in der Hand, eine teure, und noch ehe ich mich umdrehen kann, hat er mit einem Klick eine Serienaufnahme ausgelöst.
»So werde ich dich in Erinnerung behalten, wenn du weg bist«, sagte er. Er nickt kaum merklich in Teddys Richtung. »Ihn da werde ich einfach vergessen.«
Dann geht er zu seinem Camaro, der kurz darauf schlingernd auf die Asphaltstraße zurückkehrt, während unter den Reifen kleine Steine aufspritzen. »So, jetzt reicht’s!«, sagt Teddy, schließlich überzeugt davon, dass Wut, nun, da die Gefahr gebannt ist, eine angemessene Emotion für diese Situation ist. »Ich reiche eine Beschwerde über ihn ein.«
Auf der restlichen Strecke die gewundene Straße zu Lilys und meinem Haus hinauf muss ich die ganze Zeit lachen. Schließlich trockne ich mir mit dem Ärmel meines Mantels die Augen. Ich weiß, dass Teddy teils verlegen, teils wütend ist, weil ich durch meine Heiterkeit seine Gefühle herabwürdige. »Ich mein’s ernst«, fügt er hinzu, und schon pruste ich wieder los.
Als Lily fremde Motorengeräusche hört, kommt sie auf die hintere Veranda heraus. Sie trägt Joggingkluft, und ihr Gesicht ist gerötet, als wäre sie gerade von ihrer Laufrunde zurückgekommen. Sie winkt uns zu, und Teddy kann es nicht erwarten auszusteigen, um zurückwinken zu können. Wir sind zu weit weg, als dass sie meine demolierte Nase sehen könnte, aber die Pose, die meine Frau eingenommen hat, die Hände in die schlanken Hüften gestemmt, suggeriert, dass sie auf alles gefasst ist.
»Sieht schlimmer aus, als es ist!«, ruft Teddy.
Während wir uns ihr nähern, beäugt Lily uns misstrauisch und versucht herauszufinden, worauf sich Teddys Bemerkung bezieht. Seit zwanzig Jahren komme ich immer wieder mal mit kleineren Blessuren nach Hause, aber normalerweise befinden sie sich unterhalb des Halses – verstauchter Knöchel, geschwollenes Knie, verrenktes Kreuz und dergleichen. Die samstagmorgendlichen fakultätsinternen Basketball-Matches, die wir austrugen, als wir alle noch miteinander redeten, mündeten häufig in irgendwelchen Verletzungen. Nicht selten waren sie Paul Rourke zu verdanken, der die Punkte anders als wir zu zählen schien.
Folglich hält Lily jetzt Ausschau nach einem Hinken. Einer Schlagseite. Einer leicht gebeugten Haltung. Und da ich mit zur Seite geneigtem Kopf auf sie zugehe, um ihrem Blick den heilen Nasenflügel zu präsentieren, kann sie die Verletzung nicht sehen. Erstaunlich, in Anbetracht der Schwellung. Als wir am unteren Treppenabsatz der Veranda ankommen, bemerkt Teddy mein Täuschungsmanöver, packt mich am Kinn und dreht mein Gesicht nach vorn, um Lily ungehinderte Sicht auf meine Verwundung zu ermöglichen. Ich frage mich, ob Teddy von ihrer Reaktion genauso enttäuscht ist wie ich – lediglich eine hochgezogene Augenbraue, als wollte sie sagen, in Anbetracht meines Charakters sei selbst eine so bizarre Verletzung vorhersehbar gewesen.
»Dieser Mann ist außer Kontrolle«, sagt Teddy bewundernd.
Wir gehen nach drinnen, weil es für Mitte April noch recht kühl ist, und die Temperaturen, sobald die Sonne untergeht, noch stärker fallen. Ich höre Ockham winseln, der aus der Waschküche herausgelassen werden möchte, in den Lily ihn verbannt, wenn er wieder einmal ungezogen war. Als ich die Tür aufmache, springt Ockham, außer sich vor Freude, an mir vorbei, rast wild um die Kücheninsel herum, und seine Krallen kratzen über die Fliesen, doch dann bemerkt er Teddy, der ganz bleich wird. Ockham ist ein großer Hund, ein fast ausgewachsener Weißer Schäferhund, der vor knapp einem Jahr in unserer Auffahrt auftauchte. Lily hörte ihn bellen, und wir gingen auf die Veranda hinaus und sahen auf die Auffahrt hinab, wo der Hund einen merkwürdigen Anblick bot. Er stand mitten auf dem Weg, als hätte man ihm befohlen, dort zu bleiben, aber als bezweifelte er die Sinnhaftigkeit des Befehls. Er sah uns an, als wollte er eine zweite Meinung. »Ich glaube, er will, dass wir ihm folgen«, sagte Lily. »Wo, glaubst du, kommt er her?«
»Wenn er will, dass wir ihm folgen, kommt er aus dem Fernsehen«, sagte ich, aber er sah tatsächlich so aus, wie er dastand und uns anbellte, ohne sich uns zu nähern. Wobei er kurz Anstalten dazu machte, doch dann schien er sich an etwas Schreckliches zu erinnern, bellte erneut, aber in einem anderen Register, wich wieder etwas zurück, nur um das Manöver von vorn zu beginnen.
Wir näherten uns ihm vorsichtig und blieben ein, zwei Meter vor dem Tier stehen, das jetzt heftig mit dem Schwanz wedelte und uns verwegen angrinste.
»Ich habe noch nie einen Hund so grinsen sehen«, sagte Lily. »Er sieht aus wie Gilbert Roland.«
Ein Glitzern im Maul des Hundes hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Ich konnte mir nicht helfen, aber es sah aus, als hätte das Tier einen Goldzahn.
»Du lieber Himmel, Hank«, sagte Lily, »ich glaube, er hat sich in etwas verhakt.«
Und genau das war das Problem des Hundes. Was wie ein Goldzahn ausgesehen hatte, war in Wirklichkeit ein Dreifachangelhaken, der sich in die Lefzen des Hundes gebohrt hatte. Daran hing ein langes Stück Nylon-Angelschnur, das nur zu sehen war, wenn der Hund darauf trat und sie sich spannte, was dieses Gilbert-Roland-artige Grinsen hervorbrachte. Lily hielt den Hund fest, damit ich die Angelschnur entzweibeißen konnte. Er hatte sie an die hundert Meter hinter sich hergezogen, offenbar den ganzen Weg vom See zu uns hinauf, der dreieinhalb Kilometer entfernt liegt. Wir brachten den Hund ins Haus, wo er unter Lilys zärtlichem Streicheln und beruhigender Stimme geduldig wartete, bis ich eine Drahtschere geholt hatte, und er bewegte sich auch nicht, als ich den Stiel abknipste und die Haken entfernte. »Okay«, schien er zu sagen, als er von dem Fremdkörper befreit war. »Und jetzt?«
Wir gaben eine Anzeige auf, machten Aushänge in der ganzen Siedlung, aber kein Besitzer meldete sich, also blieb uns nichts weiter übrig, als das Tier zu füttern und zuzusehen, wie er zu doppelter Größe heranwuchs. Seit seiner Ankunft hatten wir nur wenig Besuch, was Ockham offenbar nicht verstehen kann, wo er Besucher doch so gern mag. Beim Anblick des jetzigen ist er so außer sich vor Freude, dass selbst Lilys erhobene Stimme nicht zu ihm durchdringt, die ihn normalerweise erzittern lässt. Teddy, der Ockham, seit er dem Gesicht-Abschlecken-Stadium entwachsen ist, nicht mehr gesehen hat, reißt schützend beide Arme hoch. Ockham, wie gesagt kein Gesicht-Abschlecker mehr, hat inzwischen eine andere Lieblingsbegrüßung, die er bei allen Fremden anwendet, gleich welchen Geschlechts. Als Teddys Arme nach oben gehen, drückt Ockham seine lange, spitze Schnauze in Teddys Schritt und hebt sie an, so als stellte er sich vor, er hätte Teddy darauf aufgespießt, und wie um diesen Eindruck zu untermauern, reckt sich Teddy gleichzeitig auf die Zehenspitzen.
»Ockham!«, schreit Lily, und diesmal dringt sie durch die hündische Freude durch. Der Hund lässt Teddy wieder herunter und wendet den Kopf, nur um sich einen Hieb mit einer zusammengerollten Zeitung auf die Schnauze einzufangen. Mit einem kläglichen Kläffen quittiert er den abrupten Stimmungsabfall und schleicht angesichts dieser Kränkung mit melodramatisch gesenkten Hüften in Richtung Tür, während er jeden Schritt mit einem weiteren Kläffen begleitet. Meine eigene Schnauze pocht vor lauter Mitleid.
»Braver Hund!«, sage ich und verwirre ihn noch zusätzlich, und schon kommt Ockhams Schwanz zwischen seinen Hinterläufen zum Vorschein und wischt aufgeregt über den Boden.
Während Lily Teddy behutsam zu einem der Hocker lenkt, die um die Kücheninsel herumstehen, bringe ich Ockham auf die Veranda hinaus, wo er geräuschvoll die Stufen hinuntertapst. Sein Plan ist, ein paarmal wild ums Haus herumzurennen, um die Demütigung abzuschütteln. Ich kenne und verstehe meinen Hund gut. Wir teilen einige sehr tief empfundene Gefühle.
Wieder in der Küche, bemerke ich, dass das Blut in Teddys Gesicht zurückgekehrt ist. »Den Trick hat Lily ihm beigebracht«, sage ich und füge hinzu: »Sonst hätte er ihn nie gelernt.«
»Sei froh, dass du schon verletzt bist«, erwidert Lily und scheint es ernst zu meinen. Weil unser Hund Teddy so rüde die Schnauze in den Schritt gedrückt hat, ist sie jetzt verlegen und ringt um Fassung. Sie ist eine Frau, die sich instinktiv um Blessuren kümmert, und nun will sie sich auch irgendwie Teddys annehmen.
»Das hier hat mir übrigens eine gut aussehende Frau angetan«, sage ich.
»Gracie«, informiert Teddy sie augenblicklich.
»Gracie ist keine gut aussehende Frau mehr«, ruft uns Lily ins Gedächtnis. »Seit sie zugelegt hat, bin ich klar die attraktivere von uns beiden.« Lily ist zur Küchentheke gegangen und kommt mit einer Kanne dampfenden Kaffee zurück.
Teddy überlegt, ob er ihr sagen soll, sie sei schon immer attraktiver gewesen. Das kann ich an seinem kläglichen, hilflosen Gesichtsausdruck ablesen. Er öffnet sogar den Mund, schließt ihn aber wieder. Und Lily ist attraktiv, stelle ich fest, während ich sie betrachte. Schlank, sportlich, eine strahlende Erscheinung. Sie läuft jeden Tag zig Kilometer, und sofern sie nach dem Joggen genau so Muskelkater hat wie ich, behält sie es stets für sich, vielleicht weil das Jammern über Schmerzen nach sportlicher Anstrengung ihrer Ansicht nach etwas typisch Männliches ist. Wobei sie im Allgemeinen keine hohe Meinung von männlichem Verhalten hat.
»Was hat sie denn benutzt?«, fragt sie, nachdem sie meinen Zinken in Augenschein genommen hat. »Eine Garnelengabel?«
Als Teddy ihr erzählt, Gracie habe mir eins mit ihrem Notizheft verpasst, und zwar mit dem Ende, wo die Spitze der Spirale herausragte, zuckt Lily zusammen, Beweis dafür, bilde ich mir jedenfalls ein, dass sie immer noch zärtliche Gefühle für mich hegt. Teddy setzt zu einem begeisterten, aber langweiligen Bericht über die Personalausschusssitzung an, die in meine Verstümmelung mündete. Dabei legt er den Fokus auf den Umstand, dass ich Gracie gereizt habe. Alle anderen Details, die selbst ein aus der Übung gekommener Geschichtenerzähler wie ich nicht nur erwähnen, sondern in den Vordergrund stellen würde, lässt er aus. Es ist, als würde ein unmusikalischer Mensch zu singen versuchen und die Melodie immer schiefer geraten, während er unrhythmisch mit dem Fuß den Takt dazu schlägt, in der Hoffnung, mit Überschwang die zunehmend schrägen Töne wettzumachen. Es ist eine Qual, ihm zuzuhören, und ich redigiere währenddessen im Geiste seinen Bericht – strukturiere ihn, mache Randbemerkungen, arrangiere Passagen um, kürze, sorge für neue Akzentuierungen. Ich erwäge sogar, meine eigene Version für den Railton Daily Mirror zu schreiben (den die Einheimischen liebevoll The Rear View nennen). Letztes Jahr habe ich dort unter dem Titel »Die Seele der Universität« und dem Pseudonym Lucky Hank eine Reihe von Gastkommentaren veröffentlicht, lakonische Berichte über den alltäglichen akademischen Wahnsinn. Mit einer Erzählung über die heutige Ausschusssitzung könnte ich die Kolumne wiederbeleben.
Ob sie wiederbelebt werden sollte, sei dahingestellt. Frühere Beiträge haben den Zorn von Verwaltungsbeamten und Kollegen auf sich gezogen, die mich mangelnder Ernsthaftigkeit beschuldigten, ich würde die ohnehin geringe Unterstützung in der Bevölkerung gegenüber der Hochschulbildung zusätzlich untergraben und die Hand beißen, die mich füttere. Launig geschrieben, würde ein Artikel über meine heutige Verstümmelung nicht einmal der Übertreibung bedürfen, um die gewollte satirische Wirkung zu erzielen, wie Teddys umständlicher Bericht beweist, wobei ihm etwas Essenzielles fehlt. Wie ich meinen Studenten zu sagen pflege, steht und fällt eine Erzählung mit der Figurenzeichnung, und Teddys Zusammenfassung vermag nicht ansatzweise zu vermitteln, wie es sich angefühlt hat, in der Haut von William Henry Devereaux jr. zu stecken, als das Ganze eskalierte.
William Henry Devereaux jr. war nämlich kurz vor dem Ersticken. Phineas (Finny) Coomb, der Leiter des Personalausschusses, hatte die Sitzung in einem kleinen, fensterlosen Seminarraum stattfinden lassen. Was nicht weiter verwunderlich ist, da wir nur zu sechst waren. Wobei sich zwei von uns – Finny und Gracie DuBois – schwer einparfümiert hatten, woraufhin William Henry Devereaux jr. dreimal aufgestanden war, um die Tür zu öffnen, die, wie er jedes Mal feststellte, bereits offen stand. Teddy, dessen Frau June und Campbell Wheemer (das einzige Mitglied unseres ergrauenden Fachbereichs mit befristetem Vertrag) schienen im Gegensatz zu William Henry Devereaux jr. alle ihren Würgreflex unter Kontrolle zu haben.
»Ist dir schlecht?«, erkundigte sich Wheemer irgendwann. Er hatte erst vor vier Jahren an der Brown University promoviert und das, was von seinem schütteren Haar übrig war, mit einem Gummiband zu einem Pferdeschwanz gefasst. Kaum trat er seine Stelle an, verschreckte er das Kollegium bei der ersten Fachbereichssitzung des Jahres, indem er verkündete, die Literatur an sich interessiere ihn nicht. Sein besonderes akademisches Interesse gelte der Feministischen Kritischen Theorie und der bildbasierten Kultur. Er zeichnete Fernseh-Sitcoms auf und nahm sie anstelle der »phallozentristischen, symbolorientierten Texte« (Bücher) in seinen Lehrplan auf. Seine Studenten durften nicht schreiben. Ihre Hausarbeiten mussten sie mittels Videokameras erstellen und auf Kassetten abgeben. Wann immer jemand in einer Fachbereichssitzung ein männliches Pronomen benutzte, korrigierte Campbell Wheemer sie oder ihn mit den Worten »oder sie«. Sogar June, Teddys Frau, die ein Jahrzehnt zuvor ihre Liebe zum Feminismus entdeckt hatte, ungefähr zur selben Zeit, als ihr die zu Teddy abhandenkam, ging dieses Gehabe allmählich zu weit. Bald hieß er im Kollegium nur noch »Odersie«.
»Nein, mir geht es gut«, erwiderte ich.
»Du hast so merkwürdige Geräusche gemacht«, erklärte Odersie.
»Wer?«
»Du.« Vier Stimmen pflichten meinem jungen Kollegen bei, die von Finny, Teddy, June und Gracie.
»Du hast … gegurgelt«, führte Odersie aus.
»Ach so, das meinst du«, sagte ich, obwohl ich mir dessen gar nicht bewusst war. Gewürgt, vielleicht, wegen Gracies süßlichem, schwerem Parfüm, aber gegurgelt doch nicht. Lag es an ihrer Nähe in dem kleinen, ungelüfteten Raum, oder hatte sie an diesem Morgen irrtümlicherweise zweimal Parfüm aufgetragen?
Wenn man Gracie heutzutage ansieht, fällt es einem ziemlich schwer, sich zu erinnern, welche Wirkung sie nach ihrer Einstellung vor zwanzig Jahren auf uns ausgeübt hatte. Sie war wie eine dieser Revuetänzerinnen gewesen in schwarzen Netzstrümpfen und kurzem Frack und mit Zylinder, die von einem Trupp männlicher Tänzer auf schwitzenden Händen über deren Köpfen balanciert wird. Wie Jacob Rose, damals unser Bereichsleiter und heute Dekan, gern bemerkte, wollten alle Männer sie vögeln, nur Finny nicht – der wäre gern sie gewesen. Das war damals. Ich bezweifle, dass wir sie heute noch über unseren Köpfen balancieren könnten. Wir sind nicht mehr die Männer, die wir einmal waren, und Gracie ist doppelt so viel, wie sie einmal war. Das Traurige ist, jeder braucht Gracie bloß anzuschauen (oder, in meinem Fall, einen Schwall ihres Parfüms einzuatmen), um zu wissen, dass sie noch immer gern diese Frau wäre. Und, verdammt, wir verstehen es. Wir wären auch gern noch diese Männer.
»Würdest du aufhören, mich anzustarren?« Gracie hatte sich aufgebracht zu mir gewandt. »Und würdest du aufhören, ständig so zu schnuppern?«
»Wer?«, fragte ich.
»Du!« Vier Stimmen. Finnys, Teddys, Junes und Odersies.
»Hat der Bereichsleiter etwas Neues bezüglich unserer Suche zu berichten?«, fragte Finny. Finny trug exakt das Gleiche wie an jedem anderen Tag seit Ende der Frühlingsferien, einen weißen Leinenanzug und eine rosa Krawatte, die seine jüngst erworbene karibische Bräune besonders gut zur Geltung brachte. Vor einigen Jahren hat er sein weißes Haar zu einer buschigen Mähne wachsen lassen und ein Farbporträt von Mark Twain in seinem Büro aufgehängt, neben das er sich gern postiert.
»In der Schwebe«, berichtete ich. Unsere Suche nach einem neuen Fachbereichsleiter verlief ziemlich genau so, wie es zu erwarten war. Im September hatten wir grünes Licht für die Suche bekommen. Im Oktober wurden wir daran erinnert, dass es noch kein Budget für diese Position gab. Im Dezember erlaubte man uns zähneknirschend, eine engere Auswahlliste an Kandidaten zu präsentieren und im Rahmen unserer Sitzung dann Auswahlgespräche zu führen. Im Januar wurde uns untersagt, auswärtige Kandidaten auf den Campus einzuladen. Im Februar erinnerte man uns an den Einstellungsstopp und dass niemand uns garantieren könne, es werde für uns eine Ausnahme gemacht, auch nicht bei der Neubesetzung der Bereichsleiterposition. Im März hatten bis auf sechs alle der noch zur Wahl stehenden Kandidaten inzwischen entweder eine andere Stelle angenommen oder beschlossen, besser dort zu bleiben, wo sie waren, statt sich mit Leuten einzulassen, die eine solch chaotische Personalsuche betrieben. Im April riet uns der Dekan, unsere Auswahl auf drei Kandidaten einzugrenzen und ein Ranking vorzunehmen. Aber die Liste einzugrenzen war nicht mehr nötig. Inzwischen waren von den anfänglichen zweihundert Namen nur noch drei übrig.
»Macht der Dekan Druck?«, wollte Finny wissen. Das herauszufinden sollte mir doch eigentlich gelingen, in Anbetracht meiner Freundschaft mit Jacob Rose, schien er sagen zu wollen. Nach Ansicht von Finny ist die Tatsache, dass ich keine neuen Informationen habe, Beweis dafür – sollte es dessen noch bedürfen –, dass ich die Suche nach einem neuen Bereichsleiter im Sande verlaufen lassen will, da ich von Anfang an nicht dafür war. Ich habe nie einen Hehl aus meiner Meinung gemacht: Da unser Fachbereich heillos zerstritten ist und wir einander Jahr für Jahr immer misstrauischer beäugen, wollen einige diese Position lieber mit einer außenstehenden Person besetzen, um zu verhindern, dass jemand von uns nach der Macht greift. Wir suchen also weniger eine neue Bereichsleitung als ein Blutopfer. Und weil Finny meine dezidierte Haltung kennt, vermutet er, dass der Dekan und ich insgeheim bestrebt sind, nicht nur diese Suche, sondern auch die demokratischen Prinzipien unseres Fachbereichs zu untergraben.
»Ich glaube, es wäre zutreffender zu sagen, dass der Dekan selbst mehr Druck bekommt, als er ausübt«, erwiderte ich.
»Er ist ein Weichei«, sagte June, obwohl auch sie und Teddy mit Jacob befreundet sind.
»Oder sie«, warf ich aus keinem bestimmten Grund ein.
Odersie blickte verwirrt auf: Das war doch sein Satz. Hatte er eine Gelegenheit verpasst, ihn anzubringen?
»Warum sind wir eigentlich hier?«, fragte Teddy völlig unphilosophisch. »Warum warten wir nicht, bis die Besetzung der Position abgesegnet worden ist, bevor wir ein Kandidatenranking vornehmen? Das kostet uns womöglich etliche Stunden, obwohl niemand weiß, ob sie die Stelle morgen nicht wieder einkassieren, und dann hätten wir einfach nur unsere Zeit vergeudet.«
»Der Dekan will aber, dass wir ein Kandidatenranking vornehmen«, sagte Finny und betonte jedes Wort, »also tun wir das jetzt.«
Nachdem der gesunde Menschenverstand in die Wüste geschickt worden war, folgte eine endlose Diskussion über die drei verbliebenen Kandidaten. Zwei weitere Male musste ich gebeten werden, damit aufzuhören, gurgelnde Geräusche von mir zu geben. Drei weitere Male kam ich Campbell Wheemer mit seinem »Oder sie«-Satz zuvor. Derweil schien sich niemand mehr erinnern zu können, was wir an diesen drei Kandidaten ursprünglich so anziehend gefunden hatten. Wobei ich bezweifle, dass sie je eine Anziehungskraft auf uns ausgeübt hatten. Sie waren einfach das, was übriggeblieben war, nachdem wir alle Bewerber, die uns persönlich hätten gefährlich werden können, aussortiert hatten. Jemand Hochkarätiges einzustellen hieße, Vergleichen mit uns, die wir nicht hochkarätig waren, Tür und Tor zu öffnen. Nicht dass diese Logik je ausgesprochen worden wäre. Lieber erinnerten wir uns gegenseitig daran, wie schwierig es war, Kandidaten mit hervorragenden Qualifikationen zu bekommen. Erschwerend kam hinzu, dass wir jedem guten Kandidaten gegenüber misstrauisch waren, der sein Interesse an uns bekundete. Wir argwöhnten, dass derjenige (oder diejenige!) möglicherweise gerade in Gehaltsverhandlungen mit der Institution steckt, bei der er (oder sie!) zurzeit angestellt ist, und alternative Angebote nur als Hebel für die eigene Verhandlungsposition gegenüber dem Dekan benutzen will.
Nachdem Gracie beim dritten Bewerber eine alarmierende Entdeckung gemacht hatte, war sie erpicht darauf, die verbleibenden Bewerber auf zwei zu stutzen. »Professor Threlkind ist in Anbetracht unserer gegenwärtigen Struktur ein ungeeigneter Kandidat«, hob sie hervor. Sie stützte sich bei ihren Ausführungen auf Notizen in ihrem großen Spiralheft. Im Lauf der Sitzung hatte sie der Spirale so zugesetzt, dass ein Ende platt gedrückt hervorragte, und nun benutzte sie dieses gefährliche Werkzeug, um himbeerfarbene Lackreste vom Daumennagel zu kratzen. »Wir sind in Sachen zwanzigstes Jahrhundert schon überbesetzt. Außerdem brauchen wir nicht unbedingt einen zweiten Dichter in unseren Reihen«, fügte sie hinzu, hatte der betreffende Kandidat doch bereits mehrere Gedichte in kleineren Literaturzeitschriften veröffentlicht.