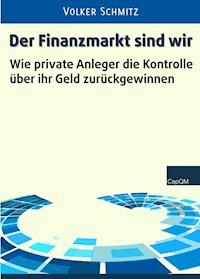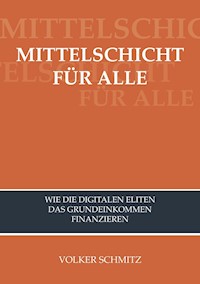
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vor der Digitalisierung gibt es kein Entkommen. Verschwindet die Arbeit, spaltet sich die Mittelschicht in Digitalisierungsgewinner und eine Masse von Verlierern. Und die benötigt einen neuen Sozialstaat. Genug Geld wird da sein, dank Robotern und künstlicher Intelligenz. Doch auf die Solidarität der zukünftigen Eliten ist kein Verlass. Für die Mittelschicht eine historische Herausforderung: Sie muss für sich und ihre Kinder die Teilhabe am Wohlstand und Fortschritt sichern, während ihre wirtschaftliche Bedeutung sinkt. Solange sie sich liberale Demokratie und Rechtsstaat nicht aus den Händen nehmen lässt, wird sie auch künftig ein freies Leben genießen – in Wohlstand ohne oder in Reichtum mit Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mittelschicht für alle
Wie die digitalen Eliten das Grundeinkommen finanzieren
Volker Schmitz
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright © CapQM GmbH, Hamburg 2019
CapQM GmbH
Baumwall 7
20459 Hamburg
www.capqm.com
Inhalt
Einleitung
1. Der Weg in die digitale Massenarbeitslosigkeit
2. Von der Kooperation zur Alimentation
3. Wenn die Arbeit nicht mehr zu retten ist
4. Mit Bildung den Abstieg hinausschieben
5. Endstation Bodensatzwirtschaft
6. Der digitale Sozialstaat: Inklusion ohne Arbeit?
7. Geld ist vorhanden
8. Die Eliten arbeiten lassen
9. Demokratie: nicht verwässern, sondern verteidigen!
10. Transformation statt Apokalypse: die Zukunft der Mittelschicht
Über den Autor
Anmerkungen
Einleitung
Ein Menschenaffe nimmt einen Knochen und schleudert ihn triumphierend in die Luft. Dort verwandelt er sich plötzlich in ein Raumschiff. Diese Filmszene ist die wohl kürzeste Zusammenfassung der gesamten menschlichen Technologiegeschichte.1 Sie entstammt dem Science-Fiction-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum“. Gedreht wurde er 1968. Der Fortschrittsglaube der westlichen Industriegesellschaften war noch ungebrochen, Wachstum, Vollbeschäftigung und immer neue Konsumgüter galten als selbstverständlich. Doch der Regisseur Stanley Kubrick spielt im Verlauf des Films schon mit unseren heutigen Ängsten. HAL, der Steuerungsroboter des Raumschiffs, schwingt sich zu dessen Herrscher auf und der letzte Astronaut muss mit ihm um sein Leben kämpfen.
Inzwischen haben wir das Jahr 2001 längst hinter uns gelassen, um unser Leben müssen wir noch immer nicht fürchten. Aber die Angst vor den Robotern und der künstlichen Intelligenz wächst. Täglich übernehmen sie mehr Funktionen auf dem Raumschiff Erde. Nicht unsere physische Existenz ist in Gefahr, aber unser soziales Leben. Die Digitalisierung verdrängt die menschliche Intelligenz, menschliche Entscheidungsbefugnis und, gesellschaftlich am brisantesten, die tägliche Arbeit. Wenn immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen ohne das gute neue entstehen, zerbricht eine uralte Regel menschlicher Gesellschaften: der Zusammenhang zwischen Jagen und Teilen durch die Kooperation innerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Schon heute findet die Mehrheit der Bevölkerung die Verteilung der wirtschaftlichen Gewinne ungerecht.2 Die Digitalisierung wird dieses Gefühl auf die Spitze treiben. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 2018 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor der versammelten globalen Elite die Themen Digitalisierung und Verteilung als die größte Herausforderung bezeichnet.3 Völlig zu Recht. Genau an diesem Punkt setzt das Buch an. Es handelt von Digitalisierung und Verteilung, vor allem von der Verteilung durch die Digitalisierung. Die Wirkung der neuen Technologien auf die Einkommensverteilung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die jetzt arbeitende Generation und ihre Kinder stehen in seinem Mittelpunkt. Es greift die aktuelle Zukunftsangst der westlichen Mittelschicht auf, die fürchtet, dass die Digitalisierung die wirtschaftliche Ungleichheit weiter verschärft, ihre Arbeit verschwinden lässt und ihren sozialen Abstieg zementiert.
Dabei geht es nicht um eine weitere Utopie oder Dystopie. Der schnelle technologische Fortschritt der vergangenen Jahre hat das Thema aus dem Bereich der Science-Fiction zu den Trendforschern, Philosophen und sogar zu futuristisch gewandelten Historikern gespült. In deren weit ausgreifenden Zukunftsszenarien sind wir irgendwann alle nachhaltig4oder nutzlos, beherrscht von Algorithmen und biotechnologisch optimierten Übermenschen.5 Dazwischen liegt ein großer, allerdings bisher mit wenig futuristischer und sozialer Fantasie ausgefüllter Raum. Manche mögen dies für weitgehend irrelevant halten, da wir nach dem Anthropozän ohnehin von der Weltbühne abtreten. Doch die heutige Generation und ihre Kinder, die sich innerhalb der nächsten 50 Jahre mit der politischen Gestaltung der Digitalisierung auseinandersetzen müssen, werden mit weit praktischeren Fragen konfrontiert sein. Sie müssen in den Niederungen des Alltags um ihren Anteil am wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt kämpfen. Dieser Kampf, die Fortsetzung des uralten menschlichen Verteilungskampfs, wird sich in der kommenden digitalen Gesellschaft möglicherweise deutlich verschärfen. In den folgenden Kapiteln betrachten wir, mit welchen Mitteln er zukünftig ausgetragen wird. Doch vorher wollen wir einen Blick auf die heutige Ausgangssituation werfen, auf die die Digitalisierung trifft.
Die Geschichte von Neoliberalismus und Globalisierung hat ausgedient
Im Jahr 1944, als der Sieg des freien Westens über den Faschismus absehbar wurde, veröffentlichte Friedrich A. von Hayek, ein Vordenker der neoliberalen Marktwirtschaft, in London seinen prophetischen Bestseller „Der Weg zur Knechtschaft“.6 Er sollte die zukünftigen Siegermächte mahnen, nicht nach Kriegsende den Weg des Sozialismus und der Planwirtschaft zu gehen. Sein Ideal war die freie Marktwirtschaft für freie Menschen, mit so wenig staatlicher Regulierung wie nötig. Doch Hayeks neoliberale Ansicht passte nicht zu den gesellschaftlichen Herausforderungen der Nachkriegszeit. Im demokratischen Teil Europas hielt der Staat seine schützende Hand über die Bevölkerungen der vom Krieg zerstörten Länder. Die Sozialstaaten expandierten, die Schlüsselbranchen der Wirtschaft blieben öffentliches Eigentum. Das Wirtschaftswunder der 1950er- und 1960er-Jahre sorgte dafür, dass die Massen konsumieren konnten und die Einkommen breit verteilt wurden. Der Neoliberalismus blieb eine „kleine fundamentalistische Sekte“7.
Doch dann kam seine historische Chance. Die Ölstaaten forderten einen Teil vom westlichen Wohlstand, das Wirtschaftswachstum verebbte, die Geldentwertung nahm zu. Die westliche Wirtschaft befand sich im Krisenmodus, die herrschende Wirtschaftstheorie hatte weder Erklärung noch Lösung. 1974 erhielt Hayek den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, der Neoliberalismus wurde damit hoffähig. Konservative Politiker wie der US-Präsident Ronald Reagan und die britische Premierministerin Margaret Thatcher übernahmen in den 1980er Jahren seine Rezepte, um die Krise zu überwinden. Zusammengefasst in dem berühmten Motto „so etwas wie Gesellschaft gibt es nicht“8 wurde der Markt zum zentralen Lösungsmechanismus für fast alle wirtschaftlichen und sozialen Probleme. Die Arbeitsmärkte wurden flexibilisiert, öffentliche Unternehmen privatisiert, die Finanzmärkte dereguliert.
Innerhalb des Westens wurden die Sozialstaaten kräftig umgestaltet. Nicht nur von den Konservativen. Die US-Demokraten unter Bill Clinton, New Labour in Großbritannien unter Tony Blair und die Sozialdemokraten in Deutschland unter Kanzler Schröder setzten die Sozialstaatsreform in abgemilderter Form fort. Sie war angeblich alternativlos und wer anders dachte, konnte sich vom Internationalen Währungsfonds, der OECD und der EU eines Besseren belehren lassen.
Hayek, gestorben 1992, hat den beginnenden Siegeszug des Neoliberalismus gerade noch miterlebt. Dessen Vertrauenskrise nicht mehr. 2008 brach die US-Bank Lehman Brothers zusammen, der symbolische Startschuss für die weltweite Finanzkrise. Bald darauf folgte die Eurokrise, Griechenland hing jahrelang am Tropf der westlichen Geldgeber. 2013 veröffentlichte der französische Ökonom Thomas Piketty sein Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ und brachte die seit Jahren steigende Einkommensungleichheit auf die politische Agenda.
Über dreißig Jahre hatte der Neoliberalismus seine historische Chance. Doch die Erwartungen der westlichen Mittelschicht hat er nicht erfüllt. Nach Jahrzehnten mit Deregulierung, Privatisierung und Sozialstaatsabbau wissen wir es besser. Die Kosten der Finanzkrise bezahlte die Mittelschicht mit Arbeitsplatzabbau, Zinsverlusten und ihren Steuergeldern. Privatisierungen ehemals öffentlicher Leistungen führten nicht immer zu niedrigeren Preisen und besserem Service, sondern oft zum Gegenteil. Dafür fast immer zu guten Gewinnen für die Investoren. Die Drosselung des sozialen Wohnungsbaus in vielen europäischen Städten ist ein warnendes Beispiel. Den Umbau der Wohlfahrtsstaaten zu „aktivierenden Sozialstaaten“ betrachten viele Betroffene nicht als einen Gewinn an Menschenwürde und Teilhabe, sondern als unwürdige Gängelung und Überwachung durch Jobcenter und kleinteilige Vorschriften.
Vom Neoliberalismus profitiert haben vor allem die Bevölkerungskreise, die über sehr gute Ausbildungen verfügen, Vermögen besitzen und in den richtigen Branchen beschäftigt sind. Der Oxford-Professor Jan Zielonka, ein überzeugter Liberaler, kommt zu dem Schluss: „Im Liberalismus sagen Minderheiten – professionelle Politiker, Journalisten, Banker und Jetset-Experten – Mehrheiten, was das Beste für sie ist.“9 Der Neoliberalismus hat sich als Elitenprojekt herausgestellt. Für weite Teile der westlichen Mittelschicht hat er seine Versprechungen nicht gehalten. Sie wurden wirtschaftlich abgehängt, die Ungleichheit ist massiv gestiegen. „Es gibt keine ernst zu nehmende Chance für Gleichheit ohne von der neoliberalen Wirtschaft Abstand zu nehmen“10, so Zielonka.
Gesteigert wurde die Wirkungsmacht des Neoliberalismus durch die Globalisierung. Sie hat die soziale Schieflage in den westlichen Ländern weiter verschärft. Als 1991 die Sowjetunion zerfiel und mit ihr die zentrale planwirtschaftliche Gegenmacht des Westens, trat der Neoliberalismus seinen globalen Siegeszug an. Die gesamte Weltwirtschaft wurde zum Experimentierfeld. Das Ziel: die Marktwirtschaft international verbreiten und die ganze Welt in einen freien Markt verwandeln. Zunächst halfen neoliberale westliche Ökonomen in den zersplitterten Resten der ehemaligen Sowjetunion, ganze Volkswirtschaften nach ihren marktwirtschaftlichen Lehrbuchmeinungen umzugestalten. Ohne ausreichende Vorbereitung und ohne viel Rücksicht auf deren historische, kulturelle und soziale Besonderheiten. Um die Globalisierung voranzubringen, gründete man 1995 die Welthandelsorganisation, der inzwischen 164 Länder angehören.11 2001 folgte der entscheidende Durchbruch, China wurde indas Welthandelssystem aufgenommen.
Um den westlichen Bevölkerungen die Sorgen vor dem internationalen Wettbewerb zu nehmen, wurde überall der Schlachtruf der Freihändler propagiert: Internationaler Handel nützt allen. „Keine Angst vor der Globalisierung“ lautete der Titel eines Buchs von Christa Müller und Oskar Lafontaine, dem früheren deutschen Finanzminister. Sie glaubten nicht, dass eine Milliarde Chinesen nur darauf warteten, den deutschen Beschäftigten die Arbeit wegzunehmen.12
Heute wissen wir mehr. Die Globalisierung hat in den asiatischen und südamerikanischen Ländern Hunderte Millionen von Menschen aus der Armut gehoben und eine neue Mittelschicht geschaffen. Der US-Konzern Apple stellte 2007 sein Smartphone vor. Zehn Jahr später beschäftigte er mehr als 120.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sein asiatischer Zulieferer Foxconn über eine Million. Eine ungezählte Masse westlicher Arbeitsplätze ist im Tausch gegen preiswerte Flatscreens, Laptops und Mobiltelefone nach Asien verschwunden. Die Globalisierung hat nicht nur neue, gut bezahlte Arbeit im Westen geschaffen, sondern auch Millionen von Beschäftigten in den westlichen Industrieländern die Jobs gekostet, Einkommen stagnieren lassen und Abstiegsängste geschürt.13 Doch die Befürworter des freien Welthandels wollen noch mehr Globalisierung. Sie argumentieren, dass die Globalisierung einfach noch nicht weit genug gegangen sei. „In Wirklichkeit ist die Globalisierung nicht Schuld“, behauptet die Ökonomin Dambisa Moyo. „Die Politik hat sich mit einer Globalisierung-Lite zufrieden gegeben, statt voller Globalisierung die echte Chance zu geben „alle Boote zu heben“. Globalisierung macht Märkte effizienter, steigert den Wettbewerb und verteilt den Wohlstand gleichmäßiger über die Welt. Das ist das Versprechen der vollen Globalisierung.“14Doch für die Millionen westlicher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch die Globalisierung ihre Arbeitsplätze verloren haben, ist es kein Trost, dass der Wohlstand gleichmäßiger über die Welt verteilt wurde. Sie werden dem Versprechen einer noch weitergehenden Globalisierung keinen Glauben mehr schenken.
Nach Jahrzehnten von Neoliberalismus und Globalisierung herrscht innerhalb der westlichen Bevölkerung Zukunftsskepsis. Unter der neoliberalen Ägide ist das wirtschaftliche Wachstum im Westen verkümmert. Während nach dem Zweiten Weltkrieg jährliche Wachstumsraten und Einkommenssteigerungen von fünf bis sechs Prozent als selbstverständlich erschienen, ist das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in der Eurozone in den vergangenen zehn Jahren auf weniger als ein Prozent geschrumpft. Der Massenkonsum hat seine schädliche Kehrseite, die Umweltverschmutzung, gezeigt. Irreversible Klimaschäden sind die Folge. Doch die Staaten der Welt, die sie global verschmutzt haben, können sich nicht auf eine tragfähige Lösung einigen, um sie global zu bekämpfen, noch nicht einmal die bisherigen Vereinbarungen einhalten. Nach 1991 schoss die Zahl der demokratischen Staaten in der Welt nach oben. Seit zwölf Jahren befindet sich die Demokratie nach Untersuchungen der US-Organisation Freedom House weltweit im Rückwärtsgang.15 Viele Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, und nicht nur sie, haben sich von der Demokratie wieder abgewandt. Der ehemals solide westliche Block zeigt zunehmende Risse. Die Migrationsfrage spaltet Europa. Der Brexit trennt Großbritannien vom Kontinent. Der amerikanische Schutzschild für Europa wird zweifelhafter, obwohl seine Notwendigkeit gerade wieder steigt. Die Globalisierung ist umstritten. Waren es bis vor kurzem noch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die in Europa gegen das geplante transatlantische Handelsabkommen TTIP auf die Straße gingen, ist jetzt die US-Regierung selbst nicht mehr daran interessiert, hält das globale Handelssystem für unfair gegenüber den USA. Gleichzeitig wird die wirtschaftliche und politische Macht Asiens in der Welt immer spürbarer. China verteidigt selbstbewusst seine wirtschaftlichen und politischen Interessen, geopolitisch verschieben sich die Gewichte von West nach Ost. Wer hätte 1991 vorausgesagt, dass im Jahr 2017 ein chinesischer Staatspräsident von den westlichen Topmanagern beim Weltwirtschaftstreffen in Davos dankbar beklatscht wird, weil er sich, anders als die USA, für den Welthandel stark macht? Kein Wunder, dass im Westen der Fortschrittsglaube der Nachkriegszeit verflogen ist.
Der technokratische Mainstream aus Wirtschaft und Politik, vor 30 Jahren mit großen Versprechungen gestartet, befindet sich in der Krise. Nicht mehr in der wirtschaftlichen, sondern in der Legitimationskrise. Neoliberalismus und Globalisierung haben sich nicht als nutzlos erwiesen, im Westen jedoch vorrangig als Elitenprojekt. Sie haben die westlichen Gesellschaften gespalten, wirtschaftlich, sozial und politisch. Nie war die Einkommensungleichheit seit dem Zweiten Weltkrieg so extrem, nie die Unterschiede zwischen Stadt und Land, nie die politische Landschaft. Die wirtschaftlichen und politischen Eliten befinden sich nicht nur in der Defensive, sie verfügen auch über keine Vision, diese Krise durch ein großes gesellschaftliches Projekt für die Zukunft zu überwinden. Die alten Geschichten haben ausgedient, eine neue ist noch nicht entstanden.
Mit Digitalisierung zum exponentiellen Neoliberalismus
Auf diese schwierige wirtschaftliche und politische Konstellation trifft jetzt mit zunehmender Wucht die Digitalisierung. Nach einem langsamen Start über Großrechner, Personal Computer und Internet durchdringt sie nun Wirtschaft und Gesellschaft immer schneller. Mobiltelefone, weltumspannende soziale Netzwerke, Handelsplattformen, Roboter und künstliche Intelligenz schälen sich nicht nur als technologische, sondern auch als gesellschaftliche Revolution heraus. Vorangetrieben von marktbeherrschenden IT-Unternehmen schaffen sie neue Chancen, aber auch Gefährdungen.
Ihre Chancen erleben wir konkret anhand der neuen Produkte und Apps, die mittlerweile im Tagesrhythmus auf den Markt kommen. Wir erfahren aber auch, wie sie blitzschnell ganze Branchen umkrempeln kann und mit ihnen unsere Arbeitsplätze. Suchmaschinen und soziale Netzwerke haben innerhalb weniger Jahre die Printmedien in eine Existenzkrise gestürzt und damit auch unzählige Journalisten. Online-Shopping revolutioniert mit unserer Unterstützung den klassischen Einzelhandel. Kleine Läden kämpfen um ihr Überleben. Einkaufszentren auf der grünen Wiese verzeichnen Leerstände. Die nächste große Umwälzung wird im Automobilbau und in der Logistik stattfinden. Jede neue Pressemeldung über die Fortschritte des autonomen Fahrens führt den Truckern und Taxifahrerinnen der Welt vor Augen, dass es ihren Arbeitsplatz bald nicht mehr geben wird. Langsame Anpassung hilft nicht mehr, für die Betroffenen geht es um 100 Prozent oder gar nichts. Die Digitalisierung zerstört nicht nur etablierte Geschäftsmodelle, sie vernichtet auch damit verbundene Arbeit.
Tatsächlich ist die Digitalisierung nicht einfach der Beginn einer neuen wirtschaftlichen und sozialen Phase nach Neoliberalismus und Globalisierung. Sie bringt alle Voraussetzungen mit, sie auf die Spitze zu treiben. Beide haben sich mit geringen Ergebnissen bemüht, das wirtschaftliche Wachstum im Westen anzukurbeln. Sehr viel erfolgreicher waren sie jedoch darin, in vielen Staaten den Anteil der Arbeitsentgelte am Volkseinkommen zurückzudrehen, zum Vorteil der Unternehmensgewinne. Besonders seit den 1980er-Jahren ist die Lohnquote in den meisten Industrieländern massiv gefallen.16 Mit Beginn der intensiven Globalisierung um die Jahrtausendwende zeigte der Trend in vielen Staaten noch einmal deutlich nach unten. Die Relationen wurden weiter zugunsten der Unternehmensgewinne verschoben. In den USA lag der Anteil der Löhne und Gehälter 2011 auf dem niedrigsten Niveau der Nachkriegszeit17, in Deutschland war er 2017 wieder auf das Niveau von 1970 gesunken18. Die Digitalisierung hat das Potenzial, diese Entwicklung exponentiell zu beschleunigen. Neoliberalismus und Globalisierung haben ihr die Wege geebnet, alle Grenzen niedergerissen. Um dem Neoliberalismus zu seinen umstrittenen Erfolgen zu verhelfen, mussten noch innerstaatlich Gesetze geändert und Regulierungen abgebaut werden. Für die Digitalisierung gab es von Anfang an praktisch keine. Die Globalisierung musste in langwierigen internationalen Abstimmungsprozessen herbeigeredet werden. Das Internet setzte sich fast automatisch über alle Grenzen hinweg. Private Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft konnten und können die Digitalisierung ungehindert vorantreiben. Ohne innerstaatliche Regulierung und globale Übereinkünfte wird sie einem Virus gleich, der auf ein völlig geschwächtes Immunsystem stößt, blitzschnell die Welt erobern. Am Ende könnte ein Neoliberalismus im exponentiellen Tempo der Digitalisierung stehen.
Heute, 75 Jahre nach Erscheinen von Hayeks Buch, wächst die Gefahr, dass die neoliberalen Eliten selbst den Rest der Gesellschaft auf den Weg in die Knechtschaft führen. Nicht willentlich, aber wissentlich. Nicht durch Kommunismus, Totalitarismus und staatliche Planwirtschaft. Sondern durch die Befreiung der Massen von guter Arbeit, eigenem Einkommen und gesellschaftlichem Einfluss. Planvoll gesteuert werden sie dennoch. Nicht mit Zwang, sondern durch Überredung. Mittels Informationsselektion und Werbung, die den Einzelnen ihre Bedürfnisse nicht vorschreiben, sondern für sie vorausahnen. Die Pointe der Geschichte der neoliberalen Angst vor der sozialistischen Planwirtschaft wäre dann die nahezu in Echtzeit digital gesteuerte Marktwirtschaft, verwaltet nicht von Funktionären, sondern den Eigentümern der Algorithmen. Sie würden den Trend gegen die bezahlte Arbeit weiterführen, in nie gekannte Tiefen. Im Westen, indem sie die breite Mittelschicht ausdünnen und einem unvorbereiteten Sozialstaat überantworten. Im Rest der Welt, indem sie die hoffnungsvoll aufstrebenden Mittelschichten, die noch nicht einmal das westliche Einkommensniveau erreicht haben, in ihrer Entwicklung stoppen. Ohne dass diese überhaupt Zeit hatten, angemessene soziale Absicherungssysteme aufzubauen.
Der gute alte Sozialstaat ist überfordert
Wie schnell wird die Arbeit verschwinden? Von der altehrwürdigen Universität Oxford ging schon 2013 ein Weckruf aus, der durch alle westlichen Industrieländer hallte. In den nächsten 10 bis 20 Jahren werden 47 Prozent der Arbeitsplätze in den USA durch Roboter und künstliche Intelligenz relativ leicht ersetzbar sein. Dies prognostiziert eine Studie der Autoren Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne von der Oxford Martin School.19 Die Untersuchung der beiden Forscher enthält konkrete Vorhersagen für eine Vielzahl einzelner Berufe. Sie erzielte ein weltweites Medienecho und setzte in kurzer Zeit viele nationale und internationale Nachprüfungen und Gegenrechnungen in Gang. Regierungsinstitute, Arbeitsmarktforscher und internationale Unternehmensberatungen veröffentlichten in immer kürzeren Abständen neue Studien, die zu ähnlichen oder deutlich weniger dramatischen Ergebnissen kamen.
Wenn es eine Quintessenz aller Studien gibt, dann die: Niemand kann heute vorhersagen, wie schnell die digitale Disruption den Arbeitsmarkt umgestalten und wie weit sie gehen wird. Vor allem zwei entscheidende Fragen sind völlig offen: Werden mindestens so viele neue Jobs geschaffen wie alte verschwinden? Und: Welcher Anteil dieser neuen Arbeitsplätze wird hochqualifiziert und gut bezahlt sein, welcher nur Niedriglohnjobs für Geringqualifizierte bieten? Das fehlende Wissen wird häufig durch Glaubensakte ersetzt. Immer wieder wird zur Beruhigung auf die historische Tatsache verwiesen, dass bisher noch jede industrielle Revolution – und um nichts anderes handelt es sich bei der Digitalisierung – mehr und besser bezahlte Arbeitsplätze geschaffen hat als es vorher gab. Die Nachkommen der Weber, die einst Aufstände gegen die neuen Textilmaschinen starteten, können heute als gut bezahlte IT-Fachkräfte und Marketingexpertinnen arbeiten. Vergessen wird dabei allerdings, dass es in den Übergangsphasen auch erhebliche und lang andauernde gesellschaftliche Verwerfungen gab. Dauerarbeitslosigkeit, schlechtere Arbeitsbedingungen, sozialer Abstieg und Armut wurden für Millionen Menschen in diesen Umbruchzeiten zur bitteren Realität. Wie in jeder Revolution zahlten ihre Opfer den Preis für die Veränderung. Bäuerinnen wurden zu schlecht bezahlten Arbeiterinnen, freie Handwerker gingen als Facharbeiter in die Fabriken, die Chancenlosigkeit trieb viele Jüngere in die Emigration. Die Geschichte bietet keinen eindeutigen Wegweiser für die Digitalisierung. Der Blick zurück auf die industriellen Umbrüche des 19. Jahrhunderts spendet keinen Trost für die Erwerbstätigen, die fürchten ihr zukünftig zum Opfer zu fallen. Von den menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen zu Beginn des Manchester-Kapitalismus bis zu den Anfängen des modernen Sozialstaats brauchte es rund 150 Jahre.
Aber haben wir heute nicht völlig andere Verhältnisse? Zumindest in den alten europäischen Industriestaaten wurde der Sozialstaat nach dem Zweiten Weltkrieg fest verankert. In Deutschland hat er ebenso wie der Rechtsstaat sogar Verfassungsrang.20 Tatsächlich wird dies die entscheidende soziale Frage der Digitalisierung werden: Kann der Sozialstaat die zu erwartenden sozialen Umbrüche und Risiken der Digitalisierung ausreichend kompensieren? Oder wird er sich unter der Last des Abstiegs und Zerfalls der Mittelschicht als Schönwetter-Sozialstaat entpuppen? Bereits in den 1990er Jahren wurde er als Antwort auf die Langzeitarbeitslosigkeit und den demografischen Wandel reformiert. Als Reaktion auf eine Massenarbeitslosigkeit muss er bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet werden. Kritiker finden ihn heute schon zu teuer. Manche halten ihn nicht mehr für zeitgemäß und fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sicher ist: Die Gefährdung der Arbeit durch die Digitalisierung wird unweigerlich den Sozialstaat, die zentrale soziale Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, auf den Prüfstand stellen. Wenn er den Einzelnen nicht genug Teilhabe ermöglicht und der Gesellschaft nicht genug Zusammenhalt, wird sein Versagen unweigerlich die europäischen Demokratien mit in den Abgrund reißen.
Kommt es zu einer anhaltenden Massenarbeitslosigkeit, stehen die westlichen Gesellschaften, insbesondere die alten europäischen Industriestaaten, vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Ein Blick zurück zeigt warum. Mitte der 1990er Jahre war die Arbeitslosigkeit in Europa auf zehn Prozent angestiegen. Schon diese Arbeitslosenquote wollten die Beschäftigten der Mittelschicht und die Unternehmen nicht durch Dauerzahlungen auffangen. In den Jahren danach wurden die Sozialsysteme in vielen europäischen Staaten reformiert. „Nachhaltige soziale Gerechtigkeit durch einen aktiven Wohlfahrtsstaat“ nannte sich das neue Konzept der Europäischen Union.21 Die Unternehmen und ihre Beschäftigten wurden entlastet, dafür den Arbeitssuchenden neue Pflichten auferlegt und ihre Bezüge gekürzt. Rentenreformen reduzierten zukünftige solidarische Altersbezüge und förderten die private Vorsorge. Im Ergebnis wurden soziale Risiken von der Gesellschaft zu den Individuen verschoben. Wenn die gesellschaftliche Solidarität schon diese Bewährungsprobe nicht bestanden hat, was ist von ihr zu erwarten, wenn 30, 40 oder 50 Prozent der Mittelschicht keine Arbeit mehr hat und der Rest hochbezahlte Tätigkeiten in der digitalisierten Wirtschaft ausübt? Der Sozialstaat wird weitgehend durch die Mittelschicht finanziert, ihre Beiträge und Steuerzahlungen sorgen für Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung, Krankenversicherung und Rente. Dieses Modell wird nicht mehr funktionieren, wenn die Mittelschicht schrumpft und in immer mehr Unterstützungsberechtigte und weniger Zahlende zerfällt.
Doch die aktuelle Agenda der Sozialpolitik bewegen diese Fragen kaum, sie wird dominiert von der alten analogen Ökonomie. Die sozialpolitische Debatte läuft, mit verschiedenen Nebengleisen, in etwa auf folgender, inzwischen allseits bekannter Argumentationsschiene ab: Die Bevölkerung der Industrieländer schrumpft, der jährliche Produktivitätszuwachs ist in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. Das zukünftige Ergebnis ist mit Glück ein geringes Wachstum, mit Pech eine stagnierende Wirtschaft. Die europäischen Länder beschäftigt diese Thematik seit Jahren. Staatsverschuldung, Rentenhöhe, Krankenversicherungskosten – in den meisten Industrieländern wird die Diskussion des Sozialsystems von Demografie und Produktivitätswachstum bestimmt. Fast jeden Monat erscheinen Studien und Vorausberechnungen mit Warnhinweisen. Durch dieses Framing sind inzwischen alle europäischen Bürger auf die Alternativlosigkeit von Leistungskürzungen und Beitragserhöhungen eingestimmt, wenn das Problem nicht durch noch mehr Staatsschulden vor sich her geschoben werden soll. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Lawrence Summers hat bereits die „säkulare Stagnation“ ausgerufen. Er ist der Meinung, dass uns ein geringes Wirtschaftswachstum noch lange begleiten kann, wenn die Politik nicht gegensteuert.22
Doch kann sie überhaupt etwas gegen die anhaltende Wachstumsschwäche tun? Politiker, Unternehmensverbände, Gewerkschaften, Forschungsinstitute und Unternehmensberater schlagen immer wieder die gleichen Lösungen vor. Es sind die Klassiker aus dem neoliberalen und keynesianischen Politikbaukasten. Sie laufen auf kleine Drehungen an vielen Stellschrauben hinaus, die wir alle schon gehört haben: mehr in Infrastruktur investieren, zum Beispiel Straßen erneuern, Schulen moderner ausstatten, Breitbandnetze verlegen. Die Studierenden dazu bringen, öfter MINT-Fächer zu belegen. Natürlich weiter deregulieren, damit die Unternehmen besser investieren können. Auch der Arbeitsmarkt muss noch flexibler werden. Alle sollen länger arbeiten, mehr Frauen berufstätig werden und die Einwanderung steigen, damit wir zusätzliche Arbeitskräfte bekommen. Die Globalisierung ist selbstverständlich fortzusetzen und schließlich sollten wir, also der Staat, die Innovation stärker fördern.
Die Digitalisierung erscheint in diesem Rahmen meist nur als Hinweis auf die Zukunft, als zusätzliches Problem, als „Herausforderung“. Auseinandergesetzt hat sich mit ihr auch das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Es hat die Arbeit weiter gedacht und verkündet in seinem „Weissbuch Arbeiten 4.0“: „Infolge des technologischen und wirtschaftlichen Wandels wird es keine massenhafte Automatisierung von Arbeitsplätzen geben.“23 Sind die größten Ängste also unbegründet? Oder werden besorgte Bürgerinnen und Bürger vermuten, bei den politischen Erklärungen zur Digitalisierung handele es sich um einen ehrenwerten Versuch der Beruhigung, gerade weil die sozialen Risiken der Digitalisierung so bedrängend sind und die Bevölkerung ihnen weitgehend hilflos ausgeliefert ist? „Wo…Abwehr und Vermeidungshandeln so gut wie ausgeschlossen sind, bleibt als (scheinbar) einzige Aktivität: … ein Beruhigen, das Angst macht …“ konstatierte der Soziologe Ulrich Beck für die moderne Risikogesellschaft.24 Nach dieser Logik werden pauschale Beruhigungen nichts nutzen, im Gegenteil, die Angst noch vergrößern. Sie schaffen keine Ruhe, sondern verstören mehr durch die Hilflosigkeit der Politik. Sie sind die Offenbarung, dass sie zwar beste Vorsätze, aber wenig Mittel hat, mit den kommenden Problemen sicher umzugehen. Auch nicht mit deren Geschwindigkeit. Der neue deutsche Bundestag, gewählt 2017, hat zu einem bewährten Mittel der politischen Konsensbildung gegriffen und eine Enquete-Kommission zum Thema künstliche Intelligenz gebildet. Der Abschlussbericht soll nach dem Sommer 2020 vorliegen. Spätestens ein Jahr danach wird bereits der nächste Bundestag gewählt. Vielleicht machen dann die Fakten, die die IT-Konzerne in der Zwischenzeit geschaffen haben, eine nächste Enquete-Kommission erforderlich.
Das Erstaunliche an dieser Haltung zur Digitalisierung ist die Tatsache, dass der massenhafte Arbeitsplatzverlust in offiziellen politischen Verlautbarungen kaum vorkommt. Das Gesellschaftsmodell basiert weiter auf Arbeit, Vollzeitarbeit bleibt das Leitmotiv. Nach Ansicht des deutschen Politikers Thorsten Schäfer-Gümbel geht es darum, „…in der zersplitterten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts das digitale Synonym des Achtstundentags herauszuarbeiten und diesen Kern in zukunftsfähige Politik zu übertragen.“25 Daher müssen auch die gegenwärtigen Grundprinzipien des Sozialstaats nicht in Frage gestellt werden. Der Sozialstaat soll „linear“ weiterentwickelt werden, als „Fortführung des Bewährten…mit digitalen Mitteln“.26
Was passiert, wenn die Digitalisierung keinen Achtstundentag für alle mehr hergibt, vielleicht nicht einmal mehr für viele, auch nicht sein Synonym? Dieser Fall steht im aktuellen Denken des politischen Mainstreams meist nicht im Vordergrund. Es beschäftigt sich weiter mit der Verteilung der sozialen Kosten, die durch die Alterung der Gesellschaft und das geringe Wachstum entstehen. Verursacht hat diese Kosten die Babyboom-Generation der 1950er- und 1960er-Jahre. Sie hat die größte wirtschaftliche Expansionsparty aller Zeiten gefeiert, den Massenkonsum zelebriert, weniger Kinder bekommen als ihre Eltern und das Ganze mit einem stetig wachsenden Raubbau an der Umwelt sowie einem gigantischen Schuldenberg finanziert. Bekommen ihre Kinder nun die Quittung dafür? Muss die nächste Generation froh sein, wenn sie mit Mühe das Einkommensniveau ihrer Eltern halten kann, während sie deren Alter finanziert?
Das neue Denken
Eine kleine, aber wachsende Schar von Unternehmern, Unternehmerinnen und Forschenden ist anderer Meinung. Sie entzieht sich dem offiziellen Denkmodell, setzt ihre eigene Agenda und treibt sie mit höchstem Tempo voran. Ihre Hoffnung sind die zukünftigen Chancen einer hochdigitalisierten innovativen Wirtschaft. Technologische Fortschritte stellen für sie kein Problem dar, sondern die Lösung. Diese Techno-Optimisten sind davon überzeugt, dass Roboter und künstliche Intelligenz zunehmend die Menschen bei der Arbeit unterstützen und ersetzen werden, aber beides positiv ist. Die Entwicklung soll sich sogar beschleunigen, weil irgendwann die künstliche Intelligenz der menschlichen überlegen sein und sich selbst immer weiter optimieren wird. Ihr Prophet ist der US-amerikanische Erfinder, Zukunftsforscher und Autor Ray Kurzweil. Sein Endziel ist die Singularität, der Zustand, in dem wir die Grenzen unserer menschlichen Biologie überwinden und mit der Technologie verschmelzen. „Es wird keinen Unterschied geben, nach der Singularität, zwischen Mensch und Maschine oder zwischen physischer und virtueller Realität“, so Kurzweil.27
Auch wenn die Singularität noch in weiter Ferne liegt, ermöglicht dieses neue Denken immer wieder ganz andere Lösungen als das alte. Wenn das Endziel die autonome Produktion ist, mit so wenig Menschen wie möglich, welchen Unterschied macht es dann, ob die Arbeitsbevölkerung in Europa zukünftig um 30, 40 oder 50 Millionen Menschen zurückgeht? Das Kernproblem des alten Denkens, die Demografie, begrenzt nicht mehr das Wirtschaftswachstum. Vorbei die Zeiten, in denen das Wachstum des Bruttosozialprodukts mit der Bevölkerungsentwicklung verbunden war. Der Input an Arbeitskräften ist kein begrenzender Faktor mehr für den Output an Gütern und Dienstleistungen. Im Gegenteil: Wenn Roboter produzieren, steigert der Bevölkerungsrückgang den Wohlstand pro Kopf. Der Traum der Techno-Optimisten sind selbstlernende Systeme, die irgendwann ohne viel menschliche Hilfe immer schneller neue Roboter, Abläufe und Verfahren entwickeln und herstellen. Damit verliert auch die zweite Wachstumsgrenze, die Arbeitsproduktivität, ihre Bedeutung.
Das alte Denken sieht in Europa Demografie und Produktivitätszuwachs als Engpässe für die wirtschaftliche Entwicklung. Das neue Denken der Techno-Optimisten beseitigt dieses Nadelöhr. Doch ihre Fantasien konzentrieren sich meist nur auf die technischen Aspekte. Die gesellschaftlichen Konsequenzen bleiben nebulös. Die kurze Geschichte des Internetzeitalters veranschaulicht, wie die weitere Zukunft aussehen könnte. Das Internet hat seine Breitenwirkung über innovative Unternehmen entfaltet, die in historisch ungekannter Schnelligkeit weltweit dominierende Marktstellungen erlangt haben. Online-Händler, Suchmaschinen und soziale Medien waren vor 15 Jahren noch eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Randerscheinung. Heute bewegen die zehn größten IT-Unternehmen der Welt die Börsen in den USA und China, sie sind weit mehr wert als alle deutschen Unternehmen zusammen. Die sozialen Konsequenzen dieser neuen Konzerne und ihrer Marktführerschaft haben sich dabei ebenfalls in atemberaubendem Tempo entfaltet. Gigantische Gewinne für die Aktionäre, Spitzengehälter für eine begrenzte Anzahl von hochqualifizierten Fachkräften, gewaltige Arbeitsplatzverluste in den etablierten Branchen, deren Geschäftsmodelle sie vernichten. Europäische Politiker träumen davon, auch global bedeutende IT-Unternehmen in ihren Ländern zu beheimaten. Tatsächlich wären 100 anstelle von zehn digitalen Marktführern bei den heutigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern vermutlich auch eine soziale Katastrophe. Die gängigen gesellschaftlichen Reaktionsmuster zeigen sich dem Entwicklungstempo der Unternehmen und den Konsequenzen für Arbeitsmärkte und Sozialsysteme derzeit nicht annähernd gewachsen.
Gefährdet die Digitalisierung also zwangsläufig die bestehenden Sozialstaaten? Entscheidend werden das zukünftige Tempo und die Qualität von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzverlusten sein. Im positivsten Fall beschert uns die Digitalisierung ein Wirtschaftswachstum, das eine Vielzahl neuer, gut bezahlter Arbeitsplätze schafft ohne die Umwelt weiter zu belasten. Die arbeitende Bevölkerung bringt die richtige Qualifikation dafür mit und ist voll beschäftigt. Die Politik darf den Überfluss verwalten, um die Arbeit und den Sozialstaat müssen wir uns keine Sorgen machen. Doch was geschieht, wenn dieses digitale Schlaraffenland nicht Wirklichkeit wird und es einfach so weitergeht wie bisher, nur digitaler? Das Wachstum bleibt gering, die Diskussion um Demografie und Rentenfinanzierung begleitet uns auch zukünftig, die Digitalisierung kostet nicht so viele Arbeitsplätze wie befürchtet. Die Eliten des technokratischen Mainstreams werden mit den bewährten Methoden den Status quo verwalten und den Sozialstaat mit leichten Änderungen erhalten.
Was aber passiert, wenn die Digitalisierung zwar neues Wachstum bewirkt, aber gleichzeitig massiv Arbeitsplätze vernichtet? Wenn sie steigende Gewinne für diejenigen schafft, die Kapital besitzen, hohe Gehälter für eine kleine Kaste von digitalen Führungskräften und keine Arbeit mehr für die Masse, deren Qualifikation nicht ausreicht? Wenn sie nicht fünf oder zehn Prozent Arbeitslosigkeit bringt, sondern 30 oder 50 Prozent? Dies wird die etablierten Sozialstaatsmodelle sprengen und gesellschaftliche Verwerfungen hervorbringen, für deren Regelung sich die Gewinner und Gewinnerinnen der Digitalisierung nicht verantwortlich fühlen und die der Staat mit den alten Konzepten nicht mehr lösen kann. Müssen wir uns dann zwischen einer digitalen und einer sozialen Gesellschaft entscheiden? In den offiziellen Planungen der gegenwärtigen Politik ist dieser Fall nicht vorgesehen, er wird schlicht öffentlich ignoriert. Doch dieses Risiko zu verdrängen wird uns nicht vor seinem Eintreten schützen.
Die Geschichte des digitalen Sozialstaats
Die Orientierungslosigkeit des technokratischen Mainstreams ist der ideale Nährboden für populistische Aufsteiger am linken und rechten Rand des politischen Spektrums. Sie fordern die etablierten Parteien heraus, indem sie sich gegen den Markt oder die offene Gesellschaft wenden. Der tiefe Graben, der die westlichen Demokratien durchzieht, und die visionäre Lücke der alten Eliten werden dadurch umso sichtbarer. „Die westliche Demokratie muss diesen selbstdestruktiven nationalistischen Tendenzen mit einer eigenen großen Erzählung über unsere Gegenwart und vor allem unsere Zukunft… entgegentreten“,28 verlangt der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer.
Kann eine große Erzählung, ein Narrativ, helfen, auch die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen? Eine positive, zukunftsweisende und glaubwürdige Geschichte kann die Komplexität der Welt auf ein paar eingängige Formulierungen verkürzen. Sie kann Ängste nehmen, Hoffnung wecken, vor allem Zustimmung bewirken. Wer das Sagen haben will, braucht ein Narrativ. Vielleicht sind die Wählerinnen und Wähler dadurch kurzfristig besser zu beeinflussen, aber nicht die Zukunft.
Die Globalisierung hat die Mittelschicht am unteren Rand aufgelöst. Die Digitalisierung wird sie vielleicht mitten ins Herz treffen. Ein neues Narrativ, eine schlüssige oder wenigstens vordergründig plausible und beruhigende Geschichte über die zukünftigen Segnungen der Digitalisierung, aufgepeppt mit ein paar wirtschaftshistorischen Einsprengseln, dürfte daran wenig ändern. Darauf zu setzen hieße, die politischen Erfahrungen der Bevölkerung zu unterschätzen. Was zählt, ist nicht ein weiteres, die Realität verkürzendes Narrativ, sondern wer die Zeche zahlt. Die Mittelschicht in den Industrieländern hat aus der Geschichte des Neoliberalismus und der Globalisierung gelernt: Sie ist es, die die Rechnung präsentiert bekommt, wenn sich nicht alles so positiv entwickelt wie angekündigt. Warum sollte dies in Zukunft anders verlaufen?
Noch existiert die große Erzählung über die zukünftige Digitalisierung nicht. Doch erste Konturen zeichnen sich bereits ab. Die wichtigste Behauptung ist: Die Arbeit verschwindet durch die Digitalisierung nicht, sie ändert sich nur. An dieser neuen Arbeit kann teilhaben, wer die richtige Qualifikation mitbringt. Also benötigen wir noch mehr und neue Bildung. Dabei sollte, natürlich, der Staat helfen – mit Bildungsförderung von der Vorschule bis zur Pensionierung, damit alle ihre Chance bekommen. Selbstverständlich arbeitsmarktgerecht. Globalisierung ist auch weiterhin nötig, alles andere kostet Wachstum. Europa sollte gemeinsam stark sein, sonst hat es in einer zukünftigen Welt zwischen den USA, Asien und Russland keine Chance. Die Demokratie bleibt zentral, ihre Vorteile müssen nur besser kommuniziert werden. Vielleicht hat sie auch noch Verbesserungspotenzial. Bedingungsloses Grundeinkommen? Nicht nötig, die Arbeit bleibt ja erhalten und damit auch der Sozialstaat, der auf Arbeit gründet. Außerdem unterminiert es die Arbeitsethik und die Solidarität.
Natürlich ist diese kurze Darstellung eine grobe Vereinfachung. Die folgenden Kapitel setzen sich mit der Glaubwürdigkeit dieser Geschichte detailliert auseinander. Mit der Verteilung der Arbeit, dem Nutzen von Bildung, den Vor- und Nachteilen des Grundeinkommens. Und nicht nur damit. Sie zeigen auch, auf was es ankommen wird, wenn das offizielle Narrativ sich einmal mehr für viele nicht bewahrheitet und die Digitalisierung sich als ein weiteres Elitenprojekt herausstellt. Wenn Roboter, künstliche Intelligenz und andere Innovationen nicht nur wirtschaftliches Wachstum schaffen, sondern auch massive Arbeitsplatzverluste. Der heutige Sozialstaat wird die Mittelschicht dabei im Stich lassen. War er einst angeblich eine Hängematte, wird er zukünftig bestenfalls noch als Krückstock dienen. Die Waage zwischen digital und sozial neigt sich zugunsten der neuen Digitalisierungseliten, der alte Sozialstaat wird für zu leicht befunden. Die europäische Mittelschicht hätte dann innerhalb von 100 Jahren Aufstieg und Niedergang vollendet. Ihren Anteil am Volkseinkommen streichen die Gewinner und Gewinnerinnen der Digitalisierung ein, eine immer kleiner werdende Gruppe von Menschen, die Kapital oder zukunftsorientiertes Fachwissen besitzen. Wieviel sie von ihrem Einkommen an die arbeitslosen Massen zurückgeben und auf welche Weise, ist die Kernfrage des zukünftigen Sozialstaats und der Demokratie.
Politik und Sozialstaat sind nicht auf dieses Worstcase-Szenario vorbereitet. Sollte es nicht eintreten, können wir alle und vor allem unsere Kinder dankbar sein. Aber es nützt nichts, es zu verdrängen oder zu verleugnen. Im Gegenteil: Durch die Auseinandersetzung mit seinen Risiken werden wir dazulernen. Wir können dadurch besser verstehen, welche Weichen wir vielleicht in Kürze stellen müssen, um uns nicht nur mit den Herausforderungen der Digitalisierung auseinanderzusetzen, sondern auch von ihren unbestrittenen Vorteilen zu profitieren und sie der ganzen Gesellschaft zukommen zu lassen. Noch besteht diese Möglichkeit. Der Raum zwischen Utopie und Dystopie kann von uns gestaltet werden.