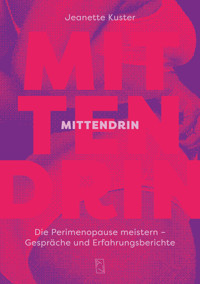
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arisverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
«Ich schrecke mitten in der Nacht aus dem Schlaf auf, mein Herz rast, der ganze Körper pulsiert.» Suzy hatte keinen Alptraum. Sie ist in der Perimenopause, der Phase der Wechseljahre, in denen die Hormone Achterbahn fahren, bevor sie endgültig absinken. Rund siebzig verschiedene Symptome können diese hormonellen Schwankungen auslösen. Andererseits sind die Wechseljahre für viele Frauen auch eine Zeit, in der sie ihre eigenen Bedürfnisse besser spüren lernen, um danach selbstbewusster als je zuvor in den nächsten Lebensabschnitt zu starten. In diesem Buch erzählen unterschiedliche Frauen ihre ganz persönliche Wechseljahr-Geschichte, während acht Expertinnen erklären, was während der Perimenopause genau im Körper und im Hirn passiert und wie neben Hormonpräparaten auch Bewegung, Ernährung und alternative Heilmethoden in dieser Umbruchphase unterstützen können. Ein Buch, das Hoffnung macht und jede Frau ab Mitte 30 lesen sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeanette Kuster ist Journalistin, Kommunikationsexpertin und Yogalehrerin. Sie hat für diverse Medien gearbeitet und während ihrer langjährigen Tätigkeit beim Mamablog des Tages-Anzeigers regelmässig über die Herausforderungen des Frauseins geschrieben. Ihre persönliche Erfahrung mit der Perimenopause hat sie motiviert, dieser intensiven, transformierenden weiblichen Lebensphase ein Buch zu widmen. Jeanette Kuster wurde 1975 in Uznach geboren und lebt mit ihren beiden Kindern in Adliswil.
Frauen haben die Tendenz, den Fehler immer erst bei sich selbst zu suchen, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Deshalb ist die öffentliche Diskussion und Enttabuisierung wichtig. So merken sie, dass es an den Wechseljahren liegt, und können sich Hilfe suchen.
Dr. med. Regine Laser, Fachärztin für Gynäkologie und Hormonspezialistin
Unter dem Strich kann man sagen, dass jede Frau irgendwelche Beschwerden hat – es ist höchst unwahrscheinlich, dass man gar nichts mitkriegt von den Wechseljahren.
Prof. Dr. med. Petra Stute, Leiterin Menopausenzentrum des Berner Inselspitals
In «MITTENDRIN» erzählen unterschiedliche Frauen ihre ganz persönliche Wechseljahr-Geschichte, während Expertinnen in Interview erklären, was während der Perimenopaus genau im Körper und im Hirn passiert und wie einen neben Hormonpräparaten auch Bewegung, Ernährung und alternative Heilmethoden in dieser Umbruchphase unterstützen können.
Rund siebzig verschiedene Symptome der Perimenopause sind bekannt, von der depressive Verstimmung bis zur Blasenentzündung. Die Wechseljahre sind für viele Frauen aber auch eine Zeit, in der sie lernen, ihre eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen, und sich nochmals neu (er-)finden.
Ein Buch, das Hoffnung macht
– mit Expertinnenwissen aus Medizin, Gynäkopsychiatrie, TCM, Yoga, Ernährung und Arbeitswelt.
Jeanette Kuster
MITTENDRIN
Die Perimenopause meistern – Gespräche und Erfahrungsberichte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage
© 2025, Arisverlag
(Ein Unternehmen der Redaktionsbüro.ch GmbH)
Schützenhausstrasse 80
CH-8424 Embrach
www.arisverlag.ch | www.redaktionsbüro.ch
Umschlaggestaltung und Satz: Lynn Grevenitz – kulturkonsulat.com
Covermotiv: © Seventyfour – stock.adobe.com
Autorinnenfoto: Mikke Dinkel
Lektorat: Katrin Sutter | Paula Fricke | Elisabeth Blüml
Korrektorat: Elisabeth Blüml
Druck: CPI books GmbH, www.cpibooks.de
ISBN: 978-3-907238-49-3
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book: 978-3-907238-58-5
Für Nia und Nael
INHALT
Aus der Verzweiflung zum Buchprojekt: Meine Geschichte
Die Perimenopause, ihre Symptome und Behandlungsmöglichkeiten: Interview mit Prof. Dr. med. Petra Stute, Leiterin Menopausenzentrum des Berner Inselspitals
Nächtliche Wallungen und eine neue Weiblichkeit: Suzy
Erst Brustkrebs und Menopause, jetzt stärker als je zuvor: Moni
Die Wechseljahre aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin: Interview mit Dr. Phil.-Nat. Alexandra Nievergelt, TCM-Therapeutin
Vorzeitige Menopause und zwei Kleinkinder: Andrea
Die Psyche in der Perimenopause: Interview mit Dr. phil. Serena Lozza-Fiacco, Assistenzpsychologin Gynäkopsychiatrie
Spass am Sex trotz trockener Vagina: Tatiana
Harnwegsinfekte, Scheidentrockenheit und Inkontinenz: Interview mit Dr. med. univ. Nicole Weirich, Fachärztin für Urologie
Die Suche nach dem neuen Ich: Claudia
Yoga in den Wechseljahren: Interview mit Petra Coveney, Gründerin von Menopause Yoga
Coming-out in der Perimenopause: Marah
Die Wechseljahre am Arbeitsplatz: Interview mit Dr. Joëlle Zingraff, Co-CEO «The Women Circle AG»
Eine Wildheit wie in der Pubertät: Tatjana
Alles rund um Hormone und die Hormonersatztherapie: Interview mit Dr. med. Regine Laser, Fachärztin für Gynäkologie und Hormonspezialistin
Testosteron statt Trennung: Amira
Ernährung in der Perimenopause: Interview mit Prof. Dr. Christine Brombach, Ernährungswissenschaftlerin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Späte Mutterschaft trotz vorzeitiger Menopause: Johanna
Die Menopause als Befreiungsschlag: Erika
Symptome der Perimenopause
Anhang
Und plötzlich entsteht aus der Verzweiflung etwas Positives
Rückblickend ist mir klar: Die ersten Anzeichen gab es schon einige Jahre vorher. Bloss konnte ich sie damals nicht zuordnen. So richtig fing es aber kurz vor meinem 47. Geburtstag an. Corona hatte mich zum ersten Mal erwischt und ich brauchte etwa einen Monat, um wieder auf die Beine zu kommen. Doch irgendetwas war danach anders. Mir fehlte nicht nur die Energie, die mich normalerweise problemlos meinen Alltag mit Job, Kindern, Haushalt und Hobbys meistern lässt. Da war auch diese Niedergeschlagenheit, die ich mir absolut nicht erklären konnte und die wie aus dem Nichts gekommen war. Ich fühlte mich lahmgelegt und traurig. Kurz: Ich war nicht mehr ich selbst.
Anfangs fragte ich mich, ob es eine Nachwirkung des Virus war. Mein Hausarzt hingegen tippte auf eine depressive Verstimmung und verschrieb mir Johanniskraut, um meine Laune zu heben. Das half zwar nicht so richtig, aber ich nahm es weiterhin, weil ich befürchtete, dass es mir ohne vielleicht noch schlechter gehen würde. Die Monate vergingen und es änderte sich vorerst nichts – bis es irgendwann weiter abwärts ging. Mir war ständig schwindlig und ich hatte starke Stimmungsschwankungen. Dazu kam ab und zu ein äusserst unangenehmes Pfeifen im linken Ohr, das nach ein, zwei Minuten genauso plötzlich verschwand, wie es gekommen war. Vor allem aber plagten mich heftige Schlafstörungen. Ich, die mein Leben lang stets wunderbar geschlafen hatte, wachte jetzt mehrmals pro Nacht auf und konnte oft bis früh am Morgen nicht mehr einschlafen. Kaum war ich dann wieder eingenickt, klingelte auch schon der Wecker. «Kein Wunder, dass mir schwindlig ist, wenn ich so schlecht schlafe», sagte ich mir und versuchte, ein Symptom mit dem anderen zu begründen. Weil ich schlicht keine andere Erklärung für all die Seltsamkeiten hatte, die plötzlich mit und in mir passierten.
Eines Tages aber tauchte in meinem Kopf die Idee auf, dass das Ganze mit meinen Hormonen zu tun haben könnte. Ich bekam meine Periode zwar noch regelmässig – beziehungsweise wieder regelmässig, denn im Jahr zuvor hatte es eine Phase gegeben, in der mein üblicherweise sehr konstanter Zyklus mal kürzer, mal länger gewesen war. Dennoch hatte sich etwas verändert: Meine Blutungen waren deutlich schwächer geworden, die Krämpfe am ersten Zyklustag dafür viel heftiger. Auch schienen all die anderen seltsamen Symptome gewissen Schwankungen zu unterliegen. Ich fing an, sie akribisch aufzuschreiben, um irgendwie daraus schlau zu werden. Und dann kam der Tag, an dem ich mein Lieblingskleid anzog und es plötzlich spannte um die Hüfte. Das war für mich ein eindeutiges Zeichen, dass irgendetwas in meinem Körper ganz anders lief als gewohnt und meine Hormon-Vermutung wohl korrekt war. Ich nehme nämlich normalerweise nicht zu, egal was ich esse – im Gegenteil: Wenn es mir einmal schlecht ging, musste ich eher darauf achten, nicht abzunehmen. Und ziemlich schlecht ging es mir zu dem Zeitpunkt wirklich.
Also fing ich an zu recherchieren. Und stiess dabei auf den Begriff Perimenopause – ein Wort, das ich noch nie zuvor gehört hatte. Natürlich kannte ich die Menopause, brachte diese aber bloss mit dem Ende der Menstruation und Hitzewallungen in Verbindung. Dass aber die Hormonpegel in den Jahren davor – eben der Perimenopause – bereits deutlich sinken und dabei unglaublich starken Schwankungen unterliegen, war mir nicht bewusst. Und da las ich nun, dass es diese turbulente Phase der Wechseljahre nicht nur gibt, sondern dass sie auch bis zu zehn Jahre andauern kann.
Kommt eine Frau hierzulande also im Durchschnitt mit 51 Jahren in die Menopause, bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie während eines Grossteils ihrer Vierziger bereits die Perimenopause durchlebt. Und die hat es in sich! Denn es ist keineswegs getan mit ein paar Hitzewallungen. Es gibt je nach Quelle rund sechzig bis siebzig verschiedene Symptome, welche die Hormonschwankungen verursachen können: Schlafstörungen, trockene Augen, trockener Mund, Schwindel, Gefühlsstörungen in den Händen, Panikattacken, Stimmungsschwankungen, trockene Scheide, Blasenprobleme, verstärkte Allergien, veränderte Menstruation und viele mehr. Denn all unsere Organe haben Rezeptoren für Östrogen und Co, weshalb sie auch alle auf einen plötzlichen Abfall ebendieser Hormone reagieren können. Und tatsächlich sind es sehr oft die psychischen Symptome wie Angststörungen oder Depressionen, die zuerst auftreten – und die so unglaublich schwierig zuzuordnen sind, weil man zu Beginn der Perimenopause in der Regel noch nicht an seine Hormone als Ursache denkt.
Was ich da las, glich einer Erleuchtung: All meine unerklärlichen Beschwerden machten plötzlich Sinn. Auch die wiederkehrenden Blasenentzündungen und -reizungen, mit denen ich im Jahr zuvor plötzlich zu kämpfen hatte. Oder die Histaminintoleranz, die mich seit Anfang vierzig begleitet.
Ich fragte mich, wieso um alles in der Welt ich noch nie von alledem gehört hatte. Schliesslich hatte ich mich immer für eine gut informierte Frau gehalten, gerade auch im Bereich der Frauengesundheit. Ich hatte in meinem Job als Journalistin auch nie Angst vor Tabuthemen gehabt – aber dieses hier war mir bis dahin tatsächlich noch nie begegnet. Und nicht nur mir: Laut einer Studie1 aus dem Jahr 2020 werden 46 Prozent der Frauen völlig von der Perimenopause überrumpelt. Und gar mehr als 60 Prozent fühlen sich laut einer englischen Studie2 nicht ausreichend informiert über diese Lebensphase.
Ich wusste nicht, ob ich mich erleichtert oder empört fühlen sollte. Erleichtert, endlich zu erfahren, dass all meine Symptome offenbar einen Grund haben und ich mir das keineswegs alles einbildete. Und empört, weil kaum jemand darüber spricht und oft nicht einmal die Ärztinnen und Ärzte genau Bescheid wissen und darum auch nicht an die Wechseljahre als Ursache denken.
Da sowieso gerade meine Jahreskontrolle anstand, sprach ich meine Frauenärztin auf das Thema an. Doch sie beschied mir, dass sie mir nicht helfen könne, solange ich noch einen einigermassen regelmässigen Zyklus habe. Also versuchte ich es mit pflanzlichen Tröpfchen, die ich mir in der Apotheke besorgte – ohne Erfolg. Etwa einen Monat später war ich so verzweifelt, dass ich eine andere Gynäkologin aufsuchte, um mir eine Zweitmeinung einzuholen und vielleicht endlich Hilfe zu bekommen. Ich hatte unterdessen wie besessen über die Perimenopause gelesen und wusste, dass man Hormone durchaus mit Zyklus nehmen konnte. Und diese Ärztin sah das genauso: Sie verschrieb mir tief dosiertes Progesteron für die zweite Zyklushälfte. «Da das Progesteron das erste Hormon ist, das während der Perimenopause absinkt, beginnt man die Behandlung in der Regel damit», so ihre Begründung. Als ich die Praxis verliess, war ich unendlich erleichtert, endlich etwas in der Hand zu haben, auch wenn ich in dem Moment gerade am Zyklusanfang stand und erst in zwei Wochen damit starten konnte. Doch wenige Tage später befand ich mich nach einer weiteren schlaflosen Nacht psychisch in einem solchen Loch, dass ich am Morgen schluchzend in der Praxis anrief. Die Ärztin entschied, dass wir in meinem Fall doch besser gleich mit beiden Hormonen starten und ich mir das Östrogen-Gel sofort abholen solle.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich in der Praxis ankam und mich bei der Assistentin für meinen vorherigen verzweifelten Anruf entschuldigte, nur um beim Reden gleich wieder zu weinen anzufangen, so dünnhäutig und hyperemotional fühlte ich mich an dem Tag. Eine Stunde später stand ich nervös zu Hause im Bad und schmierte mir zum ersten Mal das durchsichtige Gel auf den Unterarm. Und dann geschah etwas, das sich wie ein Wunder anfühlte: Schon zwei Tage später ging es mir ein kleines bisschen besser. Ich hüpfte nicht durch die Gegend und schlief auch noch lange nicht wieder wie früher, aber der Schwindel war ganz weg und ich fühlte mich zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wieder ein wenig optimistischer.
Obwohl ich früher immer gedacht hatte, dass ich ohne Hormonpräparate alt werden würde – die paar Hitzewallungen würde ich mit meiner Yogapraxis sicher wegatmen können –, war ich ab diesem Moment überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Das bin ich noch, doch wie sich herausstellte, führt auch dieser Weg nicht nur über blumig duftende Wiesen, sondern über einige steinige Hügel und durch tiefe Täler. Bei der Hormonersatztherapie arbeitet man nämlich gezwungenermassen nach dem System «Versuch und Irrtum». Man kann die Hormonspiegel zwar über einen Bluttest bestimmen, aber weil gerade das Östrogen während der Perimenopause so enormen Schwankungen unterliegt, ist es reiner Zufall, ob der Spiegel im Moment der Blutentnahme gerade hoch, tief oder irgendwo in der Mitte liegt. Laut Expertinnen wie der britischen Ärztin, Autorin und Menopause-Podcasterin Dr. Louise Newson sind die Laborresultate deshalb nicht wirklich aussagekräftig und es gilt, in erster Linie aufgrund der Symptome zu entscheiden und sich an die richtige Lösung heranzutasten: Welche Hormone sollen es sein, in welcher Form und welcher Dosis? Ausserdem können sich die Symptome mit der Zeit verändern oder andere hinzukommen, weshalb die Behandlung immer wieder angepasst werden muss.
Ich habe in Absprache mit meiner Ärztin die Progesteron- und Östrogen-Dosis nach etwa einem halben Jahr leicht angehoben, da ich mich zwar etwas besser fühlte, aber noch lange nicht gut. Kurz danach ergänzten wir das Ganze mit einem sehr tief dosierten Testosteron-Präparat. Ja, auch wir Frauen produzieren das vermeintlich männliche Hormon – und auch dieses sinkt während der Wechseljahre und ein Mangel kann Symptome auslösen. Das bekannteste Anzeichen für Testosteron-Mangel ist ein Verlust der Libido und meist wird es auch bloss dafür verschrieben. Mir hat das Testosteron aber vor allem geholfen, wieder klarer denken zu können, und mein Energielevel ist dadurch auch angestiegen.
Womöglich hat das Testosteron auch meinen Schlaf verbessert. Aber vielleicht war es auch etwas anderes – oder eine Kombination aus mehreren Dingen. Denn so grossartig die Hormonpräparate bei vielen auch funktionieren, damit alleine ist es in der Regel nicht getan. Die meisten Frauen merken, dass sie zusätzlich gewisse Lebensgewohnheiten anpassen müssen, um sich wieder besser zu fühlen. So widme ich meiner Schlafroutine heute deutlich mehr Aufmerksamkeit als früher. Ich gehe bewusst jeden Abend ungefähr zur selben Zeit ins Bett und vermeide direkt vorher wenn möglich Bildschirme jeglicher Art und zu grelles Licht. Idealerweise setze ich mich auch noch kurz auf die Yogamatte und sei es nur, um ein paar Mal tief durchzuatmen. Ich sage bewusst «idealerweise», denn in letzter Zeit komme ich wieder eher selten dazu – nicht alle guten Vorsätze lassen sich so leicht in den Alltag integrieren. Was ich aber konsequent jeden Abend mache, ist Folgendes: Ich nehme mein Magnesium und Passionsblumen-Tröpfchen zum leichteren Einschlafen und notiere mir bereits im Bett liegend mindestens drei Dinge in mein Tagebuch, die mich heute glücklich gemacht haben, um den Tag positiv abzuschliessen.
Meist schlafe ich so durch oder wache nur noch ganz kurz auf während der Nacht. Dieser Moment, wenn ich die Augen aufblinzle und sehe, dass draussen bereits der Tag anbricht, erfüllt mich immer noch jedes Mal mit Dankbarkeit, weil mich die Schlaflosigkeit die letzten zwei Jahre so fertiggemacht hat. Da stört es mich gar nicht so sehr, dass ich nun dafür jeden Morgen ziemlich früh aufwache. Stattdessen nutze ich die Zeit bis zum Aufstehen, um Yoga Nidra zu praktizieren, eine angeleitete Tiefenentspannung. Für mich in dieser Lebensphase der ideale Start in den Tag.
Auch dem Schlaf zuliebe und weil ich meist schlicht keine Lust mehr darauf habe, habe ich den Alkohol extrem reduziert. Ich trinke an Weihnachten oder einem Geburtstag vielleicht einmal ein Glas, aber das wars auch schon. Während der Alkohol weniger wurde, habe ich die Proteine dafür gesteigert. Um dem Muskelabbau entgegenzuwirken, sollten Frauen in den Wechseljahren nämlich mehr Eiweiss zu sich nehmen. Und Gewichte stemmen. Deshalb stehe ich heute tatsächlich regelmässig mit Hanteln im Wohnzimmer und turne ein Fitnessvideo nach – etwas, das ich mir als überzeugte Yogini in meinen wildesten Träumen nicht vorgestellt hätte.
Was mich selbst aber am meisten überrascht hat, ist die Tatsache, dass ich angefangen habe, im Winter schwimmen zu gehen. Ich war immer diejenige, die schon bei einer Wassertemperatur von 21 Grad kreischte und am liebsten im lauwarmen Meer planschte. Mit 48 aber hatte ich plötzlich Lust, das Winterschwimmen auszuprobieren – und ich liebe es! Die Kälte bringt einen ganz ins Jetzt und die Glückshormone, die der Körper dabei ausschüttet, sorgen für ein emotionales Hoch und sollen bei Depressionen und Angststörungen helfen. Mir gibt das Winterschwimmen ausserdem ein gutes Körpergefühl, was ich gerade in dieser Lebensphase unendlich wichtig finde. Und wenn sich mein Kopf und Nacken wieder einmal anfühlen, als ob sie glühen würden (meine Variante der Hitzewallung), oder ich am Feierabend mit Kopfweh aus dem Büro komme, reichen schon zwei Minuten im eiskalten See und es geht mir wieder besser.
Trotz all dieser Beschwerden, die mich in meinem Alltag enorm beeinträchtigt haben und das phasenweise immer noch tun, stehe ich den Wechseljahren mittlerweile sehr positiv gegenüber. Denn durch diese Transformation, die ich gerade durchlaufe, habe ich mich selbst mehr in den Fokus gerückt – etwas, das ich sehr, sehr lange nicht mehr getan hatte. Als alleinerziehende Mutter waren meine Aufmerksamkeit und Energie seit Jahren stets auf mein Umfeld gerichtet: meine Kinder, den Job, den Haushalt. Seit einer Weile aber spüre ich plötzlich das grosse Bedürfnis, auch mir selbst wieder mehr Raum zu geben und meine eigenen Wünsche wahrzunehmen. Das gibt mir einerseits Kraft und fühlt sich fast ein bisschen so an, als ob ich als eigenständige Person wieder zum Leben erweckt würde. Manchmal löst es aber auch Verzweiflung oder Wut aus, wenn ich spüre, dass dieses Bedürfnis so enorm stark ist, ich ihm im Alltag aber nicht genügend nachkommen kann.
Zudem erwische ich mich neuerdings regelmässig dabei, wie ich mir die Sinnfrage stelle: «Ist das, was ich tue, überhaupt bedeutungsvoll? Bewirkt es etwas, verbessert es das Leben von irgendwem?» Das geht so weit, dass ich mir sogar überlegt habe, mit fast fünfzig nochmals eine ganz neue Ausbildung zu machen, um einen Beruf auszuüben, in dem ich eben diesen Sinn tagtäglich finde.
Aus diesen Gedanken heraus ist auch dieses Buch entstanden. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich mich aus Unwissen mehr als ein Jahr lang so verloren gefühlt hatte. Das sollte anderen Frauen nicht passieren! Also erzählte ich in meinem Umfeld ganz offen von meinen Erfahrungen, was mir zwischendurch leicht erschreckte, peinlich berührte Blicke einbrachte, denn über so etwas spricht man doch nicht. Umso mehr freute es mich, als mir eine Freundin sagte, sie habe meine Geschichte wiederum weiteren Frauen erzählt. Doch ich wollte das Thema noch stärker verbreiten und mithelfen, das Tabu zu brechen. Und so hatte ich eines Tages die Idee, ein Buch darüber zu schreiben.
Es sollte ein Buch werden, das aufklärt, indem es die Perimenopause zum Thema macht. Aber ich wollte keinen klassischen Ratgeber schreiben, sondern ein Buch, das die Frauen und ihre individuellen Geschichten in den Fokus stellt. Denn jede durchlebt diese Phase anders und geht auf ihre eigene Weise mit den plötzlichen Veränderungen um. Was uns aber allen gemein ist: Für jede Frau ist es eine transformierende Phase. Eine Phase, in der man sein Leben überdenkt, sich selbst neu kennenlernt, vielleicht noch einmal eine ganz andere Richtung einschlägt. Oder eben sein erstes Buch schreibt.
«Es ist höchst unwahrscheinlich, dass man gar nichts mitkriegt von den Wechseljahren.»
Prof. Dr. med. Petra Stute ist Leitende Ärztin und Stellvertretende Chefärztin Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin sowie Leiterin des Menopausenzentrums des Berner Inselspitals. Daneben ist sie seit 2023 Vizepräsidentin der European Menopause and Andropause Society. In ihrem Podcast «MenoQueens» teilt Petra Stute seit März 2025 ihr Wissen rund um die Wechseljahre mit ihren Zuhörerinnen.
Petra Stute, in der Schweiz kommen Frauen durchschnittlich mit 51 Jahren in die Menopause. Die hormonellen Veränderungen beginnen aber schon deutlich früher.
Das ist korrekt. Die letzte spontane Regelblutung – also die eigentliche Menopause – findet im Durchschnitt mit 51 statt. Die Phase davor, die Perimenopause, dauert in der Regel zwischen vier und acht Jahren. Das Ganze beginnt also früher, als es die Frauen erwarten. Die Symptome sind zudem anfangs oft sehr subtil, sodass man sie gar nicht richtig zuordnen kann.
Ein Drittel der Frauen soll gar keine Wechseljahrbeschwerden haben. Stimmt das?
Diese kolportierten Zahlen beruhen meist auf den Hitzewallungen: Tatsächlich hat rund ein Drittel der Frauen keine Wallungen, ein weiteres Drittel moderate, der Rest starke. Aber man kann natürlich noch diverse andere Symptome haben. Wir wissen heute, dass etwa 60 Prozent der Frauen mit Ende vierzig an hormonell bedingten Schlafstörungen leiden. Und 40 bis 60 Prozent der Frauen haben in der Perimenopause mit Konzentrationsstörungen zu kämpfen. Unter dem Strich kann man sagen, dass jede Frau irgendwelche Beschwerden hat – es ist höchst unwahrscheinlich, dass man gar nichts mitkriegt von den Wechseljahren.
Es gibt je nach Quelle bis zu siebzig unterschiedliche Symptome, die der Perimenopause zugeordnet werden. Welche sind besonders häufig, welche eher selten?
Am häufigsten sind Beschwerden, die das zentrale Nervensystem betreffen, also Hitzewellen, Schlafstörungen, Stimmungsveränderungen, depressive Verstimmung, Reizbarkeit und Ängstlichkeit. Und eben auch die bereits erwähnten Konzentrationsstörungen und Wortfindungsstörungen. Etwas weniger häufig werden Gelenk- und Muskelbeschwerden oder Haut- und Haarveränderungen genannt. Vielleicht stehen Letztere aber auch einfach nicht so sehr im Vordergrund.
Viele Frauen haben mir erzählt, dass ihnen bei depressiven Symptomen während der Perimenopause sofort Antidepressiva verschrieben wurden und die Ärztinnen und Ärzte gar nicht an die Hormone als Ursache gedacht haben.
Das geschieht tatsächlich sehr oft.
Weiss die Ärzteschaft zu wenig gut über die Menopause Bescheid?
Die Sache ist die: Die Wechseljahre berühren im Grunde sehr viele medizinische Fachbereiche, weil die Beschwerden so vielfältig sein können. In der Ausbildung sind sie jedoch klar der Gynäkologie angegliedert. Zugegebenermassen werden die Wechseljahre jedoch auch in der gynäkologischen Facharztausbildung nur am Rande thematisiert, weil der Schwerpunkt auf der Geburtshilfe und der operativen Gynäkologie liegt und weniger auf den Hormonen.
Ein Baby bekommt aber nicht jede Frau, in die Menopause kommen hingegen alle. Das allein wäre doch Grund genug, den Wechseljahren in der Gynäkologie mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Da gebe ich Ihnen recht. Man müsste weniger auf den einen Bereich fokussieren und die Themen gleichmässiger gewichten.
Sie leiten das Menopausenzentrum am Berner Inselspital. Werden Ihre Patientinnen vom Hausarzt oder der Hausärztin überwiesen oder melden sie sich direkt bei Ihnen?
Es ist ungefähr 50:50. Die eine Hälfte wird zugewiesen über Frauenärztinnen, Hausärzte oder Psychiaterinnen. Manchmal auch von anderen Fachspezialistinnen und -spezialisten, an die man nicht sofort denken würde. Zum Beispiel vom Hals-Nasen-Ohrenarzt, wenn eine Frau dort wegen Stimmveränderungen vorstellig geworden ist; oder von der Dermatologin, wenn es um Hautveränderungen geht. Die andere Hälfte kommt über Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns.
Wie gehen Sie bei der Behandlung vor?
Ich erstelle mit der Patientin eine Art Wunschliste, um herauszufinden, welche Beschwerden sie am meisten stören und wie ausgeprägt diese sind. Manche zählen nur drei Symptome auf, andere zehn. Ich gehe jedes einzelne Symptom durch und erkläre, was man dagegen machen kann. Dabei stütze ich mich auf wissenschaftlich erprobte Alternativtherapien, nicht-hormonelle Medikamente und natürlich die Hormonersatztherapie. Gemeinsam schauen wir dann, was für eine medizinische Vorgeschichte die Patientin hat, was sie mit der Behandlung erreichen will und wie wir dorthin kommen. Wir wollen am Ende ja nicht zehn Medikamente für zehn Symptome verschreiben, sondern mit wenigen möglichst alles abdecken.
Die Hormonersatztherapie (HRT) hat seit der bekannten «Women’s Health Initiative»-Studie vor zwanzig Jahren einen schlechten Ruf, weil es damals hiess, die HRT würde Brustkrebs auslösen. Diese Resultate wurden mittlerweile revidiert. Spüren Sie bei Ihren Patientinnen trotzdem noch eine gewisse Angst vor der Hormonersatztherapie?
Diese Angst ist tatsächlich immer noch da. Die Frauen denken, sie würden morgen an Brustkrebs erkranken, wenn sie heute ein Östrogen-Gel benutzen – und so ist es definitiv nicht. Es besteht einzig ein gewisses Risiko abhängig von der Therapiedauer. Auf der anderen Seite lindert die HRT nicht bloss Wechseljahrbeschwerden, sondern bringt viele andere gesundheitliche Vorteile mit sich.
Welche sind das?
Die HRT senkt nachweislich das Risiko für Osteoporose, Diabetes und sogar Darmkrebs. Und wenn man spätestens innerhalb von zehn Jahren nach der Menopause damit beginnt, schützt sie auch das Herz.
Weshalb diese Zeitgrenze?
War der Körper mehr als zehn Jahre ohne Östrogene, hat bereits eine gewisse Gefässverkalkung am Herzen stattgefunden. Man geht deshalb davon aus, dass es in diesem Fall eher riskant wäre, plötzlich wieder Östrogene zuzuführen. Aber seien wir ehrlich: Keine Frau wartet zuerst zehn Jahre ab und findet dann plötzlich, sie wolle nun doch noch mit einer HRT beginnen. Wer sich für eine HRT entscheidet, startet während der Perimenopause oder in der frühen Postmenopause damit, wenn die Symptome am stärksten sind.
Wenn man einmal damit begonnen hat, bleibt man bis ans Lebensende dabei? Oder muss man die HRT irgendwann wieder absetzen?
Die Dauer der HRT-Anwendung ist nicht zeitlich begrenzt. Vielmehr sollte einmal jährlich die Indikation überprüft sowie die Vor- und Nachteile re-evaluiert werden. Wenn keine Kontraindikationen vorliegen, kann auf Wunsch der Patientin nach entsprechender Beratung die HRT ohne Limit fortgesetzt werden.
Neben Östrogen und Progesteron wird seit einigen Jahren auch Testosteron angewendet, um gewisse Symptome zu lindern. Arbeiten Sie regelmässig damit?
Ich verschreibe es nicht täglich, aber doch relativ häufig. Die Nachfrage ist stark gestiegen, seit vor zwei Jahren ein grosser Artikel zum Thema in einer Zeitung erschienen ist. Offiziell wird Testosteron bei Libidomangel verschrieben, doch die Frauen erhoffen sich auch einen Effekt auf die Stimmung, mehr Antrieb, eine stärkere Muskulatur.
Und bei wie vielen werden diese Hoffnungen erfüllt?
Ich würde sagen, mindestens die Hälfte bis zwei Drittel spüren in den Bereichen eine Verbesserung.
Ich nehme selbst auch Testosteron und es hat meinen Brain Fog innert weniger Wochen weggezaubert. Etwas später habe ich dann gemerkt, dass auch meine Stimmung besser wurde, ich mehr Energie hatte und schliesslich auch meine Libido wieder zum Leben erweckt wurde.
Sehen Sie, dann passt das ja.
Trotzdem gibt es bis heute kein Testosteron-Produkt für Frauen auf dem Schweizer Markt.
Und wir sind damit nicht allein – einzig in Australien gibt es ein Produkt für Frauen. Aber wir können eine Magistralrezeptur verschreiben, das heisst, die Apotheke mischt den Frauen dann eine passende Creme an.
Einige Frauen haben Angst, die Testosteron-Therapie könnte sie männlich machen: Sie befürchten, dass sie davon eine Glatze oder Barthaare bekommen.
Damit das Testosteron ganz sicher nicht zu hoch ansteigt, muss man die Testosteron-Therapie mit Laborkontrollen begleiten – beim Östrogen hingegen ist das anders, da braucht es keine Blutwerte, sondern man orientiert sich an den Symptomen. Man misst also das Testosteron, bevor man die Therapie beginnt, und nimmt dann nach vier bis sechs Wochen nochmals Blut ab, um die Werte zu überprüfen. Je nachdem wie diese ausfallen, macht man in der Folge alle drei bis sechs Monate eine Kontrolle. Das Ziel ist, dass man mit dem Testosteron im Bereich der Prämenopause landet, also ungefähr Werte erreicht, wie sie 20- bis 30-jährige Frauen haben.
Sinkt es denn bereits nach dreissig ab?
Ja, so ab Ende zwanzig, Anfang dreissig wird es allmählich weniger. Aber es sinkt nie so abrupt ab wie das Östrogen und das Progesteron während der Perimenopause.
Das Östrogen schwankt ja auch enorm während der Perimenopause: Der Blutwert kann am Morgen ganz anders aussehen als am Nachmittag desselben Tages. Die Testosteron-Werte bewegen sich nicht so stark auf und ab?
Das Testosteron ist zur Zyklusmitte hin höher als zum Zyklusanfang. Deswegen bestimmt man bei Frauen, die noch einen Zyklus haben, das Testosteron immer am Zyklusanfang, damit es nicht fälschlicherweise zu hoch ausfällt. Ist der Wert bei einer Kontrolle einmal überraschend hoch, nimmt man nochmals Blut ab, um zu schauen, ob das bloss eine Tagesschwankung gewesen ist, bevor man die Therapie anpasst.
Neben der HRT arbeiten Sie auch mit pflanzlichen Medikamenten. Auf welche setzen Sie da?
Ich verschreibe meistens als Arzneimittel registrierte Präparate, die zum Beispiel Mönchspfeffer, Traubensilberkerze, Johanniskraut oder Baldrian und Hopfen enthalten. Mit pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln arbeite ich weniger.
Letztere besorgen sich die Frauen vermutlich selbst: Vitaminpräparate und Ähnliches sind offenbar hoch im Kurs bei Frauen in diesem Alter.
In der Tat: Die meisten Patientinnen, die zu mir kommen, nehmen bereits irgendwelche Vitamine, Mineralstoffe oder Spurenelemente ein. Es gibt fast keine, die gar nichts nimmt.
Wie beurteilen Sie diese Art der Selbstmedikation?
Mit den Produkten, die man frei verkäuflich in der Apotheke bekommt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Die Frage ist einfach: Warum nimmt man das Produkt ein und erreicht man sein Ziel damit? Wenn ich wirklich konkrete Symptome habe und diese mit Vitaminen oder Mineralstoffen behandeln möchte, dann macht es schon Sinn, mich mal richtig beraten zu lassen und nicht einfach wild irgendetwas zu kaufen und zu schlucken. Zudem kann man auch höhere Dosen verschreiben, wenn man diese Mikronährstoffe therapeutisch einsetzt, was womöglich bessere Resultate bringt.
Auch wenn wir mittlerweile etwas offener über die Menopause reden: Die Beschwerden rund um Vagina und Blase sind immer noch ein Tabuthema. Welche Symptome können in dem Bereich auftreten?





























