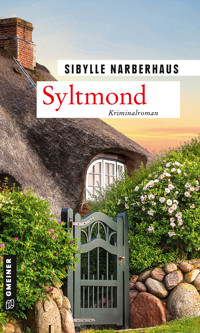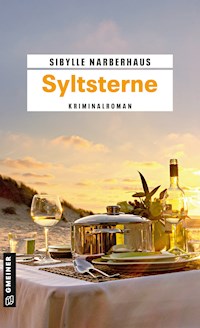Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Am Strand von Rantum wird ein toter Taucher angespült. Haben es die Sylter Ermittler mit einem Mordfall zu tun? Die Nachforschungen der Polizei laufen auf Hochtouren, als Pia Könemann nach einer gescheiterten Beziehung Zuflucht bei ihrer Tante Clara auf Sylt sucht. Die Begegnung mit dem Meeresbiologen Alexander Kramer weckt langsam wieder ihre Lebensgeister. Da verändert ein schrecklicher Unfall plötzlich alles. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass ausgerechnet an Mittsommer, wo überall auf der Insel ausgelassen gefeiert wird, ein Terroranschlag geplant ist. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, wobei auch Pia in große Gefahr gerät. Die Katastrophe erscheint unausweichlich …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sibylle Narberhaus
Mittsommernachtsangst
Sylt-Krimi
Narberhaus, Sibylle: Mittsommernachtsangst. Sylt-Krimi. Hamburg, acabus Verlag 2018
Originalausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-562-2
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-561-5
Print: ISBN 978-3-86282-560-8
Lektorat: Laura Künstler, acabus Verlag
Satz: Laura Künstler, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: sylt-nordsee-insel-landschaft-2570288, www.pixabay.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Für Babel
Hamburg, 2009
»Schneller, schneller, der verblutet uns!«
Die Stimme des Notarztes klang bis zum Äußersten gespannt. Er lief neben der Trage her, die die Sanitäter aus dem Rettungswagen geholt hatten und mit der sie eilig durch die automatische Tür der Notaufnahme rannten. Auf der Trage lag ein junger Mann, auf dessen Pullover sich ein riesiger Blutfleck abzeichnete. Zwei Polizeibeamte in Uniform waren dem Team in geringem Abstand gefolgt. Das Rettungsteam hastete mit dem Patienten den langen Gang entlang bis zur Luftschleuse und dann weiter in den Schockraum, in dem zwei Ärzte und Krankenschwestern warteten, um den Schwerverletzten in Empfang zu nehmen. Jeder wusste, was zu tun war. Ein eingespieltes Team war das Wichtigste, wenn es um Leben und Tod ging.
»Wen haben wir hier?«, fragte der ältere der beiden Ärzte und warf einen kritischen Blick auf den Patienten.
»Männliche Person, 25 Jahre, Schussverletzung im Bauchraum. Er hat sehr viel Blut verloren, Kreislauf stabil«, fasste der Notarzt zusammen, auf dessen Stirn kleine Schweißperlen standen.
Der Verwundete wurde mit geübten Handgriffen vorsichtig von der mobilen Trage auf eine Untersuchungsliege gehoben.
»Oh Gott, den hat es ja ordentlich erwischt. So etwas habe ich ja noch nie gesehen! Na, das wird nichts mehr. Wenn Sie mich fragen, können wir uns das gleich sparen«, sagte der junge Assistenzarzt und verzog das Gesicht, als er die Wunde freilegte.
»Reden Sie nicht, machen Sie lieber! Jetzt ist keine Zeit für Spekulationen. Mit dieser Einstellung hätten Sie besser kein Arzt werden sollen. Los, los, schnell«, wurde er von seinem älteren Kollegen in rüdem Ton gemaßregelt. »Schwester, sagen Sie im OP Bescheid. Die sollen alles bereithalten, wir sind sofort da! Schnell, schnell! Viel Zeit bleibt uns nicht.«
Er warf einen besorgten Blick auf den Patienten. Die Krankenschwester tat, wie ihr geheißen und griff unverzüglich zum Telefonhörer.
Nachdem die Ärzte über fünf Stunden um das Leben des jungen Mannes gekämpft hatten, wurde er schließlich auf die Intensivstation gebracht. Schwester Pia hatte Nachtdienst und kümmerte sich um den frisch operierten Patienten. Sie überprüfte in regelmäßigen Abständen alle Geräte und Monitore, an die er angeschlossen war.
Sie war seit wenigen Wochen in der Unfallklinik in Hamburg tätig. Vor Kurzem hatte sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester erfolgreich in Augsburg beendet. Auf ihrer Suche nach einer freien Stelle hatte es sie in den hohen Norden verschlagen, weit ab der Heimat. Die Klinik in Augsburg, in der sie bislang gearbeitet hatte, konnte sie trotz aller Bemühungen nicht übernehmen, da kein Budget zur Verfügung stand. Eine Anstellung in einer anderen Klinik in der näheren Umgebung zu finden, war ebenfalls vergebens gewesen, obwohl Pia ausgezeichnete Noten und Referenzen vorweisen konnte. Es lag schlicht und einfach daran, dass in den Kassen der städtischen Krankenhäuser gähnende Leere herrschte und kein zusätzliches Personal eingestellt werden konnte – auch wenn überall massiver Personalmangel bestand. Erst eine Bewerbung in Hamburg war erfolgreich gewesen, und Pia hatte die Stelle erhalten. Ihre Freude darüber wurde etwas getrübt, da einige ihrer Kollegen und Freunde sie dafür bedauerten, dass sie nach Hamburg gehen musste. Dort gäbe es stets schlechtes Wetter, und die Menschen im Norden seien stur und unfreundlich, hatten sie ihr prophezeit. Danach war Pia mit einem unsicheren Gefühl nach Hamburg gekommen. Plötzlich war sie völlig auf sich allein gestellt, in einer riesigen Stadt, in der sie keine Menschenseele kannte, und über die sie sich lediglich in Reiseführern informiert hatte. Sie wollte vorbereitetet sein auf das, was sie erwarten würde, wenigstens ein bisschen. Pia hatte beschlossen, sich nicht beirren zu lassen und diese Herausforderung anzunehmen. Sie dachte an ihre Tante Clara, deren Motto war, dass alles im Leben seinen Sinn hatte. Bei näherer Betrachtung hatte Pia gar keine andere Alternative gehabt. Wenn sie in ihrem Beruf weiterarbeiten wollte, musste sie die Stelle annehmen, daran führte kein Weg vorbei. Und da war Hamburg nicht die schlechteste Wahl. Sie hatte sich eine kleine Zweizimmerwohnung in der Nähe der Klinik gemietet. Nicht die schönste Wohnlage, aber sehr zentral mit einem guten Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel, falls Pia auf ihr Auto verzichten wollte. Die Wohnung befand sich in einem Mehrfamilienhaus, war hell und vor Kurzem frisch renoviert worden. Sie besaß sogar einen kleinen Balkon, den sie vor allem im Sommer genießen konnte, und auch für Töpfe mit ihren geliebten Küchenkräutern bot sich genügend Platz. Darauf freute sie sich schon voller Ungeduld. Vor allem war die Wohnung halbwegs bezahlbar. Pia war zufrieden und dankbar. Ihr Arbeitsvertrag war zunächst auf ein Jahr befristet. Die Chancen, nach einem Jahr nach Augsburg zurückkehren zu können, standen gut, da die Erweiterung und Modernisierung der Neuro- und Unfallchirurgie geplant waren. Bereits nach einigen Tagen in der neuen Stadt konnte Pia feststellen, dass die Menschen hier in keiner Weise abweisend oder griesgrämig waren. Die Kolleginnen und Kollegen hatten sie freundlich und offen aufgenommen und ihr den Einstieg leichtgemacht. Sture Menschen gab es, entgegen dem, was man ihr in ihrer Heimat hatte weismachen wollen, in Bayern ebenso wie schlechtes Wetter. Pia hatte schnell Freundschaft mit dieser pulsierenden Großstadt geschlossen. Hier gab es genügend Möglichkeiten, die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Auf die Sommermonate freute sie sich besonders, wenn sie draußen an der Alster sitzen, spazieren gehen, oder einen Ausflug auf einem Boot machen konnte. Sie liebte das Wasser. Am meisten aber liebte Pia das Meer. Von Hamburg an die Küste war es nicht weit. Sie hatte sich fest vorgenommen, ab und zu einen Abstecher an die Nordsee zu unternehmen, um abzuschalten und ihre Kraftreserven aufzutanken. Ihr neuer Job in der Unfallklinik war sehr anstrengend, und sie wurde täglich mit schweren Verletzungen und Schicksalen konfrontiert. Das brachte ihr Beruf mit sich. Diese Erkenntnis traf sie nicht unvorbereitet, denn sie hatte gewusst, was auf sie zukommen würde. Sie arbeitete viel, gern und hart.
Pia hatte noch ein paar Stunden Dienst bis zum frühen Morgen vor sich, denn es war erst kurz nach Mitternacht. Es war Anfang Dezember, und draußen fiel der erste Schnee. Wie dicke Wattebausche schwebte er lautlos vom Himmel. Die Schneeflocken verwandelten sich auf den Straßen dank des großzügigen Einsatzes von Streusalz leider sofort in hässlich grauen Schneematsch, der sich nur langsam auflöste.
Pia stand neben dem jungen Patienten am Bett und betrachtete ihn. Er war groß, hatte breite Schultern und kräftige Arme. Die Hände wirkten gepflegt und zeigten trotzdem, dass ihnen harte Arbeit nicht fremd zu sein schien. Das Haar war kurz, dicht und pechschwarz. Sein Gesicht hatte markante Züge und wirkte momentan ganz friedlich. Er besaß dichte Augenbrauen und lange, dunkle Wimpern. Welche Augenfarbe er wohl hatte? Aufgrund seines allgemein dunklen Typs, überlegte Pia, hatte er vermutlich warme dunkelbraune Augen. Sie stellte sich ihn in gesundem Zustand vor. Er war zweifellos eine stattliche Erscheinung. Jetzt lag er in einem Bett auf der Intensivstation, an Monitoren angeschlossen, und sein Leben hing an einem seidenen Faden. In letzter Minute hatten sie ihn retten können. Ob er seine schwere Verletzung überlebte, stand jedoch noch nicht fest. Das lag nun nicht mehr in der Macht der Ärzte. Mehr hatten die Kollegen nicht für ihn tun können. Die Zeit würde die Entscheidung über Leben und Tod übernehmen. Pia kontrollierte die Medikamentenzufuhr und die Anzeigen auf dem Monitor. Sein Blutdruck und die Sauerstoffsättigung lagen im Normalbereich. Auch sein Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig. Die grüne Linie auf dem Bildschirm zeigte an, dass sein Herz regelmäßig im Takt schlug. Zusätzlich war der Patient an ein Beatmungsgerät angeschlossen, für den Fall, dass seine Atmung plötzlich aussetzte. Somit konnte jederzeit sichergestellt werden, dass die Lunge ununterbrochen Sauerstoff bekam und Gehirn und Blutbahn weiterhin versorgt wurden. Er musste über eine sehr gute körperliche Konstitution verfügen, sonst hätte er es nicht soweit geschafft. Pia vermerkte alle Werte ordnungsgemäß auf dem Krankenblatt.
Es war ungewöhnlich ruhig geblieben in der letzten Stunde auf der Station. Vielleicht lag es daran, dass sie heute ausnahmsweise personell nicht unterbesetzt waren. Für gewöhnlich herrschte zu dieser Jahreszeit chronische Unterbesetzung, da viele Kolleginnen und Kollegen krank waren oder Resturlaub nahmen. Die starke physische und psychische Belastung, der sie in diesem Beruf ausgesetzt waren, ging an niemandem spurlos vorbei. Weil Pia den üblichen Papierkram bereits erledigt hatte, und das Stationszimmer durch ihre Kollegin Laura besetzt war, zog sie sich einen Stuhl neben das Bett des Patienten und setzte sich. Sie fragte sich, wie es zu seiner schweren Verletzung gekommen sein könnte. War er in eine Prügelei geraten, bei der am Ende eine Waffe gezogen und er von einer Kugel getroffen worden war? War er zufällig zum Opfer geworden und versehentlich in die Schusslinie geraten? Oder war er ein Polizeibeamter, der in Ausübung seines Berufes verletzt wurde? Vielleicht handelte es sich bei dem Patienten sogar um einen Kriminellen. Doch das wollte sich Pia lieber nicht vorstellen. Nein, wie ein Straftäter sah er nicht aus. So viel sie auch grübelte, eine Antwort auf ihre Fragen würde er ihr in seiner jetzigen Situation nicht geben können. Er. Wer war er? Wie lautete sein Name? Sie hatte vorhin nicht darauf geachtet, als sie die Eintragungen gemacht hatte. Pia angelte erneut nach dem Krankenblatt und schlug die blaue Plastikmappe auf. In dem Namensfeld, in dem Vor- und Nachname des jeweiligen Patienten festgehalten wurden, war lediglich ein Wort eingetragen: Skander. Damit konnte sie auf Anhieb nichts anfangen. War das sein Name? Wenn ja, warum besaß der Patient keinen kompletten Namen, so wie sie Pia Könemann hieß? In Gedanken versunken blieb sie eine Weile an seinem Bett sitzen, bis ihre Kollegin Laura vorsichtig den Kopf zur Tür hineinsteckte und sie zu sich winkte. Pia stand leise auf und huschte durch den Türspalt hinaus auf den Flur. Behutsam schloss sie die Tür hinter sich.
»Alles in Ordnung?«, wollte Laura wissen und deutete mit dem Kopf in Richtung des Patienten.
»Ja, er ist stabil. Ich hoffe, das bleibt so. Noch ist er nicht über den Berg.«
Laura nickte zustimmend. Dann sagte sie: »Kennst du ihn?«
»Nein, ich kenne ihn nicht. Wieso fragst du?« Pia irritierte die Frage.
»Weil du lange bei ihm warst. Da dachte ich, dass ihr euch kennt.«
Pia zögerte kurz, bevor sie antwortete. »Nein, ich habe ihn vorher nie gesehen. Einfach nur so. Ich dachte, es könnte nicht schaden, wenn jemand bei ihm ist.«
Sie sah den skeptischen Blick ihrer Kollegin. Vermutlich glaubte sie ihr nicht.
»Du musst nichts erklären, Pia, es war lediglich eine Frage, mehr nicht. Sicher schadet es nicht, wenn jemand bei ihm ist, da gebe ich dir recht. Bleib ruhig. Ich hole dich, wenn du anderweitig gebraucht wirst. Es ist nicht viel los momentan. Beinahe unheimlich, diese Ruhe.«
Nachdenklich ging Pia zurück in das Zimmer. Lauras Zweifel an ihrer Antwort waren nachvollziehbar. Pia hätte an ihrer Stelle ähnlich reagiert. Ihre Patienten waren ihr nie gleichgültig, und sie tat alles, um ihnen die bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen. Dabei achtete sie stets darauf, die emotionale Grenze nicht zu überschreiten. Sie trat einen Schritt näher an das Bett und betrachtete den Mann darin. Warum übte er eine solche Faszination auf sie aus? Pia hatte selbst keine plausible Erklärung dafür. Im Grunde war er doch nur ein Patient wie jeder andere auch.
Die restliche Nacht und die frühen Morgenstunden verliefen ebenfalls wider Erwarten ruhig auf der Station.
»Das ist sehr ungewöhnlich. Längere Ruhephasen kommen bei uns praktisch nicht vor, musst du wissen. Normalerweise geht es hier zu wie im Taubenschlag«, hatte eine erfahrene, ältere Krankenschwester Pia erklärt, als sie sich einen Kaffee aus dem Schwesternzimmer holte. Eine bleierne Müdigkeit drohte, sie für einen kurzen Augenblick einzuholen.
Einige wenige Patienten wurden eingeliefert, aber sie hatten im Allgemeinen kleinere Verletzungen, die in den meisten Fällen ambulant behandelt werden konnten und keiner stationären Aufnahme bedurften. Eine ältere Dame mit Herzrhythmusstörungen wurde vorsichtshalber zur Beobachtung bis zum nächsten Tag aufgenommen. So konnte sich Pia pünktlich kurz nach 6.00 Uhr morgens auf den Heimweg machen. Bevor sie ging, sah sie noch einmal kurz im Zimmer des jungen Mannes vorbei. Sein Zustand war unverändert, seine Wunde hatte erfreulicherweise aufgehört nachzubluten.
Zu Hause in ihrer Wohnung angekommen, hängte Pia ihre Jacke an die Garderobe und legte die Zeitung, die sie aus dem Briefkasten mit nach oben genommen hatte, auf den Küchentisch. Im Vorbeigehen warf sie einen Blick auf den Anrufbeantworter, aber das kleine rote Licht blinkte nicht. Sie hatte während ihrer Abwesenheit keinen Anruf erhalten. Wer sollte auch mitten in der Nacht bei ihr angerufen haben? Sie ging ins Schlafzimmer und zog sich aus. Nachdem sie sich schnell die Zähne geputzt und das Gesicht gewaschen hatte, fiel sie todmüde ins Bett. Sie brauchte dringend ein paar Stunden Schlaf. Schließlich musste sie am Abend für die kommende Nachtschicht ausgeruht sein, um wieder voll einsatzfähig zu sein. Pia hatte die Vorhänge fest zugezogen, denn sie konnte tagsüber nur in absoluter Dunkelheit schlafen. In kurzer Zeit würde es draußen hell werden. In ihr Bett gekuschelt, schlief sie sogleich erschöpft ein.
Gegen 14.00 Uhr wurde Pia von lauten Geräuschen im Treppenhaus aus dem Schlaf gerissen. Die Kinder der Nachbarn kamen aus der Schule und nahmen – wie immer – wenig Rücksicht auf ihre Umwelt. Die Eltern verhielten sich in keiner Weise besser. Auch andere Mieter im Haus hatten sich schon häufig über die Lautstärke und Rücksichtslosigkeit der Familie beim Vermieter beschwert. Allerdings bislang ohne nennenswerten Erfolg. Pia hatte sogar in Erwägung gezogen, sich eine andere Wohnung zu suchen. Sie musste immerhin regelmäßig tagsüber schlafen, wenn sie Nachtdienst hatte. Aber in Hamburg eine bezahlbare Wohnung zu finden, die darüber hinaus verkehrsgünstig in der Nähe der Klinik lag, war so gut wie unmöglich. Außerdem mochte sie ihre Wohnung und fühlte sich wohl darin. Also blieb ihr keine andere Wahl, als sich mit den vorhandenen Gegebenheiten zu arrangieren. Sie streckte sich ausgiebig, stand auf, ging duschen und setzte sich anschließend in die Küche an ihren kleinen Küchentisch und trank einen starken Kaffee, um in Schwung zu kommen. Nachtdienste zehrten besonders an ihren Reserven. Mit dem Kaffeebecher in der Hand, blickte sie gedankenverloren aus dem Fenster. Draußen war es ungemütlich und windig. Es schien nicht richtig hell werden zu wollen. Ein grauer Wintertag. Vom Wind getriebene, nasse Schneeflocken wurden an das Küchenfenster gedrückt und rutschten wie in Zeitlupe die Scheibe herunter, wobei sie sich auf ihrem Weg nach unten langsam auflösten. Bei diesem Wetter verspürte Pia keine Lust, nach draußen zu gehen. Sie beschloss, es sich auf dem breiten Sofa bequem zu machen und zu lesen. Sie liebte Bücher über alles. Leider war sie nach Dienstschluss meistens zu müde, um sich ihnen ausgiebig widmen zu können. Dann fielen ihr schon nach zwei Seiten die Augen zu, egal wie spannend das Buch sein mochte. In ihrem Regal standen unzählige Bücher, die darauf warteten, gelesen zu werden. Das Gros davon hatte Pia geschenkt bekommen, in erster Linie von Freunden oder Patienten. Zweimal in der Woche ging sie zum Sport und selbst das fiel ihr gelegentlich sehr schwer. Für den Sommer hatte sie sich vorgenommen, öfter joggen zu gehen. In Augsburg war sie regelmäßig mit einer Nachbarin gelaufen. Hamburg bot viele geeignete Strecken. Und vielleicht würde sie jemanden finden, der mit ihr laufen ging. Sie könnte einen Aushang am schwarzen Brett der Klinik machen. Wenn jemand mitzöge, wäre es einfacher, den inneren Schweinehund zu besiegen.
Pia hatte sich in ihre dunkelblaue Wolldecke mit den weißen Sternen gekuschelt, als das Telefon klingelte. Sie angelte vom Sofa aus danach und nahm das Gespräch an.
»Hallo, Pia, hier ist Schwester Anke«, meldete sich eine freundliche Frauenstimme.
»Hallo, Anke! Was kann ich für dich tun? Hat sich etwa der Dienstplan geändert, und ich habe es vergessen?«, fragte Pia erschrocken, denn sie konnte sich keinen anderen Grund für den Anruf ihrer Kollegin vorstellen. Privat hatten sie keine Berührungspunkte, denn Anke war alleinerziehende Mutter von drei Kindern und stets im Stress. Ein Treffen nach Dienstschluss war für sie undenkbar. Pia fragte sich manchmal, wie man eine solche Doppelbelastung überhaupt meistern konnte.
»Nein, der Dienstplan hat sich nicht geändert. Deswegen rufe ich nicht an. Es geht um den Patienten, der letzte Nacht eingeliefert worden ist. Der junge Mann mit dem Bauchschuss, du weißt schon. Er …«
»Was ist mit ihm?«, unterbrach Pia sie, ihr Herz krampfte sich für einen Moment zusammen.
»Sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Er musste eben ein weiteres Mal operiert werden. Genaueres kann ich dir momentan nicht sagen. Ich weiß, dass ich dich deswegen nicht informieren sollte, aber Laura hat gesagt, er würde dir am Herzen liegen. Deshalb wollte ich dir schnell Bescheid sagen.« Sie sprach leise. Offensichtlich wollte sie vermeiden, dass jemand das Gespräch mitbekam.
»Ich bin sofort da! Vielen Dank für deinen Anruf«, erwiderte Pia und legte auf.
Sie überlegte nicht lange, zog sich in Windeseile um und fuhr auf direktem Weg in die Klinik. Sie parkte ihren Wagen auf dem Mitarbeiterparkplatz und lief zum Eingang. Nasser Schnee fiel ihr auf Jacke und Haar. Nachdem sie im Trockenen war, wischte sie ihn im Gehen mit der Hand von den Jackenärmeln und schüttelte ihr schulterlanges Haar. Sie war so hastig von zu Hause aufgebrochen, dass sie sich nicht einmal die Zeit genommen hatte, sich einen Pferdeschwanz zu binden und etwas zu schminken. Für gewöhnlich trug sie ihr Haar nie offen, es war einfach unpraktisch, vor allem während der Arbeit. Da waren offenes Haar und Schmuck sowieso tabu. Mit schnellen Schritten eilte sie den langen Gang entlang bis zu dem Zimmer des Patienten mit der Schussverletzung. Schwester Anke kam in dem Augenblick durch die Tür, als Pia eintreten wollte.
»Wie geht es ihm?«, fragte Pia besorgt. Sie wirkte abgehetzt.
»Er hat nochmal Glück gehabt. Sein Zustand ist momentan stabil.« Sie drehte den Kopf und blickte über ihre Schulter zu dem jungen Mann. »Aber vorhin sah es nicht gut aus. Er liegt seitdem im Koma. Ich wollte dich wirklich nicht beunruhigen, Pia. Du hast schließlich Feierabend.«
»Nein, das tust du nicht. Ich bin dir außerordentlich dankbar, dass du mich informiert hast. Ich werde jetzt bei ihm bleiben. In ein paar Stunden beginnt ohnehin mein Dienst.«
»Wie du meinst, das ist deine Entscheidung«, antwortete ihre Kollegin und zuckte die Achseln. »Frischer Kaffee steht bei uns im Stationszimmer, wenn du magst. Ein bisschen Kuchen ist auch noch übrig, falls du Muffins mit rosa Glasur und bunten Streuseln magst. Die Reste vom Kindergeburtstag.« Sie schenkte Pia ein freundliches Lächeln.
»Danke, klingt verlockend«, erwiderte Pia und betrat das Zimmer, nachdem sie ihre Hände sorgfältig gewaschen, desinfiziert und sich einen Kittel übergezogen hatte.
Sie rückte sich den Stuhl an das Bett und nahm darauf Platz. Der Patient lag reglos in seinem Bett. Sie strich ihm sanft mit den Fingern eine Haarsträhne aus der Stirn. Dann legte sie ihre Hand vorsichtig auf seine. Er sah noch blasser aus als zuvor, aber die Kurven auf den Monitoren zeigten keine Auffälligkeiten an. Atmung und Blutdruck waren im Normalbereich.
»Du darfst nicht aufgeben, hörst du?«, flüsterte Pia ihm zu. »Bis hierhin hast du es doch geschafft, den Rest packst du auch noch. Doktor Rupert hat wochenlang schlechte Laune, wenn sich einer seiner Patienten einfach aus dem Staub macht. Das willst du uns ja wohl nicht antun.«
Pia erwischte sich dabei, wie sie bei den Worten lächeln musste. Sie streichelte über seinen Unterarm. Dann begann sie, ihm eine Geschichte zu erzählen, die sie kürzlich gelesen hatte. Sie handelte von einem jungen Mann, der um die ganze Welt reiste, um die Frau wiederzufinden, die ihm einst das Leben gerettet hatte. Sie wusste, dass er vermutlich nichts davon mitbekommen würde, aber sie hatte einfach das unerklärliche Verlangen, mit ihm zu sprechen. Vielleicht würde sein Unterbewusstsein irgendetwas von dem aufnehmen, was sie sagte. Es gab Fälle, in denen Komapatienten mehr mitbekamen, als allgemein angenommen wurde. Und schaden würde es in keinem Fall.
Mehrere Tage vergingen, und Pia nutzte jede freie Minute, um bei Skander zu sein und ihm Geschichten zu erzählen. Er hatte das Bewusstsein noch immer nicht wiedererlangt. Manchmal berichtete sie ihm, was sie den Tag über gemacht oder erlebt hatte. Oder wie trüb und traurig das sonst so pulsierende Hamburg aufgrund des Wetters momentan wirkte. Sie wunderte sich, dass der junge Mann niemals Besuch erhielt. Er bekam weder Post, noch erkundigte sich jemand telefonisch nach ihm. Vermisste ihn denn niemand oder machte sich Sorgen um ihn? Scheinbar hatte er keine Angehörigen in der Stadt, und niemand wusste, dass er schwerverletzt im Krankenhaus lag. Ab und zu begegnete Pia einem Polizeibeamten in Zivil, der sich über den Zustand des Patienten erkundigte. Das war alles. Er war stets kurz angebunden, und weitergehende Informationen konnte Pia ihm bedauerlicherweise nicht entlocken. Sie vermutete, dass er eine Aussage zu dem, was vorgefallen war, einholen wollte.
Eines Abends nach Dienstschluss schaute Pia bei Skander vorbei, wie sie es jedes Mal tat, bevor sie sich auf den Heimweg machte. Diese täglichen Besuche waren mittlerweile zu einem festen Ritual geworden. Erst im Anschluss konnte sie beruhigt und guten Gewissens nach Hause gehen. Sie fühlte seinen Puls und vergewisserte sich, dass es ihm gut ging. Als sie zum Abschied mit ihrer Hand leicht über seine Wange strich, zuckten plötzlich seine Augenlider, und er öffnete langsam die Augen. Pia zog überrascht ihre Hand zurück, und ihr Herz machte einen gewaltigen Freudensprung. Dann blickte sie in zwei stahlblaue Augen, so blau wie sie zuvor noch keine gesehen hatte. Er sah sie direkt an, und der Hauch eines Lächelns umspielte seinen Mund.
»Hallo«, sagte Pia leise über ihn gebeugt. »Können Sie mich verstehen? Sie befinden sich im Krankenhaus.«
Mit einem schwachen Augenaufschlag bestätigte er, dass er sie verstanden hatte. Dann schloss er seine Augen. Pia stürmte aufgeregt aus dem Zimmer, um ihren Chef, Doktor Rupert, zu holen. Kurz darauf betrat dieser mit drei weiteren Kollegen und zwei Schwestern das Zimmer. Pia hielt sich im Hintergrund, während die Ärzte den Patienten eingehend untersuchten. Sie war überglücklich, dass Skander – oder wie auch immer er heißen mochte – aufgewacht war und offenbar alles verstand, was er gefragt wurde, auch wenn er nur schwache Reaktionen zeigte. Das war durchaus ein gutes Zeichen. Doktor Rupert machte Notizen auf dem Krankenblatt und schien ebenfalls erleichtert über den Zustand des jungen Mannes zu sein. Er machte ein zufriedenes Gesicht, und ließ sich sogar zu einem Scherz hinreißen, was eher selten der Fall war.
Abschließend wandte er sich an Pia und sagte: »Danke, Schwester Pia. Aber jetzt machen Sie bitte Feierabend, Sie müssen sich unbedingt ausruhen. Nicht, dass Sie uns aus den Latschen kippen.« Er lachte heiser. »Wir brauchen Sie hier dringend. Um den Patienten kümmern wir uns. Machen Sie sich keine Sorgen. Das Schlimmste hat er überstanden.«
»Ich wollte gerade nach Hause gehen und habe noch schnell nach ihm gesehen, da ist er plötzlich aufgewacht.«
»Ja, aber jetzt kommen Sie.« Doktor Rupert klopfte Pia väterlich auf die Schulter und schob sie sanft, aber bestimmt in Richtung der Tür.
Pia fühlte sich erleichtert und ging mit einem guten Gefühl nach Hause, obwohl sie insgeheim gerne geblieben wäre. Aber ihr Chef hatte recht, sie brauchte dringend Schlaf. Sie hatte die letzten Tage fast ausschließlich im Krankenhaus verbracht. Sie war nur zu Hause gewesen, um zu schlafen, zu duschen und eine Kleinigkeit zu essen. Skander hatte überlebt und er war bei Bewusstsein. Das war das Wichtigste. Vielleicht war er morgen in der Lage zu sprechen, und sie konnte endlich mit ihm reden. Plötzlich verspürte Pia ein Gefühl der Vorfreude.
Sylt, sechs Jahre später
Ein gellender Schrei war bis zum Parkplatz an der Hauptstraße zwischen Rantum und Hörnum zu hören. Es war der markerschütternde Schrei einer Frau. Der Mann, der gerade die Heckklappe seines Kombis öffnete, um seinen Hund für die morgendliche Runde am Strand herauszulassen, fuhr erschrocken zusammen. Er blickte in Richtung der Dünen, von wo der Ruf gekommen war. Dann hielt er kurz inne und lauschte. Jetzt war es wieder ganz still. Nichts rührte sich, weit und breit war niemand zu sehen. Es war 6.30 Uhr am Morgen, aber längst hell. Der Mond war noch schwach am Himmel zu erkennen, hatte jedoch die Bühne für die aufgehende Sonne freigegeben, die die Insel in ein warmes, freundliches Licht tauchte. Selbst der frische Westwind schien seine Arbeit noch nicht aufgenommen zu haben, denn es herrschte absolute Windstille. Bevor der Mann die Polizei alarmierte, wollte er sich vergewissern, dass er sich nicht getäuscht hatte. Vielleicht hatte er den Schrei einer Möwe mit dem eines Menschen verwechselt. Er befestigte die Leine am Halsband seines Hundes, schloss das Auto ab, und das Duo bewegte sich auf dem schmalen Weg aus Sand und Kies durch die Heidelandschaft in Richtung Strand. Gleich hinter einer engen Kurve kam ihm eine Frau mit einem kleinen weißen Hund entgegen. Sie hatte ein hochrotes Gesicht und konnte vor lauter Atemnot kaum sprechen. Wie es aussah, war sie den ganzen Weg durch die Dünen gerannt.
»Da unten«, japste sie aufgeregt und verschluckte sich beinahe beim Sprechen, »liegt ein Toter! Wir müssen sofort die Polizei verständigen! Schnell!«
Der Mann sah an der Frau vorbei zum Strand und konnte an der Wasserkante etwas Dunkles liegen sehen. Ob es sich dabei um ein menschliches Wesen handelte, vermochte er nicht zu sagen. Dafür war die Entfernung zu groß und seine Augen zu schlecht.
»Beruhigen Sie sich. Sind Sie sicher, dass es sich nicht um ein Tier handelt?«, fragte er.
»Ich kann sehr wohl einen Menschen von einem Tier unterscheiden«, erwiderte die Frau gekränkt und streichelte ihren Hund, den sie auf dem Arm hielt.
»In Ordnung«, versuchte der Mann, die aufgeregte Frau zu beruhigen. »Ich schlage vor, Sie bleiben hier, ich gehe mir das mal aus der Nähe anschauen und rufe anschließend die Polizei. Brauchen Sie einen Arzt?«
Die Frau hatte sich mittlerweile erschöpft in den Sand gesetzt und schüttelte energisch den Kopf.
»Nein danke, ich brauche keinen Arzt. Mir geht es gut. Ich habe mich bloß so erschrocken und bin schnell gelaufen.« Sie machte eine kurze Atempause. »Oh Gott, dieser Anblick war furchtbar! Ein Toter, hier auf dieser schönen Insel. Am frühen Morgen! Damit rechnet doch niemand!«, begann sie zu jammern.
Der Mann runzelte die Stirn und murmelte leise vor sich hin. Dann stapfte er mit seinem Hund den sandigen Weg über die Düne runter zum Meer. Er erkannte beim Näherkommen, dass es sich bei dem dunklen Etwas, das an der Wasserkante lag, tatsächlich um einen Menschen handelte. Die Frau hatte sich nicht getäuscht. Als er direkt davorstand, sah er, dass der leblose Körper eindeutig ein Mann war. Der Tote war mit einem Taucheranzug bekleidet. Er hatte blondes Haar. Einige Haarsträhnen und bräunliche Algen klebten ihm im Gesicht, das von grün schimmernden Schmeißfliegen heimgesucht wurde. Der Mund war leicht geöffnet. Seine Haut war aufgedunsen und blass und hatte eine wächserne Beschaffenheit angenommen. Die Augen waren weit aufgerissen und starrten leblos in den wolkenlosen Morgenhimmel. Der Mann mit Hund atmete tief durch und wandte sich ab, denn bei diesem Anblick überkam ihn schlagartig eine starke Übelkeit. Obwohl er seit vielen Jahrzehnten Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort war und schon einige Tote gesehen hatte, war dieser Anblick auf nüchternen Magen selbst für hartgesottene Männer, wie er einer war, alles andere als angenehm. Er zog sein Handy aus der Jackentasche, trat ein paar Schritte von der Leiche weg und wählte den Notruf der Polizei.