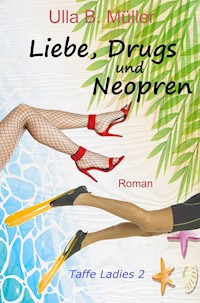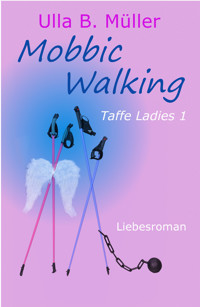
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer walkt, gewinnt! Gibt es etwas Schlimmeres als einen runden Geburtstag? Für Mona auf jeden Fall. Sie muss nicht nur die Fünf vor der Null verdauen, sondern auch eine superschlanke Fitness-Granate, die es auf ihren Arbeitsplatz abgesehen hat. Da Mord nicht die Lösung ist, um ihre Stelle in der Sportequipment-Firma zu behalten, bleibt ihr nur der steinigste aller Wege: Abnehmen und Sport. Ausgerechnet dabei trifft sie auf den größten Stolperstein, ihren Nordic-Walking-Trainer. Die Laufstrecke verwechselt er mit einem Truppenübungsplatz, aber seiner Mutter im Seniorenheim liest er jeden Wunsch von den Augen ab. Es kostet Mona Tränen, Schweiß und Nerven, bis sie begreift, wie wichtig der attraktive Quälgeist für sie ist. „Mobbic Walking“ ist eine humorvolle, charmante und zugleich inspirierende Geschichte über Durchhaltevermögen, unerwartete Begegnungen und die Macht der Liebe - immer mit einem Augenzwinkern und der richtigen Portion Herz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Schlussworte von Ulla B. Müller
Bisher erschienen:
Inhaltsverzeichnis
Ulla B. Müller
Mobbic Walking
Roman
Copyright © 2015 Ulla B. Müller
Das Buch
Gibt es etwas Schlimmeres als einen runden Geburtstag? Für Mona auf jeden Fall.
Sie muss nicht nur die Fünf vor der Null verdauen, sondern auch eine superschlanke Fitnessgranate, die es auf ihren Arbeitsplatz abgesehen hat. Da Mord nicht die Lösung ist, um ihre Stelle in der Sportequipment-Firma zu behalten, bleibt ihr nur der steinigste aller Wege: Abnehmen und Sport. Ausgerechnet dabei trifft sie auf den größten Stolperstein, ihren Nordic-Walking-Trainer. Die Laufstrecke verwechselt er mit einem Truppenübungsplatz, aber seiner Mutter im Seniorenheim liest er jeden Wunsch von den Augen ab.
Es kostet viel Schweiß und Nerven, bis Mona begreift, wie wichtig dieser attraktive Quälgeist für sie ist.
Die Autorin
Ulla B. Müller, geboren 1957, arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin einige Jahre im Krankenhaus, später in ihrer eigenen Praxis – die beste Voraussetzung, um die beruflichen Anforderungen und einen Haushalt mit vier Kindern unter einen Hut zu bringen. In dieser turbulenten Phase entstanden ihre ersten amüsanten Kurzgeschichten, von denen zwei bereits mit Preisen ausgezeichnet wurden. Interessante Charaktere und ungewöhnliche Geschichten aus ihrem familiären und beruflichen Alltag bilden die Grundlage für ihre Romane. Heute lebt Ulla B. Müller mit ihrem Mann in Monheim am Rhein, auf den Zentimeter genau zwischen Helau und Alaaf. Ihre Bücher schreibt sie für Frauen, die schon länger aus den Teenager-Jeans heraus sind.
Impressum
© 2015 Ulla B. Müller
Alle Rechte vorbehalten.
Am Mühlenhof 1
40789 Monheim am Rhein
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Barbara Frank
Satz, Layout und Coverlayout: Dr. Werner Müller
Coverfoto: Ulla B. Müller
Kapitel 1
Das war Teufelswerk. Mona spürte es ganz deutlich. Wie jeden Morgen musste sie auf dem Weg vom Parkplatz zum Fabrikgebäude an dieser Bäckerei vorbei, und meistens schaffte sie es ohne Unterbrechung. Auch heute war sie schon ein paar Meter weiter. Doch mit einem Mal wurden ihre Füße immer schwerer, und plötzlich kam sie überhaupt nicht mehr von der Stelle. Eine unsichtbare Macht zwang sie kehrtzumachen und noch einmal auf das Angebotsschild am Eingang zu schauen. Verflixt! Da stand es wirklich: Drei Schokocroissants zum Preis von zwei. Selbst wenn man höchstens zwei schaffte, würde kein vernünftiger Mensch so blöd sein und der Frau hinter der Theke zusäuseln: „Packen Sie mir ruhig eins weniger ein.“ Das machte man doch nicht! Eher würde man sich das dritte für später aufheben, auch auf die Gefahr hin, dass es nach kurzer Zeit labberig in sich zusammenfiel.
Entschlossen öffnete Mona die Ladentür und kehrte nach drei Minuten mit der prall gefüllten Sonderangebotstüte und einem Kaffee im Pappbecher wieder. Heute war es sowieso egal. Der Tag war so gut wie gelaufen.
Wenige Minuten später stand sie vor ihrem Büroschreibtisch und lud alles, was sie in den Händen hielt, vor die Tastatur ihres Rechners. Im Nu überlagerte herrlicher Kaffeeduft das Luftgemisch aus verstaubten Heizkörpern und Industrie-Teppichboden.
Ihr Schreibtischstuhl ächzte, als sie sich zurücklehnte und sich dem himmlischen Geschmack der kleinen Schokoladenstückchen aus dem ersten Croissant hingab. So ein früher Morgen, ganz allein in der Firma, hatte etwas Angenehmes, etwas Friedliches.
Heute war sie nur Rudi, dem Pförtner, begegnet.
„Tach, Frau Seitz“, hatte er sie begrüßt und dabei wie gewöhnlich mit zwei Fingern an die Stirn getippt. „Heute doch in die Firma?“ Zum Lächeln war ihm bei dieser Frage nicht zumute gewesen.
„Ja, ja. In den zwei Stunden bis elf kann ich noch Einiges vom Tisch kriegen.“ Mona hatte schon ein wenig schlucken müssen, als ihr die schwarze Armbinde an seinem rechten Hemdsärmel aufgefallen war.
Mit den anderen Kollegen brauchte sie an diesem Freitagmorgen nicht zu rechnen.
Obwohl es nicht zum Anlass des heutigen Tages passte, hatte der Morgen auch zu Hause schon überraschend gut begonnen, als sie ihr schwarzes Kostüm anprobierte, das seit der Abiturfeier ihres Sohnes vor fünf Jahren unbenutzt im Schrank schlummerte. Ihre düsteren Vorahnungen hatten sich zum Glück nicht bewahrheitet. Es passte noch. Besser gesagt, gerade noch so eben. Nur das eisgraue ärmellose Oberteil mit dem Bündchen am Hals hatte sie nach der Anprobe schnell wieder zurückgehängt. Es hatte sich wie ein Taucheranzug an ihren Körper geschmiegt, wobei das noch sehr schmeichelhaft formuliert war. Und heute Vormittag ging es eher darum, auf- und nicht abzutauchen.
Sie hatte es mittlerweile aufgegeben, sich wegen der fünfzehn Kilo mehr ständig selbst mit Vorwürfen in den Ohren zu liegen. Seit ihrer Scheidung von Henning war ihr Gewicht so ziemlich das Letzte, mit dem sie sich herumschlagen wollte. Ihre beste Freundin hatte sie schon öfters dezent darauf hingewiesen, dass es für fast alle Lebensmittel auch Light-Versionen gab. Ute war zwar Köchin, aber trotzdem ungewöhnlich schlank und das sogar ohne Nikotin oder Pülverchen aus der Apotheke. Sie musste auch schlank sein, denn sie hatte sich vor zwei Jahren zur Ernährungsberaterin fortbilden lassen, und wer eiferte schon jemandem nach, der mit einer Taillenweite jenseits von Gut und Böse herumlief? Für Monas Lieblinge, Croissants und Nougatschokolade, fiel Ute allerdings auch keine fettarme Variante ein, und die patzige Ausrede, dass die zusätzlichen Pfunde im Alter gut gegen Falten wirkten, wurde von ihr nur müde belächelt.
„Da kannst du dir gleich Botox spritzen lassen. Das hat wahrscheinlich weniger Nebenwirkungen als dein Übergewicht. Aber wie wär’s denn mal mit Sport? Das strafft auch.“ Als Nächstes folgte der läppische Spruch: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, und Walking oder Schwimmen bildeten dann die Quintessenz ihrer freundschaftlichen Empfehlungen, angesichts der drallen Figur ihrer Freundin.
Mona beantwortete diese Art von Ratschlägen gewöhnlich mit einem genervten Augenrollen. Gut kochen können und gertenschlank sein - nie würde sie begreifen, wie das zusammenging. Und wenn einem beziehungstechnisch übel mitgespielt wurde, erwartete man auch in einem Plus an Körperertüchtigung keine Wunder. So entschied sie kurzerhand, ihr Gewicht vorübergehend aus ihrem näheren Wahrnehmungsbereich auszuschließen und die drei Kleidergrößen mehr unter der Rubrik Trostpflaster zu verbuchen.
Die Sonne schien bereits streifenförmig durch die Lamellen der Jalousie und heizte den Büroraum zusehends auf. Für die zwei geplanten Arbeitsstunden war ihre Garderobe jetzt schon entschieden zu warm. Mona hielt rücklings den rechten Ärmel ihres Blazers fest und versuchte krampfhaft den Arm herauszuziehen. „Mona Seitz, eine rheumageplagte Anakonda häutet sich mit Sicherheit eleganter“, mopperte sie vor sich hin, als sie trotz merkwürdiger Körperwindungen nicht aus der schwarzen Hülle herauskam. Zu allem Übel klingelte auch noch das Telefon. Bevor die rechte Hand endlich befreit zum Hörer greifen konnte, krachte es am vorderen Ärmelansatz. Die Naht zur Schulter klaffte zehn Zentimeter weit auseinander und gestattete einen freien Durchblick auf das seidige Innenfutter.
„Mist!“, zischte Mona und legte den Hörer ans Ohr.
„Ja, genau darum geht’s. Es geht um den Mist, den sie meiner Mutter vor zwei Wochen geliefert haben. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem Kundendienst der Firma Kaiser verbunden bin?“ Die dunkle Männerstimme klang sehr bestimmt und sehr unzufrieden.
„Ja, natürlich. Entschuldigung. Firma Kaiser, Seitz am Apparat. Was kann ich für Sie tun?“ Schnell pfefferte sie die Jacke mit dem Stoffkrater auf den Besucherstuhl. An ihrem Ohr schien sich ein größerer Abgrund aufzutun.
„Sie haben meiner Mutter vor genau zwei Wochen einen Rollator geliefert. Seitdem muss ich mir ständig Beschwerden über dieses Ding anhören. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich nicht scharf darauf bin, meine fünfundachtzigjährige Mutter demnächst wochenlang in der Klinik zu besuchen, weil sie mit diesem klapprigen Ding von Ihnen zusammengebrochen ist.“ Die Stimme verlor mehr und mehr an Sachlichkeit. Dafür stieg die Lautstärke.
Mona schüttelte mitfühlend den Kopf. „Ja, das verstehe ich. Das darf auf keinen Fall passieren. Unsere Produkte sollen selbstverständlich helfen und nicht Probleme bereiten. Deshalb schicken wir bei der Auslieferung auch immer einen fachkundigen Mitarbeiter mit, der das Gerät genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden einstellt. Bitte nennen Sie mir kurz die Rechnungsnummer, dann schaue ich schnell nach, um welchen Vorgang es geht.“
„Die Rechnung hab ich gerade nicht vorliegen, aber so schwer kann es doch nicht sein, das herauszubekommen. Oder arbeiten Sie noch nicht mit Computern? Die Farbe nennt sich übrigens savannengelb, und ein Schirm mit Halterung war auch dabei.“
Mona schnitt eine furchteinflößende Grimasse, während sie die gesuchten Dateien aufrief und den Lautsprecher des Telefons einschaltete. Was bildete dieser Typ sich eigentlich ein? Dass sie noch mit Stenoblock und Kopierpapier unterwegs war?
„Eine Sekunde bitte noch“, bat sie und rief die Seite mit den Bestellungen auf. Wenige Klicks später erschienen die letzten zwanzig Auslieferungen auf dem Bildschirm. „Bitte nennen Sie mir doch den Namen Ihrer Mutter. Dann hab ich es sofort.“
„Er wurde von mir bestellt. Johannes Tannhäuser. Das muss Anfang Juli gewesen sein.“
Mona atmete auf. Ein Rollator vom Typ Gepard wurde am 8. Juli bestellt und am 10. Juli ausgeliefert. Er war der einzige, der in diesem Monat mit Schirm und dazugehöriger Halterung in Auftrag gegeben wurde.
„Ja, richtig. Hier sehe ich ihn. Eigentlich gab es bei diesem Modell bisher nur zufriedene Kunden. Der Gepard ist lenkfreudig durch seinen schlanken Leichtmetall-Korpus, dabei sehr kippstabil, und er lässt sich mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenschieben.“
Aus den vielen Jahren im Kundendienst wusste Mona, dass man männlichen Beschwerdeführern leicht mit technischen Details den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Aber diesmal spürte sie deutlich, dass die Sache schwierig wurde. Wie konnte sie diesen arroganten Schnösel bloß noch von der Qualität des Produkts überzeugen? Immerhin hatte er das Paradepferd des Unternehmensstalls erworben. Eine andere Strategie musste her, entschied Mona. Wenn es über die technische Schiene nicht lief, dann eben über die psychologische.
„Vielleicht braucht Ihre Mutter noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Älteren Menschen können sich oft nicht so schnell an Veränderungen in ihrem Umfeld anpassen“, erklärte sie betont freundlich.
„Ihre Erfahrung mit alten Leuten in Ehren, aber das ist nicht der Punkt. Meine Mutter ist noch recht gut beieinander, und sie behauptet, der Rollator habe einen Rechtsdrall, und alles würde an ihm klappern. Das hat ja wohl nichts mit Eingewöhnung zu tun. Am liebsten würde ich ihn sofort zurückbringen, aber sie ist halt auf ihn angewiesen. Vielleicht lassen Sie sich beizeiten etwas einfallen, bevor sie mit diesem Montagsmodell zusammenbricht. Ein Rechtsstreit über die Behandlungskosten kann für Ihre Firma nämlich teuer werden.“
So weit durfte es auf keinen Fall kommen. „Herr Tannheimer, wir schicken umgehend jemanden zu Ihrer Mutter und überprüfen den Rollator. Falls er wirklich schadhaft ist, wird er sofort ersetzt. Das garantiere ich Ihnen.“
„Tannhäuser heiße ich, wie der Minnesänger, nicht Tannheimer. Und ich verlasse mich auf Ihr Wort. Umgehend heißt bei mir heute oder spätestens morgen. Sonst hören Sie auch umgehend wieder von mir“, ertönte es trotz der auffällig sonoren Stimme ganz und gar nicht minnehaft an Monas Ohr.
„Sie können sich auf mich verlassen. Wir kümmern uns sofort darum.“
Nach der sehr knapp ausgefallenen Verabschiedung legte sie den Hörer zurück auf die Basis und nahm einen Schluck Kaffee. Vor ihren Augen erschien eine wunderschöne Hügellandschaft. Und plötzlich sah sie auch eine Burg und einen gut aussehender Galan, der unter einem der Fenster auf einer Laute zupfte und seiner Auserwählten betörende Liebeslieder vorsang. Doch die Realität konnte hart sein. Es war nur ihre Bildschirmoberfläche. Weder war sie das angeschmachtete Burgfräulein noch der Kerl am Telefon ein Minnesänger. Mit seiner Meckerei glich er eher dem zornigen Rumpelstilzchen.
Mona sah erschreckt auf ihre Armbanduhr. Es war bereits halb elf. Heute würde jedenfalls aus ihrer Zusage nichts mehr. Bis morgen musste sich die alte Dame noch behelfen, denn in einer knappen halben Stunde war die gesamte Belegschaft der Firma Kaiser auf dem Friedhof anzutreffen.
Mona kramte aus einem Schächtelchen in ihrer Schreibtischschublade Sicherheitsnadeln und steckte fünf von ihnen in den Mund. Dann krempelte sie den Jackenärmel hastig auf links und bohrte eine Nadel nach der anderen in den Stoff. Vorsichtig zog sie die Reparaturarbeit wieder an. Der Spiegel an der Wand über dem Waschbecken ließ sie entsetzt zusammenfahren. Eine hässliche metallgespickte Zick-Zack-Wurst schlängelte sich von der Achsel aufwärts zum Schulterpolster.
Egal. Auf Schönheit kam es gleich sowieso nicht an. Mona schnappte ihre Handtasche, schloss ihr Büro ab und hastete zu ihrem Wagen. Doch gleich an der nächsten Straßenkreuzung ging nichts mehr.
„Nun mach schon!“ Genervt trommelte sie mit beiden Händen auf das Lenkrad und blickte auf die Uhr im Armaturenbrett. Die Ampel war wieder bei Rot angekommen, nachdem der Fahrschulwagen vor ihr zum dritten Mal einen Meter vorgehupft war und dann abrupt stillstand, nun bereits halb auf dem Zebrastreifen.
„Herrgott ja, ich weiß. Wir haben alle mal so angefangen“, maulte sie und drehte die Handflächen flehend nach oben. Ein bisschen erinnerte sie das Ganze an ihren Sohn. So lange war es noch gar nicht her, dass Rico sie auf dem Verkehrsübungsplatz schier zur Verzweiflung brachte, weil zwischen dem Anfahren eines Wagens und dem Bedienen eines Handys anscheinend Welten lagen.
Der junge Fahrschüler vor ihr tat ihr ja auch leid. Aber im Moment hatte sie es eilig, äußerst eilig, denn eine Leiche wartete bekanntlich nicht, bis der letzte Trauergast in der Kirche angekommen war, um sie auf dem Weg zur endgültigen Ruhestätte zu begleiten.
Mona versuchte es mit Suggestion, indem sie sich in die Füße des Schülers hineindachte. Manchmal half das ja. „Kupplung treten. Ersten Gang einlegen. Rechter Fuß drückt vooorsichtig das Gaspedal, linker Fuß gibt laaangsam nach.“
Die Ampel sprang mutig auf Grün. Neues Spiel, neues Glück. Der Motor vor ihr heulte auf, und sie verzog das Gesicht. Doch diesmal machte der Wagen nur einen winzigen Hupfer und stockerte dann endlich vorwärts über die Kreuzung.
„Geht doch!“, rief sie erleichtert, riss das Lenkrad nach rechts und bog in die Seitenstraße ab. Wenige Minuten später stand sie vor dem Waldfriedhof und suchte nach einem freien Parkplatz.
Eine Kette schwarzer Edellimousinen war wie üblich so luftig geparkt, dass ein gutbürgerliches Auto gerade soeben nicht mehr dazwischenpasste. Normalerweise zahlte es Mona diesen Parkplatzhirschen gern heim, indem sie kurz den Abstand abschätzte und dann ihr fahrbares Raumwunder auf den Millimeter genau in eine der Lücken zirkelte. Zum Aussteigen reichten ihr früher zwanzig Zentimeter neben der Fahrertür. Aber erstens ließ ihre Trauergarderobe keine akrobatischen Verrenkungen beim Aussteigen zu, und zweitens war bei dem edlen Fuhrpark Zurückhaltung geboten, denn bei den Besitzern handelte es sich ausnahmslos um ihren Chef und dessen vornehmen Clan. So blieb Mona nichts anderes übrig, als ihren Wagen zwischen den Friedhofs-Komposthaufen und den Ständer mit den Leihgießkannen zu quetschen. Zu allem Ärger sank sie beim Aussteigen mit ihren Stöckelschuhen so tief in den lockeren Boden ein, dass sie auf dem Weg hinauf zur Kapelle mehrmals kräftig auftreten musste, um die klebrigen Humusklumpen am Absatz wieder loszuwerden.
Die letzten, die noch vor der kleinen Kirche standen, waren einige Raucher. Sie zogen eilig an ihren Zigaretten und starrten dabei gedankenverloren über das Friedhofsgelände. Als das Glockengeläut allmählich dem Ende entgegentrudelte, drückten sie die Stummel in den sandgefüllten Aschenbecher neben der Pforte.
Mona hastete mit kurzen Trippelschritten über den Vorplatz. Mehr ließ der Rock ihres Kostüms nicht zu. Mit dem letzten Glockenschlag überschritt sie die Schwelle des Andachtsraums. Ein Kirchendiener wies ihr mit vorwurfsvollem Blick den einzigen noch freien Stuhl in der hintersten Reihe zu. Bevor sie ihren Platz erreichen konnte, musste sie sich an zwei abgestellten Gehwagen vorbeischlängeln. Das rosafarbene Schirmchen des einen schrubbte ihr dabei unter dem Kinn entlang. Mona erkannte die Modelle sofort. Sie waren schließlich ihr tägliches Brot. Ein heller, zierlicher Gepard und der etwas robuster gebaute Panther in olivgrün aus der aktuellen Produktpalette ihrer Firma. Daneben noch ein roter, breitspuriger Rollstuhl von der Konkurrenz.
Der Friedhofshelfer schloss nun feierlich die beiden Flügel des Portals und verschwand hinter einem dunkelvioletten Filzvorhang an der rechten Seite.
Mona wischte mit dem Taschentuch den Schweiß von Oberlippe und Schläfen und pustete die dunklen Haarsträhnen auf der Stirn in die Höhe. Ihre neue, lockige Frisur ließ wenigstens Luft an den Hals. Obwohl der Kirchenraum trotz des anhaltenden Sommerwetters kühl war, fühlte sie sich in ihrem schwarzen Kostüm wie in eine Heizdecke gehüllt. Als junge Frau fröstelte sie schon bei dem Gedanken an eine Kirche, aber wenn man so um die Fünfzig war, konnte selbst ein steinernes Gotteshaus zu einer Sauna werden. Gut, dass es Gesangsblättchen gab, mit denen man sich Frische zufächeln konnte.
„Machen Sie nicht so einen Wind! Wir sind doch hier nicht beim Flamenco-Tanzen in Spanien“, krähte es ihr plötzlich von rechts ins Ohr.
„Die sind zum Singen da und nicht zum Herumflattern. Denken Sie doch an die arme Verstorbene!“, wurde Mona von links mit einem knochigen Fingerzeig auf das Faltblättchen in ihrer Hand belehrt.
„Ja, natürlich. Entschuldigung“, murmelte Mona und überlegte, inwieweit Zugluft für Tote schädlich sein könnte.
Die eine der beiden Seniorinnen hatte sie beim Niedersetzen von der Seite her betrachtet und ihr dann eins der Liederblätter zugesteckt. „Wir kennen die Strophen auswendig“, verkündete sie, ohne sie dabei anzusehen. „Schließlich singen wir seit Jahren im Kirchenchor.“
„Seit Jahrhunderten“, rechnete Mona beim Anblick der beiden Alten großzügig hoch.
„Und wir haben bei keiner Probe gefehlt“, trumpfte die andere Gesangsschwester auf und starrte dabei ebenfalls beharrlich nach vorn.
„Bei keiner“, echote die Gegenseite.
Mona nickte beeindruckt nach rechts in das runzelige Gesicht mit praktischem Kurzhaarschnitt in Aschgrau und dann nach links in das ungefähr gleichaltrige mit lilaweißer Wolle obenauf. Nun war ihr auch klar, warum die zwei Frauen für hitzige Körperzustände nichts mehr übrig hatten. Sie waren längst jenseits des Fächelns angekommen. Demütig ließ sie das Blättchen sinken. Daraus singen würde sie jetzt jedenfalls nicht mehr. Gegen die geballte Vertretung des Kirchenchors wollte sie mit ihrer weichen, untrainierten Stimme auf keinen Fall in Konkurrenz treten.
Stühle rückten, Kleider raschelten, Brillenetuis klappten auf und zu, Nasen wurden geputzt und Kehlen frei geräuspert. Dann herrschte Stille.
Vorn auf der Empore, in einem mattweißen Sarg mit goldenen Beschlägen, umrahmt von riesigen, kostspieligen Kränzen, Bouquets und klobigen, weißen Kerzen lag Cleopatra.
Während die Orgel mit einem melancholischen Melodienreigen das Beerdigungszeremoniell eröffnete, versuchte Mona zu erkennen, wer alles in der ersten Reihe saß. Wie erwartet machte Cäsar, ihr Chef, den Anfang. Immerhin war es seine Frau Brigitte, die man heute - nicht ganz unerwartet - im Alter von 62 Jahren zu beerdigen hatte. Der Inhaber des Familienunternehmens Rolf Julius Kaiser wurde seit jeher von der Belegschaft huldvoll Cäsar genannt. Als sein Vater Karl Julius Kaiser noch lebte, versah man der Übersicht halber Vater und Sohn mit dem Zusatz 2 und 3.
Kurz nach der Geschäftsübergabe an den Sohn vor mehr als zwanzig Jahren heiratete Cäsar 3 dann Cleopatra, die mit bürgerlichem Namen Brigitte Stockmann hieß, die einzige Tochter des örtlichen Bierbrauers. Cleopatra hielt man mit gutem Grund aus allen betrieblichen Belangen heraus. Sie besaß ein wenig belastbares Nervenkostüm und war schon mit der Planung und Herstellung der Generation Cäsar 4 gänzlich überfordert. In der Belegschaft munkelte man zwar viel darüber, dass sie weder konnte noch wollte, aber Genaues wusste niemand. Cäsar schien jedenfalls nicht der Schuldige für den kinderlosen Zustand seiner Ehe gewesen zu sein. Sein sehnlichster Wunsch sei ein würdiger Nachfolger, ließ er unter reichlich Spirituoseneinfluss im Rahmen einer Jubiläumsfeier durchblicken. Aber dazu hätte seine Frau ihren exzentrischen Lebensstil aufgeben müssen, und daran lag ihr wenig. Unter den Mitarbeitern hieß es, dass der Haussegen seitdem erheblich schief hing und Cleopatra in den darauffolgenden Jahren statt zur fürsorglichen Mutter zu einer despotischen Herrscherin der Kaiserlichen Villa mutierte. Von Anfang an kursierten Schauermärchen über Putzfrauen, die mit Heulkrämpfen aus dem Haus stürmten und schikanierte Gärtner, die der Hausherrin wutentbrannt rieten, den Garten betonieren zu lassen, um ihn garantiert unkrautfrei zu bekommen. Zuletzt munkelte man unter den Mitarbeitern, dass Cleopatras kleiner Hang zur Flasche wohl gesundheitliche Folgen gehabt haben musste, denn in der Öffentlichkeit wurde sie schon Jahre vor ihrem Tod nicht mehr gesehen.
Auch Mona hatte in den letzten Monaten beobachtet, dass Cäsar immer mehr Zeit in der Firma verbrachte. Hier fand er das, was er zu Hause vermisste. Zuspruch, Anerkennung und Wärme. Hier war er der Boss.
Die Firma Kaiser behauptete sich mit der Herstellung von Gehhilfen, Handstöcken aller Art und Rollatoren mindestens so beharrlich auf dem Markt wie ein Babyschnuller-Fabrikant. Nach dem Motto „Gehumpelt wird immer irgendwann“ ging es mit dem Umsatz in den vergangenen Jahren stetig aufwärts. Die Belegschaft brauchte keine gravierenden Einschnitte zu befürchten, und Cäsar war sehr zufrieden mit diesem Zustand. Stets zeigte er sich großzügig, wenn es um Geburtstage oder Jubiläen ging. Monas vorsichtige Anmerkung, man müsse innovativ denken, um auch in Zukunft auf dem Markt bestehen zu können, nahm er sehr gelassen. „Frau Seitz, Innovation ist ein modernes Schlagwort. Aber Sie sehen das zu pessimistisch. Ich als alter Volkswirt sage Ihnen: Der demografische Wandel ist und bleibt unser bester Auftraggeber. Da besteht kein Grund zur Sorge.“
Ein paar Mal hatte sie noch versucht, ihn auf das vorhandene Risiko hinzuweisen, aber zuletzt hatte Cäsar ihr dazu nur noch jovial auf die Schulter geklopft. „Sie machen gute Arbeit, Frau Seitz, und die Zahlen stimmen. Was wollen wir mehr?“
Danach hatte Mona es endgültig aufgegeben, ihrem Chef ein wirtschaftliches Gefahrenszenario aufzuzeigen und ihm dadurch die Stimmung zu vermiesen. Aber es wurde ihr von Monat zu Monat mulmiger, denn eins wusste sie genau: Wenn ihre Befürchtungen Realität wurden und der Umsatz zurückging, dann stand ihr Arbeitsplatz ganz oben auf der Liste der überflüssigen. Auf eine Marketing-Fachkraft konnte eher verzichtet werden als auf eine Kantinenhilfe. Und für eine neue Arbeitsstelle hatte Mona ein absolutes K.-o.-Kriterium in der Tasche: In wenigen Wochen war ihr fünfzigster Geburtstag.
Ihre gleichaltrigen Freundinnen meldeten sich bereits zu Volkshochschulkursen über die Freizeitgestaltung nach der Berentung an - Sie durfte nach den neusten Berechnungen noch bis sechsundsechzig drei Viertel arbeiten. Einige Schulkameradinnen feierten ihre Silberhochzeit auf einem Kreuzfahrtschiff und wurden von Kindern beglückwünscht, die längst ihr eigenes Geld verdienten - Sie hatte nach ihrer Scheidung noch einen deftigen Kredit abzuzahlen und in Amerika einen studierenden Sohn, der chronisch abgebrannt war. Und da sollte man keinen Schweißausbruch bekommen? Mona atmete tief durch und verbrauchte drei Taschentücher zum Trockentupfen, bevor sie sich wieder auf die Trauerzeremonie konzentrieren konnte.
Neben ihrem Chef erkannte sie die eingesunkene Gestalt seiner neunzigjährigen Mutter Lydia, die schon mehrere Jahre in einer Seniorenresidenz lebte. Anfangs schrieb man ihre leichte Verwirrtheit dem schlechten Hören zu. Doch das teure Hörgerät mochte die alte Dame überhaupt nicht, genauso wenig wie alle übrigen Hilfsgeräte für ältere Leute. „Bevor ich sowas benutze, erschieße ich mich“, gab sie bei jeder passenden Gelegenheit zu verstehen. So verschwand die Hörhilfe auf unerklärliche Weise, und jeder, der die alte Dame durch die Villa torkeln sah, wunderte sich, dass sie nicht längst sämtliche Schenkelhälse und Handgelenke gebrochen hatte. Einer der Gärtner erzählte Mona bei einer Betriebsfeier hinter vorgehaltener Hand, dass das Hörgerät bei einer Säuberungsaktion im Seerosenteich der Villa gefunden wurde. Und schmunzelnd fügte er hinzu, dass die alte Dame in der Zeit danach den Hausangestellten heimlich mehrstellige Geldbeträge zugesteckt hätte, damit nicht das ganze Kaiserliche Vermögen an die versnobten Enkel ging, die sich nie blicken ließen. Die Tatsache, dass es keine gab, wurde von der alten Dame vehement bezweifelt. Kurz darauf quartierte man sie dann endgültig in die Obhut des Heims um.
Die restlichen Personen in der ersten und zweiten Reihe kannte Mona nicht. Vermutlich gehörten sie zum Brauerei-Clan der verstorbenen Brigitte. Dafür waren ihr die übrigen Trauergäste umso vertrauter. Fast die ganze Belegschaft der Firma hatte sich in feierlichem Schwarz eingefunden, um von Cleopatra Abschied zu nehmen. Jetzt entdeckte sie auch den blond gefärbten Schopf ihrer besten Freundin weit vorn, direkt neben der Wand. Sie musste also schon sehr früh gekommen sein.
Ute war vor zwei Jahren zur Kantinenchefin der Firma Kaiser befördert worden, nachdem bekannt wurde, dass ihr Vorgänger sich heimlich aus dem Vorratslager der Firma bedient hatte. Außerdem wusste Ute, wie man gutbürgerlich kochte, und das schätzte Cäsar sehr. Utes kulinarischen Draht zum Chef verdankte Mona auch die Stelle im Marketingbereich. Seit ungefähr zehn Jahren war sie dafür zuständig, die Kaiserlichen Gehhilfen gut auf dem Markt zu positionieren, die Konkurrenz im Auge zu behalten, Beschwerden entgegenzunehmen und den Kundenkontakt zu pflegen.
Während der Pastor mit seiner Trauerrede die Anwesenden eher zum Gähnen als zu Tränen rührte, hing Mona weiter ihren Gedanken über die Firma nach. Plötzlich schreckte sie auf, als er mahnend die Stimme anhob.
„Und wie steht es schon in der Bibel? Auf sieben fette Jahre folgen sieben magere. Und so lasset uns im Angesicht des Todes Demut üben. Amen.“
Mona murmelte irritiert ihr Amen. Sie war zwar nicht besonders gläubig, aber dass der Pastor ausgerechnet in dieser Rede über konjunkturelle Schwankungen sprach, verblüffte sie sehr. Das war doch kein Zufall. Sollte das vielleicht ein Signal von höchster Stelle gewesen sein? Mona schüttelte den Kopf. „So ein Quatsch!“
„Also bitte!“ Zwei Augenpaare starrten sie entsetzt von den Seiten her an. „Wie können Sie so etwas sagen? Sie kennen die Verstorbene wohl kaum so gut wie wir. Brigitte war nämlich die Schwiegertochter unserer Freundin Lydia, der Senior-Chefin der Firma Kaiser. Sie sitzt da vorn neben ihrem Sohn“, sagte die Kurzhaar-Nachbarin und streifte beim Hinweis mit dem Zeigefinger das Ohr ihres Vordermannes, der seinen Kopf aufgeschreckt nach hinten drehte. „Helmi und ich wissen nämlich Bescheid. Unsere Zimmer in der Fürstenberg-Residenz liegen nämlich direkt neben Lydias. Uns hat sie immer alles erzählt.“
„Alles“, ertönte das Echo von links.
„Ach, das ist ja schön für Sie“, säuselte Mona und war sehr dankbar, dass der Geistliche nun wieder den vollen Einsatz ihrer Nachbarinnen forderte.
„Nun wollen wir gemeinsam das Abschiedslied singen.“
Zusammen mit der Orgel setzte das inbrünstige Geplärre der beiden Kirchenchor-Vertreterinnen ein. „So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig’ Ende und ewiglich …“
Es folgten noch zwei weitere Strophen. Dann setzte sich der Trauerzug mit dem Sarg voran in Bewegung.
Cäsar hakte seine Mutter energisch unter und lenkte sie hinter dem Sarg dem Ausgang der Kirche zu. Hinter ihnen schlossen sich die engsten Verwandten und Freunde an. Die Blicke der Firmenmitarbeiter verfolgten die bedrückten Gesichter der Kaiserlichen Familie eher neugierig als mitfühlend. Hier und da wurden Tränen weggewischt und Nasen geputzt. Nur Mutter Kaiser blieb unverändert mürrisch.
„Wo ist eigentlich Brigitte? Typisch! Nie ist sie da, wenn die ganze Familie versammelt ist“, hörte Mona sie beim Vorbeigehen schimpfen.
„Mutter, Brigitte ist doch da vorn“, flüsterte Cäsar ihr genervt zu.
„Ja, wo denn? Ich seh sie nicht.“
„Na, im Sarg, Mutter“, zischte er ihr nun unüberhörbar laut ins linke Ohr.
„Ach, und was soll das ganze Theater?“, hörte Mona sie noch ungeduldig lamentieren. Dann musste auch sie ihre Reihe verlassen und sich dem Zug zum Grab anschließen.
Es waren nur wenige Meter über den Friedhof bis zu der grün gesäumten Grube. Dort ließen die Träger unter den niedergeschlagenen Augen der Trauergemeinde ihre Fracht langsam hinabsinken. Huldvoll verbeugten sie sich noch einmal vor dem Sarg und traten dann in den Hintergrund.
Mona stand seitlich hinter ihrem Chef und seiner Mutter und hielt vorsichtig Ausschau nach Ute. Wo sie nur blieb?
„Und wo ist nun Brigitte?“, richtete sich Mutter Kaiser mit missbilligender Miene erneut an ihren Sohn. „Konnte sie heute nicht kommen? Sicherlich hat sie wieder so ein blödes Treffen im Golfclub. Sie hat ja immer was, wenn sich die Familie mal versammelt.“
„Jetzt ist gut, Mutter“, schnarrte Cäsar, denn der Pastor platzierte sich genau vor dem Grab und sprach die üblichen Worte.
„Wir geben nun unsere liebe Brigitte Kaiser in deine treusorgenden Hände, oh Herr.“ Dann griff er nach der bereitgestellten Schüppe und schüttete drei Schaufeln voll Erde in die Grube. „Asche zu Asche, Staub zu Staub. Amen.“ Danach bekreuzigte er den Sarg und deutete den Trauergästen an, dass sie nun ihren Gang ans Grab antreten konnten.
Cäsar hakte die Mutter unter, und die beiden traten vor. Er hangelte mit der Schüppe in der rechten Hand nach der Erde im Eimer und schüttete sie ins Grab.
„So, Mutter!“ Mit ernster Miene nickte er ihr zu und zeigte auf die Blumen in ihrer Hand.
Doch der Zweck des Sträußchens war Mutter Kaiser inzwischen verlorengegangen. Stattdessen warf sie unter den entsetzten Ha-Rufen der Trauergäste ihr feuchtes Taschentuch in den Abgrund. „Die Blumen sind doch noch gut. Die werden nicht weggeschmissen“, entrüstete sich die alte Dame und drückte den Strauß an die Brust. „Brigitte wirft auch immer alles weg. Typisch! Geld ist ja genug da“, war ihr letzter Kommentar, bevor Cäsar sie genervt zur Seite zog, um den übrigen Gästen die Gelegenheit zum Abschied zu geben.
Kondolenzbekundungen am Grab wünsche man nicht, so stand es in der Traueranzeige. Das war auch gut so, denn lange hielt es Mona in der schwarzen Kleidung unter der sengenden Mittagssonne nicht mehr aus. Auch die übrigen Gäste fächerten und wischten emsig im Kampf gegen das Schwitzen.
„Zum Glück muss man denen nicht auch noch die Hand schütteln. Ich hasse dieses aufgesetzte Getue“, meinte der junge Mann neben Mona leise und zog den Krawattenknoten hin und her. Dennis Krapp war seit einem Jahr ihr engster Kollege und ein Held am Computer, der im Büro stets in Jeans und modischem Oberhemd erschien. Der viel zu weit sitzende schwarze Anzug hing an dem hochgewachsenen Schlaks wie am Gerippe einer Vogelscheuche. Sie schmunzelte mütterlich, als sie unauffällig von der Seite an ihm hinabsah. Die Turnschuhe waren da noch das kleinere Übel.
Dennis neigte sich zu Mona. „Muss ich da eigentlich auch was reinschaufeln?“
„Nein, man muss gar nichts. Man geht einfach vor das Grab, verweilt ein bisschen mit traurigem Gesicht und geht dann wieder“, half Mona und nickte Dennis ermunternd zu. Er holte tief Luft und machte sich auf den Weg.
Später, beim Rückweg zum Parkplatz, zerrte Dennis als Erstes den Schlips vom Hals und atmete befreit auf. „Dieser blöde Verkleidungszwang. Als ob die Toten davon noch was hätten.“
Mona pellte sich ebenfalls aus ihrer Kostümjacke und hielt die Arme etwas vom Körper ab, um ihre nassgeschwitzte weiße Bluse im leichten Wind zu trocknen. „Das macht man ja auch eher für die trauernden Angehörigen“, belehrte sie den jungen Kollegen, der nur wenig älter als ihr eigener Sohn war.
„Du glaubst doch nicht, dass auch nur einer von denen wirklich um diesen Drachen getrauert hat“, sagte Dennis und tippte sich dabei an die Stirn. „Die waren doch alle froh, dass sie sich endlich ins Jenseits gesoffen hat.“
„Pst!“ Mona knuffte ihm den Ellenbogen in die Seite und sah sich um, aber keiner aus der Kaiserlichen Verwandtschaft war in Hörweite.
„Cleopatras Schicksal ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ich bin nur gespannt, wie es jetzt mit der Firma weitergeht“, flüsterte sie.
Dennis sah sie verständnislos an. „Was soll sich denn da ändern? Läuft doch prima, der Laden.“
Kapitel 2
„Bei der Affenhitze muss man jetzt womöglich in so einem feudalen Schuppen sitzen und schwitzen. Ich hoffe ja nur, dass die Klimaanlage bei denen anständig funktioniert“, stöhnte Dennis neben Mona auf dem Beifahrersitz und kurbelte das Fenster hinunter. Als er begann, die Ärmel seines weißen Hemds hochzukrempeln, stoppte sie ihn vorsorglich. „Das lohnt sich kaum. Ich befürchte, du wirst dein Jackett gleich wieder überziehen müssen. Immerhin ist die komplette Chefetage anwesend.“
Ergeben zog er die Augenbrauen in die Höhe und faltete alles wieder abwärts.
Der Kaiser-Clan hatte sich nicht lumpen lassen, Brigittes Brauerei-Familie und einen Teil der Belegschaft nach der Beerdigung in das erste Haus am Platz, den Goldenen Löwen, einzuladen. Die elegant gedeckten Tische des Raumes Tessin waren mit kleinen Keramikschalen voller zartgelber Röschen in Schleierkraut geschmückt.
Mona zupfte Dennis am Ärmel und dirigierte ihn zu einem Platz am Rand einer Tischreihe dicht an der Tür.
„Hier kommt bestimmt immer mal eine frische Brise rein“, begründete sie ihre Wahl und setzte sich. Ute war nirgends zu sehen. Nachdem alle Trauergäste Platz genommen hatten, löste ein leises Aufstöhnen das gedämpfte Gemurmel ab, als ein Trupp Kellner mit beladenen Tabletts erschien. Von den kleinen Tässchen voll heißer Rinderbouillon mit Julienne-Gemüse stiegen dampfende Schwaden empor.
Mona blickten sich beim Löffeln um. Überall gerötete, schnaufende Gesichter, die ständig mit Handrücken und Taschentüchern abgerieben wurden. Bevor die Servicekräfte Kanapees mit Pastete und Räucherfisch servieren konnten, mussten sie unzählige Flaschen Mineralwasser herbeischleppen, die im Handumdrehen leer waren. Zuletzt wurden rosafarbene und himmelblaue Petit Fours auf silbernen Platten in die Mitte der Tische gestellt. Sie sahen in ihren Zuckergusshauben wie kleine Schmuckkästchen aus, aber den überhitzten Trauergesichtern konnten sie nur noch ein mattes Lächeln entlocken. Für Klebriges hatte man absolut nichts mehr übrig. Manche der Gäste schüttelten sogar verächtlich den Kopf, als Thermoskannen mit heißem Kaffee und Tee serviert wurden.
Mona wischte und wischte. Der Schweiß wollte nicht aufhören zu laufen. Sie sah mitleidig zu Dennis, der wie ein Mensch gewordener Föhn auf die Suppe einpustete und dann entschlossen den Löffel zur Seite legte. „Ne, das reicht jetzt! Das kann man nicht von mir verlangen. Lieber geh ich arbeiten.“
Dann kam das erlösende Signal. Die Chefetage zog die Jacketts aus, und kurz darauf entledigten sich auch die übrigen Gäste aller verzichtbaren Kleidungsstücke. Sofort wurden die Gespräche lockerer und lauter.
„Helmi, los! Dein Auftritt ist dran. Zeit für die Toilette. Aber denk daran, was wir vereinbart haben. Ein kleiner Druck gegen das Ventil und die Luft ist raus. Das hat Vinzenz uns garantiert“, zischelte Lydia ihrer Nachbarin ins Ohr und klackerte dabei mit dem dunkelrot lackierten Zeigefingernagel auf die Tischplatte. Unauffällig blickte sie zu ihrem Sohn auf dem Platz links neben ihr, um sich zu vergewissern, dass er nichts mitbekommen hatte. Dann neigte sie sich erneut zu ihrer Freundin. „Mach hin, sonst gehen die Ersten schon wieder nach Hause.“
Helmi nickte missmutig und richtete sich auf. Ihr behagte es von Anfang an nicht, bei diesem Leichenschmaus ganz vorn auf dem Präsentierteller zu sitzen und noch dazu einem geheimen Auftrag folgen zu müssen. Aber für Lydias Plan war es unabdingbar, dass sie und ihre Freundinnen direkt neben ihrem Sohn Rolf saßen, der als Ehemann der Verstorbenen und Leiter des Unternehmens den zentralen Platz einnahm.
„Ach, ich müsste dann mal zur Toilette“, gab Helmi nun deutlich hörbar bekannt und erhob sich umständlich. Gut aufgestützt auf die Stuhllehne ihrer Freundin Annegret drehte sie sich zu dem Rollator um, der hinter ihr abgestellt war. Dann beugte sie sich zum Gepäcknetz und nestelte darin herum. Zeitgleich bekam Lydia einen bedrohlich klingenden Hustenanfall, und alle Augenpaare im Saal richteten sich augenblicklich auf sie und Cäsar, der linkisch den knochigen Rücken seiner Mutter betätschelte.
Lydia fuhr aufgebracht herum. „Lass das doch! Was soll denn das, Rolf? Ich bin doch kein Hund.“ Ihr Husten war wie weggeflogen. „Hilf lieber meiner Freundin Helmi! Da stimmt wohl wieder mal was mit ihrem Rollator nicht.“
Helmi versuchte unterdessen, mit ihrem Gehwagen vorwärtszukommen. „Oh mein Gott, schon wieder ein Plattfuß. Das ist schon der dritte in diesem Monat.“ Mit einem vorsichtigen Blick zu Cäsar, der sich nun zu dem platten Reifen hinunterbeugte, setzte sie hinzu: „Dieses Mistding macht nichts als Ärger. Vielleicht sollte ich doch mal die Marke wechseln.“
Da jeder das Debakel mit Helmis Gehhilfe verfolgte, bekam keiner Lydias triumphierendes Nicken zu Annegret mit, die mit weit aufgerissenen Augen und geröteten Wangen der Aktion folgte.
Mit einem kurzen Wink forderte Lydia Annegret auf, sich zu ihr zu neigen. „Los, du bist jetzt dran“, kommandierte sie mit scharfem Flüsterton.
Annegret reagierte nicht.
„Annegret!“
Nun fuhr die Angesprochene erschrocken zusammen. „Ja, ist ja schon gut. Du musst nicht alles dreimal sagen.“ Zaghaft tappte Annegret auf Helmis Unterarm. „Du kannst ruhig meinen Rollator nehmen“, bot sie ihrer Freundin leise an. Als sie danach Lydias strafendem Blick begegnete, wiederholte sie Ihren Satz noch einmal deutlich lauter. „Nimm ruhig meinen, Helmi! Aber sei vorsichtig. Die blöde Karre konnte immer noch nicht repariert werden. Du weißt ja, er zieht immer so stark nach rechts. Nicht, dass du damit fällst.“
Helmi wechselte das Gefährt, schob an, und schon drehte der Rollator zur Fensterfront ab. Hilflos löste sie eine Hand von den Griffen und zeigte in die Gegenrichtung. „Aber ich muss doch dahin, zur Toilette.“
Vom angrenzenden Tisch sprangen zwei junge Männer auf, die die dankbare Helmi rechts und links bei den Ellenbogen griffen und sie behutsam zum Ausgang führten.
Die Schweißränder unter Cäsars Achseln uferten aus. Mit ernster Miene wechselte er von einem Gehwagen zum anderen, um die Ursache für die Defekte zu finden. Bei dem olivgrünen von Helmi kniff er den schlaffen Reifen ein paarmal zusammen. Dann prüfte er nach, ob das Ventil ordnungsgemäß eingeschraubt war. Den savannengelben von Annegret schob er vor und zurück. Dabei betätigte er die Handbremsen. Erst beide gleichzeitig, dann wieder jede für sich. Am Ende schüttelte er ratlos den Kopf. „Versteh ich nicht. Die sind doch fast neu und laufen noch auf Garantie.“
„Den da hat Annegret erst vor Kurzem bekommen, und Lüders vom Kundendienst war auch schon da“, klärte Lydia ihren Sohn auf. Ihre dunkel nachgezogenen Augenbrauen verharrten weit oben, während ihr Kinn auf den gespreizten Fingern ihrer rechten Hand ruhte. „Aber was will der arme Kerl ausrichten, wenn das Produkt nichts taugt“, folgerte sie für alle gut hörbar. „Ich weiß schon, warum ich nicht mit so einem Ding rummache. Knochenbrecher sind das.“
Mona nutzte die Gelegenheit, um unter dem Tisch ihr Handy einzuschalten. Aha, da war eine Nachricht von Jörg: Ute braucht dringend Hilfe. Läuft nicht gut hier. Kannst du kommen?
Mona stutzte. Warum meldete sich ihre Freundin nicht mit ihrem eigenen Handy?
Ute leitete neben der Firmenkantine einen Partyservice für Feiern aller Art am Wochenende. Und heute feierte ihr Freund Jörg das zehnjährige Bestehen seines Fitnessstudios, mit einer ihrer wunderbaren Buffet-Kreationen. Alles, von der Bestellung bis zur Zubereitung der Speisen, vom Transport bis zur Einteilung der Servicekräfte, lief bei ihr perfekt durchgeplant. Da ging nie etwas schief. Dafür war sie mit ihren zig Berufsjahren viel zu erfahren.
Schnell suchte Mona nach der Uhrzeit der Mail. Eingegangen war sie kurz nach dem Beerdigungs-Gottesdienst. Das war jetzt fast zwei Stunden her und für eine Antwort viel zu spät. Sie musste sofort dorthin, denn eins war klar: Wenn Ute um Hilfe bat, bedeutete das, dass nicht nur Holland in Not war. Das lief auf Weltuntergang hinaus.
Mona beugte sich zu Dennis, der gerade sein achtes Glas Mineralwasser leerte. „Du, ich muss dringend weg.“
„Gott sei Dank.“ Dennis war schon halb aufgesprungen, als Mona ihn energisch zurück auf den Stuhl drückte.
„Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Eine Bekannte von mir sitzt in der Klemme. Vielleicht kannst du ja bei jemand anderem mitfahren.“
Dass es sich um Ute handelte, die Dennis genauso gut kannte wie die meisten im Raum, behielt sie lieber für sich. Ihr Fehlen auf der Beerdigung war schon heikel genug. Immerhin war diese Trauerfeier sozusagen eine firmeninterne Veranstaltung, also Arbeitszeit. Und Cäsar hatte damals der Einführung ihres Partyservices nur unter der Bedingung zugestimmt, dass seine Firma stets Vorrang hatte.
„Könntest du hier nicht noch ein bisschen die Stellung halten? Wenigstens, bis einige von den Leitenden aufbrechen? Das macht sich nicht so gut, wenn wir beide so früh gehen, auch wenn Freitagnachmittag ist.“ Monas flehender Gesichtsausdruck zeigte Wirkung. Dennis gab sich gequält, aber einsichtig.
„Okay, okay. Dann hab ich aber was gut bei dir“, verhandelte er mit einem smarten Augenaufschlag. Gleich darauf griff er nach der Wasserflasche vor ihm, goss den Rest in sein Glas und stürzte ihn in einem Zug hinunter.
„Gebongt.“ Mona nickte ihrem Kollegen dankbar zu und schlich dann so unauffällig wie möglich nach draußen.
Die Zufahrt zum Fitnessstudio, mit dem Stadtwald an ihrer rechten und einem ausgedehnten Industriegebiet an ihrer linken Seite, war eine einzige staubige, holperige Katastrophe. Mona stöhnte und schimpfte im Wechsel, als sie mit ihrem Wagen von einem Schlagloch ins nächste schaukelte. Ausweichmanöver waren bei der Vielzahl der Löcher genauso zwecklos wie Regentropfen im Zick-Zack-Lauf zu entkommen.
„Mist, verdammter!“ Das kratzende Geräusch kam vom Bodenblech ihres Wagens. Der verantwortliche Krater, der im Rückspiegel unter den Staubwolken auftauchte, hatte die Tiefe eines Gartenteichs. Als sie endlich an den teilweise maroden Backsteinhallen und Fertigungsgebäuden vorbei war und vollkommen durchgeschüttelt auf den Parkplatz rollte, atmete sie auf. Ihre Wirbelsäule fühlte sich zehn Zentimeter kürzer an, und viel länger hätte die Schraubverbindungen ihres Wagens diesem Stakkato auch nicht mehr standgehalten. Da musste sich Jörg unbedingt etwas einfallen lassen. Die Beschaffenheit dieser Zufahrt war im höchsten Maße kundenfeindlich.
Jörg war Utes derzeitiger Lebenspartner. Der ehemalige Manager eines großen Sportvereins machte mit seinen knapp fünfzig Jahren eine überaus sportliche Figur, die er allerdings auch ständig schweißtreibend bearbeitete. Als es mit der wirtschaftlichen Lage seines damaligen Vereins bergab ging, musste er sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Doch anderen Sportvereinen ging es genauso schlecht. Wenn sie nicht gerade eine Bundesliga-Mannschaft oder einen Olympiateilnehmer vorweisen konnten, die für höhere Einnahmen sorgten, sparten sie als Erstes an den teuren Managern und Trainern. Die Folge war, dass die guten Sportler abwanderten und der Nachwuchs sich gar nicht erst blicken ließ. Wenn körperliche Betätigung für junge Leute überhaupt von Interesse war, dann zog es sie zu den modernen Trendsportarten. Turnen, Leichtathletik und Schwimmen fühlte sich für die meisten von ihnen eher nostalgisch an.
Jörg hielt sich einige Jahre mit Trainerstunden über Wasser, aber einen Job, der ihm eine abgesicherte Zukunft bot, fand er nicht mehr. So machte er aus der Not eine Tugend. Mit wenig Geld und vielen Freunden pachtete er eine alte Lagerhalle und baute sie zu seinem Lebenstraum um, dem Fitnessstudio sports-life. Mittlerweile bot er seinen Kunden alle gängigen Fitness-Kurse und die modernsten Trainingsgeräte an.
Ute hatte sich kurz nach der Eröffnung für einen Bauch-Oberschenkel-Po-Kurs angemeldet, obwohl gerade diese Körperteile an ihr schlank wie bei einer Zwölfjährigen waren. Das Einzige, was an ihr ganz und gar nicht mager wirkte, war ihr Busen. Aber den nahm sie in Schutz. Für Erbmasse konnte man ja schließlich nichts.
Eigentlich hatte Mona auch mitmachen wollen, aber sie war gerade frisch geschieden, und das Einzige, was sie zu diesem Zeitpunkt gern mit Ute unternahm, war essen. Damals konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen, inwieweit Sport tröstend wirken sollte.
Ute jedenfalls hatte von diesem Tag an begonnen, wie ein Teenager für den smarten Studioleiter zu schwärmen. Richtig ernst war es mit den beiden allerdings erst geworden, als Ute Jörg zum ersten Mal mit ihren Kochkünsten verwöhnt hatte. „Sportler sind auch nur Männer“, war Monas nüchterner Kommentar, als klar war, dass auch bei Jörg der kleine Umweg über den Magen zielsicher zum Herzen geführt hatte. Knapp zwei Jahre nach dem Start war das sports-life die erste Adresse für alle Fitness-Begeisterten des Ortes.
Der Parkplatz lag angenehm schattig zwischen der Sporthalle und dem Waldrand. Mona stieg aus, stemmte ihre Hände in die Taille und streckte ihren zusammengestauchten Rücken. Dabei atmete sie tief durch. Die Luft aus dem Wald war etwas weniger heiß, und sie roch nach Tannengrün und feuchtem Moos. Sie liebte diese grüne Oase von Kindesbeinen an. Hier hatte ihr Vater beim Osterspaziergang immer wieder dieselben acht Eier versteckt, während ihre Mutter darauf bedacht war, sie abzulenken. Als Teenager war sie ein paarmal mit Holger vom Jungengymnasium im blickdichten Tannenwäldchen verschwunden, um Leidenschaft mit Zahnspange zu üben.
Allerdings sorgte der Wald nicht nur für Wohlbefinden und Erholung. Ältere Städter beklagten sich über dreiste Jogger, die sie schier zu Tode erschreckten, weil sie fast geräuschlos aus dem Nichts auftauchten und hinter dem nächsten Dickicht wieder verschwanden. Die Hundebesitzer griff man an, weil sie ihre Struppis und Hassos zum Gassi Gehen im Wald frei laufen ließen, um die lästige Häufchen-Entsorgung zu sparen. Die Hundebesitzer ihrerseits meckerten über militante Senioren, die mit ihren Gehstöcken um sich schlugen, sobald ihnen ein Hund in die Quere kam. Auch sollten Jäger beobachtet worden sein, die gezielt auf nicht angeleinte Vierbeiner Jagd machten und dabei versehentlich einen beige-braun gekleideten Pilzsammler erwischt hätten.
Mona krempelte auf dem Weg zum Partyzelt am anderen Ende der Sporthalle die Ärmel ihrer weißen Bluse hoch. Dass sie in schwarzem Rock und entsprechenden Schuhen nicht ganz passend gekleidet war, konnte sie nun auch nicht ändern. Einige Gäste in luftigen T-Shirts und Bermudahosen waren bereits auf dem Rückweg zu ihren Autos. Mona spürte genau ihre Blicke, und dass man über sie tuschelte. Normalerweise ließ sie so etwas kalt, aber plötzlich zuckte sie zusammen. Eine der Frauen starrte ihr beim Herankommen verächtlich ins Gesicht, während sie sich übertrieben laut mit ihrer Nachbarin unterhielt. „Schade, dass man sich auf Cateringhelfer so wenig verlassen kann, heutzutage. Die kommen, wann sie lustig sind, wenn sie überhaupt kommen.“
Als sie noch ein weiterer verachtender Blick traf, hatte sie endlich verstanden. Man hielt sie wegen ihrer ungewöhnlichen Kleidung für jemanden vom Partyservice, und mit dieser Person war man offensichtlich sehr unzufrieden.
„Schöner Mist. Und dabei hat sich die Freundin von Jörg so viel Mühe mit dem Buffet gemacht. Ich möchte ja nicht wissen, was das Ganze gekostet hat.“
Mona verkürzte ihre Schritte, um noch mehr zu erfahren.
„Sind halt nur billige Aushilfen. Wenn es denen zu heiß ist, bleiben die einfach weg.“
Was war bloß passiert? Auf den letzten Metern beeilte sie sich so sehr, dass sie auf ihren schwarzen Pumps beinahe der Länge nach hingeflogen wäre.
Das Partyzelt war ein riesiges Plastikmonstrum. Ute berichtete schon Wochen vor dem Jubiläum voller Stolz, dass darin mehr als fünfzig Personen Platz an den Biertischen hätten. Auch eine kleine Tanzfläche sollte es geben. In der hinteren Ecke, im Anschluss an das Podium für die Musikanlage, sollte das Buffet aufgebaut werden, für das sie schon seit Tagen nach Feierabend in der Firma vorkochte.
Irgendetwas schien jedoch mit dem Zelt nicht in Ordnung zu sein, denn alle Gäste standen dicht gedrängt draußen im Schatten der Sonnenschirme an den Stehtischen. Warum hatte Jörg zusätzlich diesen großen Grill aufgestellt, vor dem eine hungrige Schlange auf Würstchen wartete? Mit dem Buffet hätte Ute die Zuschauer eines Fußballspiels satt bekommen. Und was sollte die Meckerei über die Servicekräfte vorhin auf dem Parkplatz?
Vergeblich suchte Mona nach dem vertrauten Gesicht ihrer Freundin. Am Getränkestand erkannte sie Jörg, dessen hellblaues Sommerhemd bereits verschwitzt am Körper klebte. Während er Glas um Glas mit allen möglichen Getränken füllte, wischte er sich immer wieder mit dem Handrücken über die Stirn. Als er Mona erblickte, winkte er sie mit verzweifelter Miene heran.
„Gut, dass du da bist. Kannst du mal nach Ute sehen? Der geht’s glaub ich nicht so gut. Die ist irgendwo drinnen im Studio.“ Jörg sah nicht nur ziemlich gestresst aus, sein Gesichtsausdruck hatte etwas Alarmierendes.
Ute im Studio und nicht bei ihrem Buffet und den Gästen? Da war etwas gewaltig schief gelaufen.
„Warum ist sie denn nicht im Zelt?“ Ahnungslos zeigte Mona hinüber zum Eingang des Plastikmonstrums.
„Geh mal rein, dann weißt du’s.“
Schon im Eingangsbereich traf sie der Schlag. Es war dasselbe Gefühl wie beim Öffnen einer Saunatür. Der Luftstrom, der ihr fast den Atem nahm, hatte mindestens fünfzig Grad. Als sie sich im Inneren umsah, brach ihr sofort der Schweiß aus. Die verspielten Landhausplastikfenster waren nur Attrappen. Sie ließen sich nicht öffnen und einen zweiten Ausgang, der für Durchzug hätte sorgen können, gab es nicht. Auch das Zeltdach war absolut dicht.
Mona schnupperte. Ein übler Geruch lag in der Luft. Ein Gemisch aus saurer Milch, fauligem Fleisch und verdorbenem Gemüse. Mit einem Mal wusste sie, wo sie das Unglück suchen musste. Die Holzdielen knarrten unter ihren Schuhen, als sie sich der Ecke mit dem Buffet näherte. Dort war gerade jemand dabei, ein Silbertablett voller Schnittchen mit Roastbeef und Meerrettichsahne in einen blauen Plastiksack zu schütten.
„Was machen Sie denn da? Hören Sie sofort auf damit! Das dürfen Sie nicht!“ Kampfbereit quetschte sich Mona mit ausgestreckten Armen zwischen den Buffettisch und den Mann und versuchte ihn davon abzuhalten, die nächste Platte mit Schinken-Spargelröllchen in die Mülltüte zu entleeren. Ihr Gegner war mindestens zwei Köpfe größer als sie und er schwitzte. Monas starrte kurz auf die leicht ergraute Männerbrust im zu weit geöffneten Hawaiihemd und dann in dunkelbraune Augen, die derart feindselig funkelten, dass sie nur noch stottern konnte: „Wer…wer hat Ihnen erlaubt, das zu tun?“
„An ihrer Stelle würde ich ganz still bleiben.“ Ein muskulöser, braungebrannter Arm schob Mona wie eine Pappfigur zur Seite und langte nach dem nächsten Tablett. „Am besten sehen Sie zu, dass Sie möglichst schnell verschwinden. Man ist hier nämlich auf unpünktliche Servicekräfte ganz schlecht zu sprechen.“
„Ich komme nicht vom Service, sondern von einer Beerdigung, verdammt!“, fauchte sie. Am liebsten hätte sie diesem Mister Allmächtig im Hula-Hemd die Platte mit den Minifrikadellen samt Senf über seine wüsten graumelierten Locken geschüttet.
„Ja klar, und ich von der Müllabfuhr“, spottete die dunkle Stimme vollkommen gelassen. „Sie können froh sein, wenn sie nicht für den entstandenen Schaden aufkommen müssen.“
Doch das nahm Mona nur noch von Ferne wahr, denn nun erst erkannte sie mit weit aufgerissenen Augen, was eigentlich los war. Entsetzt legte sie ihre Hände auf den Mund und schüttelte den Kopf. „Oh, nee! Das darf doch nicht wahr sein!“
Von den Leckerbissen auf den restlichen Silberplatten fehlte kein einziges Stück. Als sie noch etwas dichter heranging, wusste sie auch, warum. Die Käseschnittchen waren übersäht mit winzigen glänzenden Fetttröpfchen, und die vertrockneten Ecken bogen sich in alle Richtungen. Die Salatblätter unter den Fischhäppchen lagen wie gebügelt auf der Platte. Wie schrumpeliger Schaumstoff wirkten die Mettbrötchen mit dem angebräunten Fleischbelag und den erschlafften Zwiebelringen obenauf. Der Frischkäse auf den rustikalen Baguette-Scheibchen machte sich samt der dörren Petersilie auf den Weg zu einem schimmeligen See in der Mitte des Tabletts. Und Lachs hatte Mona orangerot in Erinnerung, nicht schmieriggrau.
Verzweifelt betrachtete sie die liebevoll zurechtgemachten Köstlichkeiten. Ute hatte ihr noch am Abend vorher stolz die fertigen, schmackhaft dekorierten Platten in den Kühlregalen der Firmenkantine präsentiert. Welche Mühe hatte sie sich damit gemacht? Sie wollte Jörg und seinen Kunden doch etwas ganz Besonderes bieten. Und nun das. Mona schüttelte fassungslos den Kopf. Angewidert beobachtete sie einige dicke Schmeißfliegen, die von einem Häppchen zum nächsten krochen, und dann konnte sie nicht mehr anders. Bevor sie würgen musste, hielt sie sich schnell eine Hand vor den Mund und flüchtete zum Ausgang.
Wenn es ihr bei dem Anblick dieses Desasters schlecht wurde, wie musste sich erst Ute fühlen? Mona eilte an den ausgelassen feiernden Gästen vorbei zum Studio. Die hohe Halle mit den Kraftgeräten, Zugapparaten und der kleinen Bar war menschenleer. Sie schnaubte angewidert. Die Luft war genauso stickig wie die im Festzelt, und es roch auch hier erbärmlich. Die Mischung aus Eisen, Männerschweiß und speckigem Leder war für sie immer schon ein Grund gewesen, einen großen Bogen um diese Art von Sportanlagen zu machen.
An der hinteren Wand, an der einige Poster mit besonders gelungenen Muskelprotzen prangten, ging es zu den Umkleiden und Toiletten. Mona hatte Mühe, die feuerfeste Fabriktür zu öffnen, die gleich darauf wieder zurück ins Schloss krachte. Sie drückte auf den Lichtschalter links an der Wand und horchte in den weißgetünchten Gang hinein. Bis auf die leise Musik und die gedämpften Stimmen der Gäste draußen auf dem Vorplatz hörte sie nichts, absolut nichts.
„Ute, bist du hier?“
In der Damentoilette ging die Spülung. Zielstrebig öffnete Mona die Tür.
„Ute, bist du das?“
Die Antwort war ein klägliches Nasehochziehen. Dann öffnete sich die Kabinentür und Ute stürzte Mona geradewegs in die Arme.
„Mein Gott, was ist denn bloß passiert?“ So kannte Mona ihre Freundin kaum. Dieses schluchzende Häufchen Elend hatte wenig gemein mit der souveränen, positiv orientierten Erfolgsfrau, die Ute verkörperte, solange sie sich kannten. Und das waren immerhin schon einige Jährchen.
„Emmi hat mich versetzt. Sie sollte mit ihrer Freundin die Lieferung mit dem Buffet entgegennehmen, weil ich doch zur Beerdigung musste. Aber sie ist einfach nicht gekommen.“ Ute lehnte sich an die Toilettenwand und heulte erneut los.
So ganz hatte Mona immer noch nicht verstanden. Kopfschüttelnd reichte sie ihr ein Papiertuch aus dem Spender. Normalerweise war auf Utes Tochter immer Verlass. Zusammen mit ihrer Freundin Bea half sie oft aus, wenn ihre Mutter nicht genug Servicekräfte für einen Cateringeinsatz zusammenbekam.
„Und als mich Jörg dann auf der Beerdigung anrief und fragte, wo denn Emmi bliebe, da hatte ich schon so eine Ahnung. Als ich dann vor dem Lieferwagen stand, wusste ich sofort, dass alles im Eimer war.“ Mit einem tiefen Seufzer ergriff sie Monas Papiertuch und putzte ihre Nase.
„Ja, aber das Ausladen ist doch ein Klacks. Das hätten doch auch ein paar von Jörgs Leuten machen können?“
„Haben die doch auch. Aber es war schon zu spät. Der Lieferant brachte den Wagen um zwölf zum Studio und fuhr dann mit dem Bus zurück.