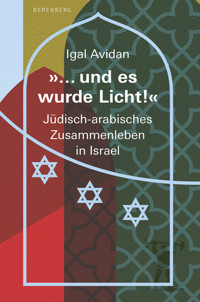9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die wahre Geschichte des »arabischen Schindler« Die meisten Menschen in Nazi-Deutschland reagierten gleichgültig auf die Judenverfolgung, viele nahmen aktiv daran teil. Nur 600 von ihnen wurden von Yad Vashem als Judenretter geehrt und ein einziger war ein Araber. Der Arzt Mod (Mohamed) Helmy wurde von den Nationalsozialisten als Ägypter inhaftiert. Trotzdem half er jahrelang einer jüdischen Familie, sich vor der Gestapo zu verstecken. Mitten in Berlin gelang es ihm sogar, eine Jüdin als Muslima in Sicherheit zu bringen. Igal Avidan fand Helmys ehemalige Patienten, besuchte seine Verstecke und zeichnet seine einzigartige Geschichte nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Ähnliche
Igal Avidan
Mod Helmy
Wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettete
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Mit Helmut Kuhn
Eine Berliner Jüdin sucht Schutz im Islam
Es ist sehr einfach, eine Muslimin zu werden. Und wenn man jüdisch ist und sich mitten in Berlin vor den Nazis verstecken muss, greift man zu jedem Strohhalm. Anna Boros ist 17, sie sitzt in einer Wohnung in Berlin-Moabit neben einem Araber und bemüht sich, die Worte des islamischen Glaubensbekenntnisses, der Schahada, zu wiederholen.[1] Sie versteht den Sinn nicht, denn sie spricht kein Arabisch. Vorsichtshalber hat man den Text für sie phonetisch zu Papier gebracht: Ashadu an la-e-laha il-ala-lahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Der Mann übersetzt ihr das Bekenntnis: »Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Mohammad Sein Diener und Sein Gesandter ist.«
Der Mann, der diese Zeremonie am 10. Juni 1943 durchführt, ist Dr. Kamal Eldin Galal. Der ägyptische Journalist ist kein Imam, sondern ein Freund von Dr. Mod Helmy. Mod Helmy ist der Arzt und Freund von Annas jüdischer Familie. Bereits seit 15 Monaten lebt das junge Mädchen illegal in Helmys Moabiter Wohnung und in einem verzweifelten Versuch, ihr zu helfen, hat Helmy in dieser Nacht des 10. Juni ihren Übertritt zum Islam organisiert.
Anna ist nicht religiös. Ihre Mutter lebt in einer Mischehe, und ihre Großmutter ist eine überzeugte Jüdin. Muslimin zu werden fällt Anna dennoch nicht leicht, auch wenn es nur zum Schein geschieht und dem Überleben dient.
Nun legt Galal Anna eine Bescheinigung vor, die er selbst auf der Schreibmaschine getippt hat und die Annas Übertritt bestätigt. Damit ist die Jüdin nun Muslimin geworden und darf nach der Scharia, dem religiösen Gesetz des Islam, einen Muslim heiraten.[2] Er unterschreibt mit »Dr. K. E. Galal«. Annas Bescheinigung trägt den Stempel des Islamischen Zentralinstituts zu Berlin und einen schmückenden Namen: ausgerechnet den Namen des Instituts-Schirmherrn und notorischen Judenfeindes Mohammed Amin al-Husseini. Der Mufti von Jerusalem hatte 1936 den arabischen Aufstand in Palästina angestiftet, war 1941 von Hitler persönlich empfangen worden. Er rekrutiert Muslime für die Waffen-SS, sendet Nazi-Radiopropaganda in die arabische Welt, kämpft gegen die jüdische Einwanderung nach Palästina und wird dafür von den Nazis großzügig entlohnt. Ab Mitte Mai 1943 hält er sich in seinem Büro in Rom auf, wo er sein Ziel vorantreibt: Die Achsenmächte sollen offiziell die Abschaffung des national-jüdischen Heimes in Palästina und die Unabhängigkeit der arabischen Länder erklären. Am 10. Juni 1943 schreibt er einen Brief an den italienischen Außenminister Graf Ciano, in dem er ihn auffordert, die Ausreise von Juden unter anderem aus Rumänien auf dem Weg nach Palästina zu unterbinden.[3]
Galal, die rechte Hand des Muftis, vollzieht in dieser Nacht souverän Annas Übertritt zum Islam. Er kennt sich aus mit der Zeremonie, denn er hat an der renommierten islamischen Al-Azhar Universität in Kairo studiert. Galal erläutert Anna die fünf Grundsätze des Islams und zeigt ihr ein Exemplar des Korans. Er hat das Buch aus der Berliner Moschee in Berlin-Wilmersdorf mitgebracht, der ältesten bestehenden Moschee Deutschlands. Eine in Leinen gebundene Luxusausgabe bekommt man dort für 10 Reichsmark.
In dieser von den Nazis im Propagandaministerium eingebundenen Moschee mit den beiden imposanten Türmen predigt auch der Mufti von Jerusalem, Hitlers Verbündeter und Imam auf der Gehaltsliste der Nazis. Damals kommen viele muslimische Wehrmachtssoldaten, die im Berliner Umland ausgebildet werden, zum Freitagsgebet.[4] Sie marschieren in Uniform und mit ihren Standarten hinein.
Zu dieser toleranten Haltung der Nazis gegenüber Muslimen passt die 1941 erschienene Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht, die Soldaten im Orient im Rucksack aufbewahren sollen. Darin empfiehlt man zum Beispiel: »Dringe nie in eine Moschee ein, es sei denn, dass man Dich dazu einlädt, sie zu besichtigen.« Oder: »Suche niemals durch Gruß oder Wort Beziehung zu gewinnen zu einer muslimischen Frau.« Und schließlich: Fange und töte keine der vielen Tauben bei Moscheen oder Heiligengräbern. Es ist verdienstlich, sie zu füttern.« Die Toleranz der Wehrmacht kennt aber auch Grenzen: »Wird der Besuch einer Moschee an irgendwelche Bedingungen geknüpft, wie Waffen oder Schuhe abzulegen, gebietet es Deine Selbstachtung, auf den Besuch zu verzichten.«[5]
Mod Helmy schätzt, dass er die Jüdin Anna besser schützen kann, wenn sie eine Muslimin ist. Denn die Lage wird für sie immer gefährlicher, obwohl sie die Jüdische Gemeinde verlassen hat. Bereits am Tag nach ihrem Übertritt wird die »Reichsvereinigung der Juden in Deutschland« aufgelöst. Die jüdischen Vertreter der von Nazi-Deutschland gegründeten und von der Gestapo kontrollierten Organisation versuchten seit 1941, nachdem die Emigration praktisch unmöglich geworden war, die zurückgebliebenen Juden, so gut es ging, zu versorgen. Doch selbst das wird nun offensichtlich nicht mehr gewollt. Die verbliebenen fünf jüdischen Mitglieder der Geschäftsstelle, die nicht durch eine Mischehe geschützt sind, werden umgehend deportiert. Fast alle im Nazi-Jargon »volljüdischen« Angestellten der Reichsvereinigung hatten bereits im März 1943 das gleiche Schicksal erlitten. Und nur fünf Tage zuvor hatte Propagandaminister Goebbels im Berliner Sportpalast von der »gänzlichen Ausschaltung des Judentums aus Europa« gesprochen. Er setzte die Juden mit Kartoffelkäfern gleich. Dagegen gäbe es nur ein Mittel: die »radikale Beseitigung der Gefahr!«. Dafür erhielt er frenetischen Applaus.
Hätte sie die entsprechenden Papiere einer Muslimin, könnte Anna in dieser Nacht einen Spaziergang unternehmen, zum ersten Mal als »Nichtjüdin«, denn nun gilt für sie die Ausgangssperre nach 20 Uhr nicht mehr. Die Nazis begründeten dies damit, dass es angeblich »häufiger vorgekommen sei, dass Juden die Verdunkelung benutzt hätten, um arische Frauen zu belästigen«.[6] Würden nur die Anweisungen für die Wehrmacht auch für die Gestapo gelten. In diesen Befehlen ist zu lesen: »Sprich niemals eine Frau auf der Straße oder in einem Laden an. Begegne dem Muslim mit der gleichen Achtung und Duldsamkeit, wie Christen verschiedener Konfession einander immer begegnen sollten.«[7]
Solche Achtung brachte Helmy in jener Zeit auch Juden wie Anna Boros entgegen. Trotz der damit verbundenen Gefahr setzte er sich unermüdlich für sie und ihre Familie ein.
Meine Recherche führte mich zu den letzten Zeitzeugen und ihren Kindern und Enkelkindern, die mir Schwarzweißfotos und alte Briefe zeigten und diesen Dokumenten sozusagen ein Gesicht und eine Stimme verliehen. Ich durfte die Nachlässe der Familien von Miriam Mahdi und Hartmut von Hentig einsehen und bekam wertvolle Fotos von Jürgen und Angelika Comes, Ursula Kraus, Sabine und Karsten Mülder, Hanns und Ute Rohde sowie Karl-Heinz Wolter.
Im Berliner Zentrum Moderner Orient gibt die Sammlung Nachlass Prof. Gerhard Höpp Auskunft über Araber in Berlin der Weimarer Republik.
Im Archiv der Humboldt-Universität fand ich Helmys Promotionsakten, unter anderem seine Eidesstattliche Erklärung, in der er gelobt, »die Pflichten des ärztlichen Standes gegenüber den meine Hilfe Heischenden in humaner Gesinnung treu und gewissenhaft zu erfüllen«.[8] Anders als viele andere hat er sich an seinen Eid gehalten.
Im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes lässt sich Helmys Internierung zu Beginn des Zweiten Weltkriegs als »gefährlicher Feind« nachverfolgen.
Im Bundesarchiv befindet sich Helmys medizinische Akte aus dem Krankenhaus der Polizei, wo er über vier Monate verbrachte.
Im Berliner Entschädigungsamt habe ich viel über Helmys Leben erfahren. Diese Unterlagen beleuchten sein Leben vor und während des Kriegs sowie in den ersten Nachkriegsjahren, als er um Entschädigung kämpfte.
Unterlagen und Fotos von Annas Familie fand ich in Helmys Akte in der Sammlung der Judenretter im Yad Vashem Archiv in Jerusalem. Eine weitere nützliche Akte war die des rumänischen »Gerechten unter den Völkern«, Constantin Karadja, der sich für verfolgte rumänische Juden eingesetzt hat.
Einige Informationen über Helmys Privatleben und seine Tätigkeit als Arzt fand ich im Archiv des Geschichtsvereins Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin.
Im Diplomatischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Bukarest stieß ich auf eine Akte über Anna Boros aus der Zeit, in der sie in der Illegalität lebte.
In den Berliner Adressbüchern lässt sich nachverfolgen, wo Helmy in der Nazizeit gewohnt hat bzw. wer seine Nachbarn waren. Weitere Auskünfte fand ich in den Bauarchiven verschiedener Bezirke.
Im Landesarchiv Berlin werden Helmys Akten in Verbindung mit seiner Ehrung als einer der »unbesungenen Helden« aufbewahrt.
In der Bibliothek der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gibt es Publikationen zum Gedenken an den »Stillen Helden«.
Im Archiv des Centrum Judaicums finden sich Unterlagen über Anna Boros und ihre Familie in Bezug auf die Jüdische Gemeinde.
Im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung stieß ich auf Nachkriegsfotos von Mod Helmy.
Spurensuche mit politischen Dimensionen
Meine Reise in die Vergangenheit begann am 30. September 2013, als ich beim Lesen einer israelischen Zeitung bei einer Meldung hängen blieb. Darin stand, dass die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zum ersten Mal einen Araber als »Gerechten unter den Völkern« anerkannte. Dr. Mohamed Helmy, ein ägyptischer Arzt, der in Berlin gelebt hat, erhielt diese Auszeichnung, weil er sein Leben eingesetzt hatte, um eine jüdische Familie während der Shoah zu retten.
Ich begriff auf Anhieb die politische Bedeutung dieses offensichtlichen Einzelgängers: Helmy könnte ein Held sein sowohl für Juden und Muslime, für Israelis als auch für Araber – gerade in diesen Zeiten des Kriegs und des Terrors, der Verschwörungstheorien und Vorurteile auf beiden Seiten des langen und blutigen Konfliktes. In Zeiten, in denen der einst so hoffnungsvolle Friedensprozess im Nahen Osten so weit entfernt wie Oslo zu sein scheint.
Ich bin in Israel geboren und aufgewachsen, wo man seinen Lebenslauf nicht nur nach der Ausbildung und der beruflichen Laufbahn gliedert, sondern auch nach Israels Kriegen. Ich habe zum Beispiel als Kind den Sechstagekrieg erlebt, als Teenager den Jom-Kippur-Krieg, als Soldat (Informatiker in Uniform) den ersten Libanonkrieg, als Reservist die erste Intifada und als Besucher den zweiten Gaza-Krieg. Da wurde mir ein klares Weltbild eingetrichtert: Wir sind die Guten, unsere Feinde wollten uns vernichten, wir haben überlebt, darum lasst uns jetzt essen gehen. Die Bösen von damals, während der Shoah, waren die Deutschen – die Nazis; die Schurken von heute sind die Araber, die uns ebenfalls vernichten wollen. Alles klar?
Wie gut wäre da jemand, zu dem sowohl Araber als auch Juden aufschauen könnten? Ein Mann, der nach der Nazi-Ideologie als minderwertig galt, weil er kein »Arier« war. Ein Ägypter, der selbst diskriminiert, verfolgt und eingesperrt wurde. Ein Arzt, der dennoch Juden half, denen es noch weit schlechter erging als ihm. Ein Araber, der wohl erste, der sein eigenes Leben riskierte, um Juden vor den Nazis zu retten. Ein solcher Held würde auch den Deutschen guttun, gerade in dieser Zeit, in der sie zwischen sich unversöhnlich gegenüberstehenden Juden und Arabern ihren Platz suchen. Ein Ägypter wie Mod Helmy könnte eine neue Identifikationsfigur für Araber werden und zur jüdisch-arabischen Annäherung beitragen.
Helmys Geschichte ließ mich nicht mehr los. Ich wollte mehr über ihn und sein Leben herausfinden. Vier Tage nachdem ich die Meldung gelesen hatte, war ich in Israel zur Bar-Mitzwa-Feier meines Neffen eingeladen. Gleich im Anschluss an die Feier machte ich mich auf den Weg nach Jerusalem. In Yad Vashem empfing mich Irena Steinfeldt, die Leiterin der Abteilung für Gerechte unter den Völkern.
Steinfeldt hat das Glück, sich um die »Schokoladenseite« der Shoah zu kümmern: Die Geschichten der Judenretter, die dafür von Juden geehrt werden. Sie und ihre Mitarbeiter prüfen Anträge aus ganz Europa, recherchieren und leiten am Ende ein Dossier an die Expertenkommission weiter. Seit einigen Jahren sind es immer mehr Vorschläge geworden, die Steinfeldt bearbeiten muss, erzählt sie mir. Zuletzt waren es jährlich Hunderte Anfragen von Überlebenden, die sich meist an ihrem Lebensabend ihrer Retter erinnern und sich bei deren Kindern und Enkeln bedanken wollen.
Von 1962 bis zum Januar 2017 hat die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, die laut Gesetz »Israels Gedenkbehörde« ist, 26 513 Nichtjuden, die während der NS-Zeit Juden gerettet haben, als »Gerechte unter den Völkern« geehrt. Ich frage Irena Steinfeldt, wie nach dem Yad-Vashem-Gesetz Retter/Gerechte definiert werden, und sie erzählt mir, dass ausgerechnet die Anerkennung des berühmten Oskar Schindler als einer der ersten »Gerechten« 1967, bevor die entsprechenden Regeln definiert waren, heftige Diskussionen in Israel ausgelöst hat: »Vor der Zeremonie beschwerten sich zwei ›Schindler-Juden‹ aus Krakau, die ihn als Nazi beschimpften, der NSDAP-Mitglied war und in Krakau jüdisches Eigentum an sich riss.«
Daraufhin gründete Yad Vashem eine unabhängige Kommission, die seitdem anhand von festgelegten Kriterien entscheidet, wem die Auszeichnung zusteht, ein Gerechter zu sein, und wem nicht. Demnach muss der Retter (damit sind natürlich auch Retterinnen gemeint) aktiv zumindest einen Juden vor dem Tod oder der Deportation in ein Konzentrationslager gerettet haben; Retter mussten dabei ihr Leben, ihre Freiheit oder ihren sozialen Status riskiert haben; Zeitzeugen oder die Geretteten selbst müssen die Rettung plausibel beweisen können. Die Geehrten müssen weder Engel noch Übermenschen oder Moralapostel sein. Kriegsverbrecher werden jedoch prinzipiell nicht geehrt, auch wenn sie Juden gerettet haben; ebenso lehnt die Kommission die Ehrung von Menschen ab, die Juden nur gegen Geld retteten. »Wenn die Rettung an erster Stelle stand und die versteckten Juden dem armen Bauern freiwillig Geld boten, damit sie in der Kriegszeit einen weiteren Mund füttern konnten, dann ist das erlaubt«, sagt Steinfeldt. »Wenn aber das Geld die Bedingung für die Rettung war, dann nicht.«
Irena Steinfeldt hat im Laufe der Jahre so viele ergreifende Geschichten gehört, dass ihr nichts Menschliches mehr fremd zu sein scheint. So erzählt sie, dass mehrere polnische Judenretter ihre Schützlinge sogar ermordet haben: »Aus Angst, sie könnten ihre Helfer, wenn sie weiterzogen, an die Deutschen verraten.« Sie schüttelt den Kopf. 26 513 Nichtjuden aber riskierten ihr eigenes Leben, um während der Shoah Juden zu retten. Eine Ausnahme bilden die Retter der 7.200 dänischen Juden, die auf Wunsch des dänischen Untergrunds kollektiv (und nicht persönlich) geehrt wurden.
Gibt es denn etwas, das die Retter vielleicht gemeinsam hatten? »Nichts«, sagt Steinfeldt. »Manche waren Christen oder Muslime, andere Atheisten oder Kommunisten. Sie stammten aus allen Altersgruppen, sozialen Schichten und übten alle möglichen Berufe aus. Intellektuelle, Lehrer, Adelige, Prostituierte. Manche waren hochgebildet, andere Analphabeten. Letztendlich konnte jeder die Wahl zwischen Gut und Böse treffen. Leider trafen nur wenige die erste Wahl.« Ein »Retter-Gen« fanden die Experten nicht: »Hinter jedem Profil eines Retters findet man auch einen Täter.« Letztlich habe jeder für sich allein entschieden, moralisch zu handeln oder nicht.
Mod Helmy rettete die in Rumänien geborene Jüdin Anna Boros und ihre Familie. Er setzte sich für seine jüdischen Bekannten ein, obwohl er selbst von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und unter Beobachtung der Gestapo stand. Er tat dies aus freien Stücken, als Privatperson und nicht im Auftrag einer Regierung oder Organisation. Dafür wurde er persönlich geehrt. Steinfeldt betont, dass die Ehrung keinesfalls politisch motiviert gewesen sei – und seine Rettungsgeschichte nicht ungewöhnlicher sei als die der anderen Judenretter. Darunter befinden sich 75 weitere Muslime, zumeist Albaner. Andererseits sei jede Rettung wieder ein Sonderfall, besonders die selbstlosen Taten der muslimischen Retter. Die Muslime, die Yad Vashem bislang als Retter eingestuft hatte, stammten alle aus Europa, so beispielsweise Selahattin Ülkümen, der türkischer Generalkonsul auf der Insel Rhodos war, wo er 50 Juden rettete. Helmy hingegen war Ägypter. Daher wartet die Medaille, die jetzt vor Steinfeldt auf dem Schreibtisch liegt, vergeblich darauf, abgeholt zu werden.
Auf der Medaille umklammern die Hände eines KZ-Häftlings einen Stacheldraht, der den Erdball umspannt und ihm den Anstoß zur Rotation gibt: Die Rettungsaktionen sind sozusagen die Existenzberechtigung für die Welt. Darauf steht der Spruch aus dem Talmud: »Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.« Auf der dazugehörigen Urkunde bedankt sich »das jüdische Volk« bei »Mohamed Helmy«. Aber niemand wird diese Urkunde und Medaille in Yad Vashem in Empfang nehmen, nicht so bald jedenfalls. Schade, denn der jüdische Spruch passt sehr gut zum 33. Vers der fünften Koransure al-Mā’ida (arabisch ›der Tisch‹): »Wenn jemand einen Menschen tötet … so soll es für ihn sein, als hätte er die ganze Menschheit getötet.«
Mohamed Helmy, der sich selbst Mod nannte, starb 1982 in Berlin. Er wurde 80 Jahre alt. Der Vorname Mod statt Mohamed steht auch auf seinem Grabstein auf dem Städtischen Friedhof Heerstraße in Berlin-Charlottenburg. Der ägyptische Botschafter in Israel würdigte zwar Helmys »edle Taten«, kann die Medaille aber nicht stellvertretend entgegennehmen, da sie nur dem Retter selbst oder seinen Verwandten ausgehändigt werden darf. Doch Mod Helmys Angehörige in Kairo weigern sich, die Auszeichnung anzunehmen. Sie freuten sich wohl darüber, hieß es in einer ägyptischen Zeitung, aber Mervat Hassan, die in Kairo lebende Ehefrau eines Großneffen von Helmy, hat sich von diesem Ehrentitel distanziert.[9] Sie lobte den Großonkel Helmy, meinte jedoch, dass er allen Patienten geholfen habe – egal welcher Religion oder Nationalität sie angehörten. Sie wolle keine Ehrung aus Israel, weil das Verhältnis zwischen Ägypten und Israel belastet sei, äußerte sie gegenüber einer ägyptischen Journalistin der US-Nachrichtenagentur Associated Press. Somit machte sie Helmys Heldentat zum Politikum. Zugleich sagte sie der Journalistin, dass sie nichts gegen Juden hätte.
Wahrscheinlich reagierten die verbliebenen Verwandten Helmys so aus Angst. Seit Jahren gilt Israel in der ägyptischen Öffentlichkeit als »Lieblingsfeind«. 2016 beschloss das ägyptische Parlament mit einer überwältigten Mehrheit, den Abgeordneten Tawfiq Okasha abzusetzen, nachdem er den israelischen Botschafter in Ägypten, Haim Koren, nach Hause zum Abendessen eingeladen hatte.[10] Die Politikwissenschaftlerin Noha Bakr, die an der Amerikanischen Universität von Kairo lehrt, meint, dass Ägypter, die die Kriege erlebt haben, »Israel immer als den zionistischen Feind betrachten werden«.[11] Andere Ägypter seien von den Medien beeinflusst, die sich häufig auf die Seite der Palästinenser stellten. So kann es durchaus sein, dass Helmys Verwandte Anfeindungen oder Drohungen seitens der allgegenwärtigen Sicherheitsbehörden, der Nachbarn oder der Öffentlichkeit fürchteten, die Kontakte mit Israel strikt ablehnen. Helmys Medaille und Urkunde werden also wohl noch lange in Jerusalem verstauben.
Doch Helmys Geschichte ist auch in Israel ein Politikum. Denn diese Gedenkstätte ist eine staatliche Institution, die auf der Grundlage eines speziellen Gesetzes gegründet wurde. Yad Vashem stellt eine klare Verbindung zwischen der Shoah und der Wiedergeburt des jüdischen Volkes in Israel her. Jeder offizielle Besucher in Israel wird in die Gedenkstätte eingeladen und am Holocaust-Gedenktag nehmen an der offiziellen Veranstaltung in Yad Vashem der Staatspräsident und der Premierminister sowie die gesamte politische Elite teil.
Irena Steinfeldts Büro in Yad Vashem schmücken etliche Fotos von bewegenden Treffen zwischen Judenrettern und den Geretteten oder ihren Nachfahren. Eine solche Zusammenkunft zwischen Helmys Nachfahren und denen von Anna Boros scheint mir in diesem Moment jedoch leider unrealistisch. Aber wer weiß: Vielleicht ist Helmys Mut ja vererbbar.
Hinter fast jedem anerkannten Judenretter steckt ein unermüdlicher Mensch, der die Geschichte dieses Retters mühsam zu Tage fördert und Yad Vashem zur Verfügung stellt. So hätten wir ohne das Ehepaar Dr. Karsten und Sabine Mülder wohl niemals von Mod Helmy gehört. Der Chirurg und die Krankengymnastin stießen auf seine Geschichte, als sie 1991 in Helmys früherem Wohnhaus in Berlin-Moabit ihre Praxen eröffneten, direkt unter Helmys ehemaliger Wohnung.[12] Bei ihrem Einzug erwähnte der damalige Hauseigentümer, der 1945 als Mieter in dieses Haus gezogen war, einen Mitbewohner namens Helmy, mit dem er eine Weile die Wohnung geteilt habe. Durch die vielen Bombenschäden waren die Wohnungen knapp geworden. Sie wurden offiziell zugeteilt, und nur verheiratete Paare durften sich ein Zimmer teilen.[13] Dem jungen Mann wurde ein Zimmer in Helmys intakter Vier-Zimmer-Wohnung zugewiesen.
Helmy hatte dem Mitbewohner erzählt, dass er während der Nazizeit in seiner Wohnung im ersten Stock Menschen illegal medizinisch versorgt habe. Diese Geschichte beeindruckte die Mülders so sehr, dass sie dem benachbarten Gymnasium eine finanzielle Förderung anboten, um über die Geschichte des Hauses zu recherchieren. Die Schüler waren mit dem Auftrag jedoch überfordert und das Ehepaar Mülder hatte selbst zu viel zu tun, um diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Den Namen Helmy vergaßen sie nicht, doch erst 20 Jahre später fanden sie die Zeit dafür – nach einer Ermunterung durch ihren Nachbarn, den Psychotherapeuten und Buchautor Wolfgang Krüger.[14]
Wolfgang Krüger machte sich im Jahr 2011 daran, die Geschichte seines eigenen Wohnhauses in Berlin-Moabit aufzuschreiben. Bei der Durchsicht der Akten im Bezirksamt stellte er fest, dass die Jahrgänge 1939 bis 1945 fehlten. Er fand heraus, dass drei Juden aus diesem Haus deportiert worden waren. In einem Buch fand Krüger auch einen Hinweis auf den ägyptischen Arzt Mod Helmy, der einige jüdische Patienten gerettet habe. Mod Helmy hatte schräg gegenüber in der Krefelder Straße 7 gewohnt.
Der Künstler Gunter Demnig verlegt seit 1995 vor den Häusern der Nazi-Opfer »Stolpersteine«, in den Boden eingelassene Messingplatten mit den Namen der deportierten Juden. Inzwischen gibt es rund 60 000 in 20 Staaten. In Deutschland sind es derzeit etwa 7000. Am 8. Oktober 2011 tat Demnig das auch vor Wolfgang Krügers Haus in der Krefelder Straße 20, um dort mit drei Stolpersteinen an die Ermordeten zu erinnern. Krüger lud den ganzen Kiez ein. So kamen er und Dr. Mülder ins Gespräch über Mod Helmy. »Beim Kaffeetrinken nach der Zeremonie habe ich gedrängt, dass er etwas tut«, so Krüger. Und dadurch wurde das Interesse der Mülders wieder entfacht.
Das Ehepaar teilte sich die Recherche auf: Sabine Mülder ging den Spuren der früheren jüdischen Bewohner des Hauses nach; Karsten Mülder folgte Helmys Werdegang in Berlin, der nach dem Tod von Helmys Frau Emmy 1998 nur noch aus Akten zu rekonstruieren war. Am 21. August 2012 informierte Mülder die Gedenkstätte Yad Vashem darüber, dass er und seine Frau im Rahmen ihrer Recherchen über Opfer der Shoah in ihrem Haus auf Mod Helmys Geschichte gestoßen waren, und dass sie Helmy für eine Ehrung vorschlagen.[15] Die Experten von Yad Vashem befanden die Argumente und Recherche-Ergebnisse der Berliner als überzeugend und ehrten am 29. Juli 2013 Mod Helmy und seine Helferin Frieda Szturmann. Frieda Szturmann (1897 – 1962) und Mod Helmy waren gute Bekannte. Sie war auch seine Patientin gewesen, und sie riskierte ihr Leben, indem sie ihm half, seine Schützlinge zu verstecken.
Der Satz, der den Anstoß zu Krügers Recherche und schließlich zu Helmys Ehrung und zu diesem Buch gegeben hatte, stammte aus dem Buch Widerstand in Mitte und Tiergarten von Hans-Rainer Sandvoß und lautete: »Dr. Helmy stand besonders in den 1940er Jahren vielen verfolgten Juden bei, besorgte illegale Quartiere, betreute Untergetauchte medizinisch und schaffte Lebensmittel herbei. Darüber hinaus schützte er Deutsche vor der Einziehung zu schwerer Arbeit oder zum Volkssturm und schrieb auch ›Fremdarbeiter‹ großzügig krank. Überlebende rühmten ihn als einen ›wundervollen Menschen‹.«[16]
An einem trüben Tag Ende November 2013 stehe ich schließlich zusammen mit einer Menschentraube in Berlin-Moabit vor dem Haus der Krefelder Straße 7. An diesem Tag werden vor Mod Helmys Wohnhaus Stolpersteine in den Boden eingelassen. Vor dem Eckhaus werden die Biografien der sieben ermordeten Hausbewohner und der beiden Hausbesitzer verlesen und die Teilnehmer legen Blumensträuße nieder. Sechs jüdische Bewohner dieses Hauses wurden im Frühjahr 1943 in Auschwitz ermordet, eine Bewohnerin im KZ Theresienstadt. Diese Deportationen müssen Helmy und Anna, die sich bei ihm versteckte, also miterlebt haben. Abwechselnd gedenken Karsten Mülder und sein Sohn der Ermordeten. Nach einer Schweigeminute sagt Mülder, er bedauere, dass kein Vertreter der ägyptischen Botschaft seiner Einladung gefolgt sei. Wahrscheinlich wollten die Ägypter einen Auftritt zusammen mit israelischen Offiziellen meiden, die ebenfalls eingeladen wurden.
Es beginnt zu regnen, Schirme werden aufgespannt und bald verabschieden sich die meisten Anwesenden. Da stellt uns Karsten Mülder Annemarie Wamboldt vor. Die Frau mit den glatten weißen Haaren und den großen dunklen Augen stützt sich auf einen Rollator. Sie ist zu dem Zeitpunkt 90 Jahre alt und wurde 1923 in diesem Haus geboren, in dem sie bis 1968 wohnte. »Sie kannte mindestens einige der Ermordeten, mindestens die Vermieter«, sagt Mülder. Annemarie Wamboldt sagt: Nein, sie kannte sie nicht, nur an zwei Familien könne sie sich erinnern. In das nun folgende betretene Schweigen hinein meint sie schließlich, an Dr. Helmy könne sie sich noch gut erinnern. Sie kannte ihn aber nur vom Sehen: »Groß, schlank, dunkelhaarig.« Sie lächelt verlegen. »Ich war doch nur ein junges Mädchen, aber mit dem Krieg war alles vorbei.«
Annemarie Wamboldt war erst vier Wochen nach Kriegsende vom Arbeitsdienst im Umland nach Hause zurückgekehrt, nach einem fünftägigen Fußmarsch. Am Ende traute sie sich nicht in die elterliche Wohnung, aus Angst vor den Russen. Im benachbarten Gemüseladen Gasba musste sie erfahren, dass ihr Vater Adolf Kraus tot war. Zwei Tage vor Kriegsende wurde er in dem Hauseingang, in dem wir gerade stehen und Schutz vor dem Regen suchen, durch einen Granatsplitter tödlich verletzt. Für einen Moment wirkt die hochbetagte Frau wie das Mädchen, das immer noch vergeblich auf seinen Vater wartet.
Im folgenden Jahr, an einem sonnigen, heißen Tag im Juli 2014 wird an der Fassade des Hauses in der Krefelder Straße 7 eine Gedenktafel für den früheren Mitbewohner Mod Helmy enthüllt. Diesmal ist Annemarie Wamboldt nicht mehr dabei. Anders als im November blicken die Teilnehmer dieser Gedenkzeremonie nicht traurig hinab auf die Namen der ermordeten Bewohner. Diesmal schauen sie nach oben, während ich die Laudatio auf den Judenretter halte, hinauf zum ersten Stock, wo Mod Helmy das jüdische Mädchen versteckt hat.
Dieses Mal wirken die Zuhörer positiv bewegt, ja sogar inspiriert. Diese einmalige Geschichte muss man aufschreiben, sagt anschließend ein Herr zu mir und händigt mir seine Visitenkarte aus. Der lange, steinige Weg zu diesem Buchprojekt beginnt.
Ein Ägypter in der Weimarer Republik
Khartum, die Hauptstadt des Sudan, ist am Ende des 19. Jahrhunderts eine endlose Ansammlung von Lehmhütten am Ufer des Nils. Die Hütten standen im starken Kontrast zum größten Gebäude der Stadt, dem 1899 eingeweihten Gordon’s Palace, dem Regierungspalast des britischen Hochkommissars für Ägypten, Herbert Kitchener. Der im venezianischen Stil erbaute Palast erinnert an eine üppige Hochzeitstorte und stand demonstrativ für die erneute britische Herrschaft. Denn 1898 hatten die Briten das frühere Handelszentrum für Elfenbein, Gummi und auch für Sklaven aus Zentralafrika nach der Niederschlagung des Mahdi-Aufstandes zurückerobert.
In dieser Zeit kommt Mohamed Helmy 1901 als Sohn des muslimischen Ägypters Said Ahmad und seiner Frau Aminah in Khartum zur Welt. Vater Said wurde um 1855 im Dorf Koum Bani Miras im Nildelta geboren und war bei Mohameds Geburt etwa 45 Jahre alt. Er war Major und als Besatzungsoffizier der anglo-ägyptischen Armee im Sudan stationiert. Diese Einheiten hatten 1898 den Mahdi-Aufstand gegen die Besatzer niedergeschlagen und überwachten anschließend den Aufbau der zerstörten Hauptstadt Khartum. Später wird Said Helmy zum Generalleutnant befördert. Mohamed Helmy hatte einen viel älteren Bruder und drei Schwestern.[17] Die Familie hielt enge Kontakte zu Ägypten aufrecht, wo sie die Ferien verbrachte.
Während Mohameds Kindheit wurde der Vater mehrmals beruflich versetzt. So zogen die Helmys erst nach al-Mansura in Nordägypten und dann nach Tanta im Nildelta. Schließlich ließ sich die Familie in Kairo nieder, wo Mohamed das renommierte Gymnasium Saidieh Secondary School besuchte. Diese staatliche Bildungseinrichtung, eine der ältesten Schulen des modernen Ägypten, liegt im Stadtteil Gizeh direkt neben der Kairo Universität.[18] Die 1908 gegründete Schule (Saidia bedeutet auf Arabisch »glücklich«) befindet sich in einem prächtigen weitläufigen Gebäude und stand damals an der Spitze der arabischen Bildungsbewegung. Sie war ein Symbol für den Aufbruch Ägyptens in das Zeitalter der Moderne.
Die Schule wurde zu einem Hort des politischen Aktivismus. Viele Saidieh-Schüler beteiligten sich an der Revolution von 1919 gegen die britische Kolonialherrschaft. Zu den Absolventen gehörten auch renommierte Persönlichkeiten. Aus der Politik waren es beispielsweise Hussein Sirri Pascha, der mehrmals zwischen 1940 und 1952 Premierminister wurde; Atef Ebeid, Ministerpräsident in den Jahren 1999 bis 2004; Abdel Rahman Azzam, der erste Generalsekretär der Arabischen Liga; aus der Wissenschaft der Physiker Ali Moustafa Mosharafa, der zur Entwicklung der Quantentheorie sowie zur Relativitätstheorie beitrug. Und auch einer der größten Unternehmer des Landes, Osman Ahmed Osman, Gründer der Osman-Gruppe, der die Errichtung des Assuan-Staudamms leitete, war auf diese Schule gegangen – ebenso wie namhafte Schauspieler wie Youssef Wahbi und Ahmed Mazhar.
Mohamed Helmy machte an dieser Schule 1922 Abitur. Anschließend wollte er unbedingt Medizin studieren und beschloss, für das Studium nach Deutschland zu gehen. Zum einen hatte ihm ein Freund, der bereits in Deutschland war, erzählt, dass die Ausbildung an der Medizinschule der Friedrich-Wilhelms-Universität eine der besten der Welt war, und er hatte ihm das Leben in dem fernen Land schmackhaft gemacht. Zum anderen wollte ihn die Familie keineswegs nach England gehen lassen, weil sie die Unabhängigkeit Ägyptens vom britischen Protektorat unterstützte.[19] Da Helmys Familie wohlhabend war, konnte sie seinen Aufenthalt und sein Studium in Berlin finanzieren. Also zog Helmy im September 1922 nach Berlin, wo er zunächst Deutschunterricht nahm, bevor er 1923 das Studium der Medizin beginnt.
Im März 1922, kurz vor Helmys Abitur, wurde Ägypten offiziell unabhängig. Faktisch aber setzten die Briten ihre Kolonialherrschaft verdeckt fort. Sultan Fuad durfte sich zwar nun König Fuad nennen, doch die Engländer kontrollierten weiterhin den Suezkanal und das Militär und bestimmten die Außenpolitik. Es folgten die diplomatische Anerkennung Ägyptens durch Deutschland im April 1922 und die Eröffnung des deutschen Generalkonsulats in Kairo. Diese neu aufgenommenen Beziehungen erleichterten Helmys Reise nach Deutschland. »Die Weimarer Republik lud viele muslimische Studenten ein«, erzählt die Historikerin und Religionswissenschaftlerin Gerdien Jonker vom Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa. »Diese kamen, weil Deutschland schon während des Ersten Weltkriegs den Widerstand in den muslimischen Staaten gegen die Engländer organisiert hatte.« 1925 studierten rund 400 Ägypter in Deutschland, 150 von ihnen in Berlin an der Berliner Universität (heute Humboldt-Universität), am Universitätsklinikum Moabit und an der juristischen Fakultät oder an einer technischen Hochschule.[20]
Die meisten Studenten waren Söhne gutsituierter ägyptischer Landbesitzer, Beamter, Rechtsanwälte und Ärzte, schreibt der Orientalist Gerhard Höpp. Sie schickten ihre Söhne – nur vereinzelt finden sich junge Frauen unter der muslimischen Studentenschaft – nach Berlin, wo die meisten von ihnen im schicken Westteil der Hauptstadt wohnten. Manche Studenten erhielten aber auch Stipendien des ägyptischen Bildungsministeriums, das ihre politischen Aktivitäten in Berlin durch das ägyptische Konsulat streng beobachten ließ. Junge, gebildete Ägypter hatten in den 1920er Jahren eine hohe Meinung von Deutschland. Dem Bericht eines Angestellten des Orientalischen Instituts der Universität Wien zufolge hat das Kräftemessen Deutschlands im Ersten Weltkrieg mit so vielen Nationen auf die von ihm in Österreich betreuten ägyptischen Studenten einen ungeheuren Eindruck hinterlassen. Diese Ägypter, so der Wiener Forscher, hielten Deutschland trotz seiner Niederlage für das erste aller europäischen Länder. Die meisten wollten unbedingt in Deutschland studieren und lernen, was das Land so unglaublich stark in diesem Krieg gemacht habe. Und auch der ägyptische Exdirektor der Orientbank, Hasan Said Basha, hebt in einem Gespräch mit seinem Dresdner Bankierkollegen die große Begeisterung für Deutschland unter jungen Ägyptern hervor: »Die ganze Jugend« Ägyptens studiere jetzt in Deutschland, und wer noch in England eingeschrieben sei, wechsele an eine deutsche Fakultät.[21] Ganz so viele waren es natürlich nicht. Aber Deutschland war en vogue, so viel steht fest.
So entstand bereits Anfang 1920 in Berlin die Gesellschaft »Brüder der Erneuerung«, gegründet vom Ägypter Ali Ahmed al-Inani, der am Seminar für Orientalische Sprachen (SOS) an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin promovierte.[22] Ziel der Organisation war es, in einem künftig unabhängigen Ägypten die Wissenschaften sowie das Studium junger Ägypter im Ausland zu fördern. Die treibende Kraft dieser Gesellschaft war der ägyptische Religionsgelehrte und Professor für arabische Sprache, Abd al-Aziz Schawisch, der Mitarbeiter der Nachrichtenstelle für den Orient (NfO) war. Die NfO war eine deutsche Propagandaeinrichtung, die im Ersten Weltkrieg im Auftrag des Auswärtigen Amtes insbesondere im Nahen Osten tätig war.
Unterstützung erhielten diese »Brüder« vom früheren NfO-Direktor Eugen Mittwoch, der als einer der Begründer der modernen Islamwissenschaften in Deutschland gilt. Dieser deutsch-jüdische Gelehrte und ausgebildete Rabbiner sprach modernes Hebräisch und hielt sich 1924 in Jerusalem auf, um an der dortigen Hebräischen Universität den Lehrstuhl für Semitistik mit aufzubauen.
Im Februar 1920 erschien in der nationalistischen Zeitung al-Afkar ein Artikel des Ägypters Salim Abdul Meguid, der sich gerade an der Medizinischen Fakultät der Berliner Universität immatrikuliert hatte. Meguid arbeitete für »die Brüder«. »Es lohnt sich, in Berlin zu studieren«, schreibt er: »Die Umtauschraten für Ausländer sind überaus günstig. Man kann gut und gern für zehn Pfund im Monat seinen Unterhalt bestreiten. Das Ausbildungsniveau ist hoch. Ein Zeugnis der (ägyptischen) Oberschule wird genügen, um Zugang zu einer Berliner Universität zu erhalten. Niemand soll schließlich Scheu davor haben, die deutsche Sprache zu erlernen.« Er stehe gern für weitere Auskünfte zur Verfügung, schreibt Meguid weiter und veröffentlicht sogar seine Adresse in Berlin-Wilmersdorf, Holsteinische Straße 33.[23]
Die Welt ist wirklich ein Dorf. Im Sommer 2015 sitze ich in der Holsteinischen Straße, im Haus Nummer 31, und halte eine Visitenkarte in der Hand. Darauf steht: Salim Abdul Meguid, Stud. Med., darunter die Adresse nur zwei Häuser weiter. Nur bin ich leider 100 Jahre zu spät. Meguid hat das Zeitliche längst gesegnet und das Haus hat den Krieg nicht überstanden. Seine Visitenkarte aber schon – im Familiennachlass von Miriam Mahdi. An diesem Sommertag besuche ich die Enkelin des wohl ersten Ägypters in Berlin: Mohamed Soliman. Der Zauberkünstler und Feuerschlucker kam im Jahr 1900 aus Kairo nach Berlin. Er heiratete eine Deutsche und eröffnete eines der ersten Stummfilmkinos der Stadt.
Miriam Mahdi, gebürtige Berlinerin, eine elegante Frau Jahrgang 1944, ist die erste Deutsche in ihrer ägyptischen Familie und zugleich die Hüterin der 117-jährigen Erfolgsgeschichte. Im Zentrum ihres wohlgeordneten Familienarchivs steht ein Fotoalbum, das einige Fotos ihres Großvaters Mohamed Soliman enthält. Sie zeigen einen selbstbewussten, kräftigen und modernen Mann mit durchdringendem Blick. Auf einem der Bilder trägt er einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd mit gestärktem Kragen und eine karierte Krawatte mit Krawattennadel. Auf einem anderen Foto trägt er einen Dreiteiler und sitzt mit einer Runde dunkelhäutiger, gepflegter Männer mit Schnurrbart, Krawatte oder Fliege zusammen.
Soliman war ein Pionier des Stummfilms in Berlin, wo er 1906 ein Stummfilmkino eröffnete. Vor dem Kino warben ägyptische Studenten mit rotem Fez für die Aufführungen. Ab 1910 organisierte er als Leiter der Orientalischen Abteilung im Lunapark in Berlin-Halensee sogenannte Völkerschauen. In Solimans nachgebauten »Somalidorf« zum Beispiel wurden Beduinen, Somalis und Sudanesen in Originaltracht ausgestellt – sie trugen weiße Gewänder, Sandalen und Turbane. Einer posierte mit einem Speer in der Hand, manche saßen vor einer Holzhütte mit Strohdach, eine geschmückte, barfüßige afrikanische Frau posierte und hielt ein Kleinkind auf dem Arm. »Somalineger« führten ihre Tänze auf, trommelten und stampften laut auf den Boden, so dass ihr Dorf mit Lärmschutzwänden von den Nachbarn des Lunaparks abgeschirmt werden musste.[24]
1911 präsentierte der Lunapark die »Straße von Kairo« mit Nachbauten einer Moschee, eines Kaffeehauses, eines Basars und eines Harems.[25] Miriam Mahdi weist in unserem Gespräch ausdrücklich darauf hin, dass solche Völkerschauen in der damaligen Zeit nicht als diskriminierend verstanden wurden. »Soliman wollte diese Kultur den Berlinern näherbringen und sah sich als Vermittler zwischen den Kulturen.«
Von 1915 bis zur großen Inflation 1923 leitete Soliman das Passage-Panoptikum, das Passage-Theater, das er nach dem Ersten Weltkrieg in ein Kino umfunktionierte, und das Linden-Cabaret, wo unter anderem die berühmte Sängerin Claire Waldoff auftrat. Diese Einrichtungen befanden sich in der 1873 eingeweihten Kaisergalerie, einer Ladenstraße an der Friedrichstraße, eine der Sehenswürdigkeiten Berlins. Zusätzlich richtete er in den Räumen des ehemaligen Café Keck in der Leipziger Straße eine sogenannte Orientalische Diele ein.[26] Auf diese Weise avancierte Soliman rasch zur wichtigsten Anlaufstelle für alle Ägypter in Berlin, darunter die rund 200 Studenten, die bis 1925 dem Aufruf der »Brüder der Erneuerung« gefolgt waren.
Soliman integrierte sich bestens in die deutsche Gesellschaft. »Er zählte damals zu den großen Persönlichkeiten Berlins«, sagt seine Enkelin, zugleich sei er ein arabischer Patriarch geblieben. »Mohameds deutsche Frau, seine drei Töchter und die beiden Frauen seiner ebenfalls in Deutschland lebenden Brüder wurden Ägypterinnen und verzichteten auf ihre deutsche Staatsbürgerschaft. Aber nur meine Tante Adila war ein Jahr lang in Ägypten, die anderen haben das Land niemals besucht, denn mein Großvater hat sie ziemlich abgeschirmt. Was Heiraten angeht, war ihm kein Anwärter gut genug«, sagt sie. »Viele Studenten aus Ägypten kamen zu ihm. Er hat sie gut betreut, aber wenn einer von ihnen auch nur eine Andeutung machte, dass er sich für eine der drei Töchter interessierte, dann war er sehr strikt«, weiß sie von ihrer Mutter und ihren Tanten. Es kann gut sein, dass auch Mod Helmy zu Solimans Gästen gehörte, als er mit seinen 21 Jahren das Berliner Leben zu erkunden begann. Mohamed Helmy nannte sich in Deutschland »Mod«, vielleicht weil er dadurch betonen wollte, dass er ein säkularer, moderner Ägypter war und sich vor Islamophobie schützen wollte. Sein Leben lang wird er in Formularen die Rubrik »Konfession« frei lassen.