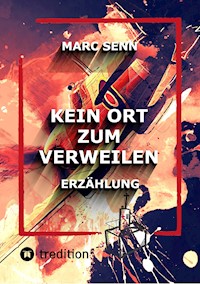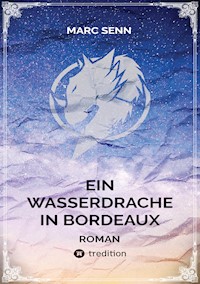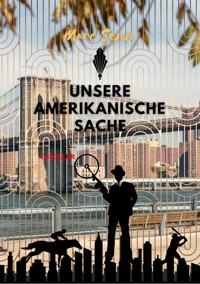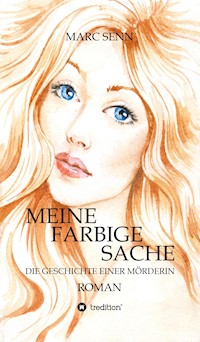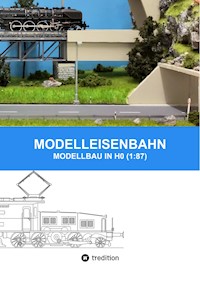
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Buch können digitale Modellanlagen für die Modelleisenbahn sowie für das Faller Car System in der Modellgrösse H0 (1:87) einfach und verständlich umgesetzt werden. In diesem Sachbuch sind alle wichtigen Informationen zur Planung enthalten. Dabei zeigt es die Grundlagen für die Anlagenplanung auf und unterstützt Anfänger sowie Fortgeschrittene in der Theorie, um eine möglichst detailgetreue und echte Miniaturwelt zu entstehen lassen. Darunter sind auch viele Vergleiche mit dem Vorbild enthalten, eine Formelsammlung sowie Berechnungen für die Trassierung oder für den Rahmenunterbau in Holz. Das Sachbuch dient zur Unterstützung der Planung und der Realisierung von Modelleisenbahnen. Da auch in der Welt der Modelleisenbahn das digitale Zeitalter erreicht hat, dürfte die Therorie und das Wissen darüber nicht fehlen! Die Digitaltechnik erschwert die Planung von Modellanlagen. Dafür ist die Steuerung ganzer Modellanlagen einfacher und ist die Anlage gelungen, hält der Spass auch an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Marc Senn
MODELLEISENBAHN
MODELLBAU IN H0 1:87
Auflage:
2. Auflage
Copyright:
© 2019 Marc Senn
Umschlag:
Marc Senn
Korrektorat:
tredition GmbH
Druck und Distribution im Auftrag:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Ausgabeformat:
Paperback
(ISBN: 978-3-347-69650-1)
Hardcover
(ISBN: 978-3-347-69651-8)
e-Book
(ISBN: 978-3-347-69652-5)
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliographische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte biliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Vorwort
2 Norm der Modellbahn
3 Vorbild
4 Geschichte der Bahn
4.1 Die Entstehung der Eisenbahn
4.2 Die Entstehung der Modellbahn
4.3 Die Vorbilder der Modellbahn in der Schweiz
5 Einführung
5.1 Definitionen
5.2 Abkürzungen
5.3 Einteilung des Gleises
5.4 Geschwindigkeiten
5.5 Spurweiten
5.6 Modellgrösse
5.7 Platzbedarf
5.8 Werkzeuge
5.9 Smart Tools
5.10 Schienenprofil und Schienenlaschen
5.11 Radsatz
5.12 Laufsatz (Laufradsatz)
5.13 Haftreifen
5.14 Normschacht
5.15 Kupplungen
5.16 Gleisgeometrie
5.16.1 Aufbau einer Weiche
5.17 System
5.18 Gleise
5.18.1 Dreileitergleis (Mittelleiter)
5.18.2 Zweileitergleis mit Pukos ausrüsten
5.18.3 Zweileitergleis
5.18.4 Zweileitergleis mit Zahnradstange
5.19 Loks
5.19.1 Wechselstrom (AC)
5.19.2 Gleichstrom (DC)
5.20 Steuerungstechnik
5.21 Zentralen (digital)
5.22 Betrieb
5.22.1 Bauformen Stellwerke
5.22.2 Funktion eines Stellwerkes
5.23 Sicherungstechnik
5.23.1 Bahnsicherungstechnik auf offener Strecke
5.23.2 Bahnsicherungstechnik im Bahnhofsbereich
5.24 Rückmelder
5.25 Rückmeldung
5.26 Bremskurve
5.27 Durchführen einer Zugfahrstrasse
5.28 Computersoftwaresteuerung
5.28.1 Systemanforderungen
5.28.2 Kompatibilität
5.29 Epochen
6 Konzeptplanung
6.1 Raum
6.2 Anlageformen
6.2.1 Grundformen
6.2.2 Spezialformen
6.3 Anlagearten
Gleisplan
7 Technische Anlagenplanung
7.1 Unterbau
7.1.1 Holzwerkstoff
7.1.2 Holzeigenschaften
7.1.3 Holzart
7.1.4 Beanspruchung von Holz
7.1.5 Rahmenbauweise
7.1.6 Segmentbauweise
7.1.7 Modulbauweise
7.2 Oberbau
7.2.1 Gleisbettung
7.2.2 Gleisschotter
7.2.3 Lichtraumprofil bei gerader Gleisführung
7.2.4 Lichtraumprofil bei gebogener Gleisführung
7.2.5 Tunnelbauweise
7.2.6 Tunnelprofile
7.2.7 Brückenbauweise
7.2.8 Brückenprofile
7.2.9 Gleisabstände bei gerader Gleisführung
7.2.10 Gleisabstände bei gebogener Gleisführung
7.2.11 Kurvenverbreiterung
7.2.12 Gleisüberhöhungen
7.2.13 Kippen (Standfestigkeit)
7.2.14 Steigungs- und Gefällstrecken
7.2.15 Bogenradien
7.2.16 Übergangsbögen
7.2.17 Oberleitung
8 Elektrische Anlagenplanung
8.1 Stromversorgung
8.2 Leitungen
8.2.1 Leitmaterial
8.2.2 Leiterquerschnitt
8.2.3 Bemessung der Leiter
8.2.4 Farbsystem
8.2.5 Anschlussnummerntabelle
8.2.6 Anschlussnummernplan
8.2.7 Kabelverlegung
8.2.8 Kurzschlussgefahr
8.3 Beleuchtung Modellbahn
8.3.1 Beleuchtung von Loks
8.3.2 Beleuchtung von Personenwagen
8.3.3 Beleuchtung von Hallen- oder Perrondächern
8.3.4 Beleuchtung von Gebäuden
8.3.5 Beleuchtung der Anlage am Tag
8.4 Signale
8.4.1 Signalsystem L für Zugfahrten
8.4.2 Signalsystem N für Zugfahrten
8.4.3 Position der Signale
8.4.4 Signalaufstellung
8.4.5 Sockeltypen
8.4.6 Weitere Signale
8.4.7 Rangiersignale
8.4.8 Zwergsignale
8.5 Signalschilder
8.6 Schlusslicht
9 Gestalterische Anlagenplanung
9.1 Fahrzeuge
9.1.1 Fahrzeugkategorien
9.1.2 Normalprofil ausserorts
9.1.3 Normalprofil innerorts
9.1.4 Testfahrten
9.2 Gebäude
9.2.1 Betriebsanlagen
9.2.2 Bahnhöfe
9.2.3 Bahnsteige
9.3 Landschaft und Gelände
9.4 Felsen und Berge
9.5 Gewässer
9.6 Figuren
10 Wartung- und Unterhaltsarbeiten
10.1 Anlage
10.2 Lok-Wartung
10.2.1 Lok-Prüfstand
10.2.2 Lok-Liege
10.2.3 Lok-Drehliege (Wartungsbank)
10.2.4 Lok-Reinigung
11 Aufbewahrung
11.1 Rollmaterial
12 Transport
12.1 Rollmaterial
13 Kosten
13.1 Kostenschätzung
14 Formelsammlung
14.1 Einheiten
14.1.1 Längen
14.1.2 Flächen
14.1.3 Volumen
14.1.4 Gewicht
14.1.5 Geometrie
14.1.6 Lasten
14.1.7 Material
14.1.8 Kraft
14.2 Berechnungen von Längen und Flächen
15 Berechnungen für die Trassierung
15.1 Einführung
15.2 Berechnungen von horizontaler Linienführung
15.2.1 Berechnung von Kreisbögen
15.2.2 Berechnung von Klothoiden als Übergangsbogen
15.3 Berechnung von vertikaler Linienführung
15.3.1 Berechnung von Steigung (Gefälle)
15.3.2 Berechnung von vertikalen Ausrundungen
15.4 Bemessung Unterbau Rahmenbauweise
15.5 Schraubverbindungen
16 Sperrholz
16.1 Birkensperrholz
17 Schweizer Modellbahnen
17.1 Smilestones Schaffhausen
17.1.1 Einleitung
17.1.2 Die Anlage
17.1.3 Bahnunternehmen und Epochen
17.1.4 Technische Daten
17.1.5 Besonderes
17.2 Verkehrshaus der Schweiz
17.2.1 Einleitung
17.2.2 Die Anlage
17.2.3 Bahnunternehmen und Epochen
17.2.4 Technische Daten
17.2.5 Besonderes
17.3 Kaeserberg Fribourg
17.3.1 Einleitung
17.3.2 Die Anlage
17.3.3 Bahnunternehmen und Epochen
17.3.4 Technische Daten
17.3.5 Besonderes
18 Geschichte der Automobile
18.1 Die Entstehung der Cars
18.2 Die Entstehung der Modellcars
18.3 Die Vorbilder der Cars in der Schweiz
19 Einführung
19.1 Definitionen
19.2 Abkürzungen
19.3 Platzbedarf
19.4 Werkzeuge
19.5 Smart Tools
20 Car System
20.1 FALLER Car System Digital 3.0
20.1.1 Funktionselemente
20.1.2 Sensoren
20.1.3 Satelliten
20.1.4 Fahrzeuge Car System
20.2 Fahrzeuge Schweiz
20.2.1 Fahrzeugkategorien
20.2.2 Fahrzeugtypen Normalfall
20.2.3 Fahrzeugtypen Extremfall
20.2.4 Besondere Fahrzeugtypen (öffentliche Hand / Landwirtschaft / Bau)
20.2.5 Einschlagwinkel der Fahrzeuge
20.2.6 Einschlag von Fahrzeugtypen
20.2.7 Begrenzung der Fahrzeuge
21 Konzeptplanung
21.1 Fahrbahnplanung
21.2 Softwareplanung
22 Technische Anlagenplanung
22.1 Unterbau
22.2 Oberbau
22.2.1 Geländebauweise
22.2.2 Brückenbauweise
22.3 Strassen
22.3.1 Lichtraumprofil bei gerader Fahrbahnführung
22.3.2 Lichtraumprofil bei gebogener Fahrbahnführung
22.3.3 Tunnel- oder Brückenprofile bei gerader Fahrbahnführung
22.3.4 Tunnel- oder Brückenprofile bei gebogener Fahrbahnführung
22.3.5 Quergefälle
22.3.6 Steigung- und Gefällstrecken
22.3.7 Bogenradien
22.3.8 Kurvenverbreiterung
22.3.9 Schleppkurven
22.3.10 Optimierte Kurvenverbreiterung
22.3.11 Übergangsbogen
22.3.12 Geometrie
22.3.13 Horizontale Linienführung
22.3.14 Vertikale Linienführung
22.3.15 Knoten
22.3.16 Wendeanlagen
22.3.17 Bushaltestellen
22.3.18 Fussgängerübergang
22.3.19 Laser-Street
22.4 Gestalterische Anlagenplanung
22.4.1 Rillenfräse
22.4.2 Fahrdraht
22.4.3 Spachtelmasse
22.4.4 Strassenfarbe
22.4.5 Normalprofil ausserorts
22.4.6 Normalprofil innerorts
22.4.7 Testfahrten
22.4.8 Markierung
22.4.9 Signalisierung
22.4.10 Lichtsignalanlage
22.4.11 Kandelaber
22.4.12 Anschluss Kandelaber
23 Wartung- und Unterhaltsarbeiten
23.1 Anlage
23.2 Liege
24 Aufbewahrung
24.1 Cars
25 Transport
25.1 Cars
26 Kosten
26.1 Kostenschätzung
27 Formelsammlung
27.1 Einheiten
27.1.1 Längen
27.1.2 Flächen
27.1.3 Volumen
27.1.4 Gewicht
27.1.5 Geometrie
27.1.6 Lasten
27.1.7 Material
27.1.8 Kraft
27.2 Berechnungen von Längen und Flächen
28 Berechnungen für die Trassierung
28.1 Einführung
28.2 Berechnungen von horizontaler Linienführung
28.2.1 Berechnung von Kreisbögen
28.2.2 Berechnung von Klothoiden
28.3 Berechnung von vertikaler Linienführung
28.3.1 Berechnung von Steigung (Gefälle)
28.3.2 Berechnung von vertikalen Ausrundungen
29 Kontaktdaten
29.1 Hersteller
29.2 Händler
29.3 Verbände
29.4 Ausstellungen
30 Notizen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Erste Modellbahnanlage von Napoleon III in Frankreich, Foto Lizenzfrei, nicht urheberrechtlich geschützt
Abbildung 2: Spurweiten in der Schweiz, Spurweiten Modell gemäss MOROP NEM 010
Abbildung 3: Spurweite Normalspur (H0) Vorbild / Modell, Foto Marc Senn
Abbildung 4: Massstabgetreue Abbildung einer Lok in H0, Foto Marc Senn
Abbildung 5: Begrenzungen der H0 Modelle in [mm], gemäss MOROP NEM 301
Abbildung 6: Einfacher Lötkolben zum Beispiel von BASETECH 30W max. 450°C, Foto Marc Senn
Abbildung 7: Feinbohrer mit Trennscheibe für Stahl zum Beispiel von PROXXON MICROMOT 230/E, Foto Marc Senn
Abbildung 8: Gleisklammern, Foto Marc Senn
Abbildung 9: Gleislehren, Foto Marc Senn
Abbildung 10: Ansicht Piko Messwagen, Foto Marc Senn
Abbildung 11: Sensor und Farbcodierung an Laufsatz für die genauen Messungen, Foto Marc Senn
Abbildung 12: Ansicht Piko Messwagen mit geschlossener Schiebetür, Foto Marc Senn
Abbildung 13: Ansicht mit Farbdisplay, Foto Marc Senn
Abbildung 14: Ansicht (Rückseite) mit vier Druckknöpfen sowie die USB-Buchse, Foto Marc Senn
Abbildung 15: PIKO ANALYST, Software für den Piko Messwagen, Foto Marc Senn
Abbildung 16: PIKO ANALYST, Übersicht, Foto Marc Senn
Abbildung 17: PIKO ANALYST, Messdaten eingelesen, Foto Marc Senn
Abbildung 18: PIKO ANALYST, Messdaten im Abschnitt Marker A bis B analysieren, Foto Marc Senn
Abbildung 19: PIKO ANALYST, Fenster Echtzeitanzeige, Foto Marc Senn
Abbildung 20: Piko ANALYST, Fenster Wagenanzeige, Foto Marc Senn
Abbildung 21: Geometrisches Schienenprofil H0 und Schienenlasche, gemäss MOROP NEM 120, Foto Marc Senn
Abbildung 22: Isolierte Radsätze für Gleichstrom (DC) mit Antriebszahnrad Kunststoff, PIKO, Foto Marc Senn
Abbildung 23: Laufsätze für Wechselstrom (AC), links mit Speichen, mittig von Märklin, rechtes kleiner Radsatz,
Abbildung 24: Isolierte Laufsätze für Gleichstrom (DC), links mit Speichen, mittig von Märklin und rechtes ein kleiner Radsatz, Foto Marc Senn
Abbildung 25: Querschnitt Wagenlaufsatz mit Spitzenlager, gemäss MOROP NEM 310 und 314
Abbildung 26: Haftreifen für Radsätze, Foto Marc Senn
Abbildung 27: Kupplung / Normschacht und Haftreifen am Radsatz resp. auf Laufkranz mit einer Nut aufgezogen,
Abbildung 28: Gleiselement Gerade, Standardlänge
Abbildung 29: Kurze Geraden
Abbildung 30: Gleiselement Bogen
Abbildung 31: Gleisgeometrie Bogen
Abbildung 32: Gleiselement Kreuzung 15°
Abbildung 33: Gleiselement Kreuzung 30°
Abbildung 34: Gleiselement Kreuzung 45°
Abbildung 35: Gleiselement Weiche links
Abbildung 36: Gleiselement Weiche rechts
Abbildung 37: Gleiselement Bogenweiche links
Abbildung 38: Gleiselement Bogenweiche rechts
Abbildung 39: Gleiselement 3-Wege-Weiche
Abbildung 40: Gleiselement Y-Weiche
Abbildung 41: Gleiselement Doppelkreuzungsweiche
Abbildung 42: Gleiselement Flexgleis
Abbildung 43: Aufbau einer Weiche, gemäss MOROP NEM 124
Abbildung 44: Dreileitergleise mit und ohne Bettung, Foto Marc Senn
Abbildung 45: Zweileitergleise mit Bettung, Foto Marc Senn
Abbildung 46: Zweileitergleise ohne Bettung, Foto Marc Senn
Abbildung 47: Ansicht AC-Lok SBB ES 64 Cargo (Digital), Hersteller Märklin, Foto Marc Senn
Abbildung 48: Ansicht DC-Lok BLS Cargo Alpinist VI (Digital aufrüstbar), Hersteller PIKO, Foto Marc Senn
Abbildung 49: Unterseite einer AC-Lok SBB ES 64 Cargo (Digital), Hersteller Märklin, Foto Marc Senn
Abbildung 50: Oberseite einer AC-Lok SBB ES 64 Cargo (Digital), Hersteller Märklin, Foto Marc Senn
Abbildung 51: Unterseite einer DC-Lok BLS Cargo Alpinist VI (Digital aufrüstbar), Hersteller PIKO, Foto Marc Senn
Abbildung 52: Oberseite einer AC-Lok BLS Cargo Alpinist VI (Digital aufrüstbar), Hersteller MPIKO, Foto Marc Senn
Abbildung 53: Analogspannung mit variablen Spannungsverlauf (orange Linie)
Abbildung 54: Digitalspannung (orange Linie) mit DCC-Steuersignal (blaue Linie), gemäss MOROP NEM 670
Abbildung 55: Digitalspannung (orange Linie) mit Datenimpulsen (blaue Linie), gemäss MOROP NEM 680
Abbildung 56: Zentrale CS 3 / CS 3plus mit Netzteil, Foto Märklin
Abbildung 57: Zentrale CS 3, Anschlüsse Rückseite, Foto Marc Senn
Abbildung 58: ECoS 2.1 Zentrale mit Netzteil, Foto ESU
Abbildung 59: ECoS 2.1 Zentrale 6A, Anschlüsse, Foto Marc Senn
Abbildung 60: Zentrale Z21 mit Netzteil und Router, Foto R/F
Abbildung 61: Steuerung mittels Smartphones / Tablet-PC oder Multimaus, Foto R/F
Abbildung 62: z21 Start Version für Einsteiger, Anschlüsse, Foto R/F
Abbildung 63: Z21 Version für Experten, Anschlüsse, Foto R/F
Abbildung 64: Mechanisches Stellwerk „Bruchsal J“, Foto Marc Senn
Abbildung 65: Rückmeldung über Kontaktgleise, 2-Leiter, in eine Fahrtrichtung
Abbildung 66: Rückmeldung über Kontaktgleis, 2-Leiter, in beide Fahrtrichtungen
Abbildung 67: Rückmeldung über Kontaktgleis, 3-Leiter, in eine Fahrtrichtung
Abbildung 68: Rückmeldung über Kontaktgleis, 3-Leiter, in beide Fahrtrichtungen
Abbildung 69: Bremskurve linear
Abbildung 70: Bremskurve mit Block-Brems-Zeitgeber (BBT)
Abbildung 71: Zugfahrstrasse mit Durchrutschen und Flankenschutz
Abbildung 72: Beispiel eines itlis-Lupenbildes von Siemens Mobility AG, Bereichsübersicht auf dem PC-Desktop, Foto © Siemens Mobility AG
Abbildung 73: GF I – Anlage im Raum Abbildung 74: GF II – Anlage an der Wand (L)
Abbildung 75: GF III – Anlage an Wand (U) Abbildung 76: GF IV – Anlage Raum / Wand
Abbildung 77: GF V – Anlage geschlossen an Wand Abbildung 78: GF VI – Anlage geschlossen im Raum
Abbildung 79: Spezialform I
Abbildung 80: Repräsentativer Gleisplan „Kreisverkehr“ inkl. Ausweichstelle
Abbildung 81: Repräsentativer Gleisplan „mit Zielverkehr“ inkl. Endbahnhof, Streckenbahnhof und Kehrschleife
Abbildung 82: Deckplatte in der Farbe Grün an einem Beispiel 2‘000 x 1‘000 mm
Abbildung 83: Kräfteverlauf im Unterbau an einem Beispiel 2‘000 x 1‘000 mm
Abbildung 84: Spante (einfacher Träger)
Abbildung 85: Pfosten (Druckstab)
Abbildung 86: Rahmenbauweise mit zwei Ebenen und Kreiswendel Beispiel 2‘000 x 1‘000 mm
Abbildung 87: Rahmenbauweise mit Bergstrecke und Schattenbahnhof unter Berg Beispiel 2‘000 x 1‘000 mm
Abbildung 88: Segmentbauweise an einem Beispiel U-Form
Abbildung 89: Modul Anschlussfläche (Stirnbrett), Ansicht in [mm], gemäss MOROP NEM 933/2 CH
Abbildung 90: Modul Gerade 600/1200 und 1800 mm, Aufsicht in [mm], gemäss MOROP NEM 933/2 CH
Abbildung 91: Modul Bogen, Aufsicht in [mm], gemäss MOROP NEM 933/2 CH
Abbildung 92: Schichten und Kraftverteilung
Abbildung 93: Schichten und Kraftverteilung
Abbildung 94: Dimensionierung Oberbau in [mm], gemäss MOROP NEM 122
Abbildung 95: Detail Korkbettung in [mm]
Abbildung 96: Roll- und Profilkork, Fotos Marc Senn
Abbildung 97: Musterbeispiele für die Gleisschotterung, links mit C-Gleis und rechts mit K-Gleis, Foto Marc Senn
Abbildung 98: Schotterverteiler, Foto Marc Senn
Abbildung 99: Lichtraumprofil bei gerader Gleisführung in [mm], gemäss MOROP NEM 102
Abbildung 100: Lichtraumprofil bei gebogener Gleisführung in [mm], gemäss MOROP NEM 103
Abbildung 101: Tunnelprofil bei gerader Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 102: Tunnelprofil bei gebogener Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 103: Tunnelprofil mit Doppelspur bei gerader Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 104: Tunnelprofil mit Doppelspur bei gebogener Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 105: Tunnelprofil rund bei gerader Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 106: Tunnelprofil rund bei gebogener Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 107: Tunnelprofil rund mit Doppelspur bei gerader Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 108: Tunnelprofil rund mit Doppelspur bei gebogener Strecke in [mm], gemäss MOROP NEM 105
Abbildung 109: Statisches System Einfeldträger
Abbildung 110: Beispiele Einfeldträger
Abbildung 111: Statisches System Durchlaufträger
Abbildung 112: Beispiele Durchlaufträger
Abbildung 113: Statisches System Bogen oder Gewölbe
Abbildung 114: Beispiele System Bogen oder Gewölbe
Abbildung 115: Statisches System geschlossener Rahmen
Abbildung 116: Beispiele geschlossener Rahmen
Abbildung 117: Statisches System offener Rahmen
Abbildung 118: Beispiele offener Rahmen
Abbildung 119: Statisches System Rohr- oder Maulprofil
Abbildung 120: Beispiele Rohr- oder Maulprofil
Abbildung 121: Letzigrabenbrücke, Foto Marc Senn
Abbildung 122: Brückenprofil bei gerader Strecke in [mm]
Abbildung 123: Brückenprofil bei gebogener Strecke in [mm]
Abbildung 124: Brückenprofil mit Doppelspur bei gerader Strecke in [mm]
Abbildung 125: Brückenprofil mit Doppelspur bei gebogener Strecke in [mm]
Abbildung 126: Rheinbrücke Eglisau 1879, Foto Marc Senn
Abbildung 127: Gleisabstände bei gerader Gleisführung in [mm], gemäss MOROP NEM 112
Abbildung 128: Gleisabstände bei gebogener Gleisführung in [mm] , gemäss MOROP NEM 112
Abbildung 129: Kurvenverbreiterung in [mm]
Abbildung 130: Kurvenverbreiterung Doppelgleis in [mm]
Abbildung 131: Gleisüberhöhung in [mm], gemäss MOROP NEM 114
Abbildung 132: Überhang mit Drehgestellwagen 132.5 mm, Drehgestellabstand ca. 80.0 mm in [mm]
Abbildung 133: Überhang mit Drehgestellwagen 250.0 mm, Drehgestellabstand ca. 170.0 mm in [mm]
Abbildung 134: Überhang mit Drehgestellwagen 310.0 mm, Drehgestellabstand ca. 210.0 mm in [mm]
Abbildung 135: Klothoide als Übergangsbogen vor und nach Bogen für eine 90° Kurve
Abbildung 136: Oberleitung – Fahrdrahtbereich in [mm], gemäss MOROP NEM 201
Abbildung 137: Oberleitung - Fahrdrahtbereich in gerader Streckenführung in [mm] , gemäss MOROP NEM 201
Abbildung 138: Oberleitung - Fahrdrahtbereich in gebogener Streckenführung in [mm] , gemäss MOROP NEM 201
Abbildung 139: Oberleitung - Fahrdrahtbereich in Bergstrecke, Längsschnitt in [mm]
Abbildung 140: Oberleitung - Fahrdrahtbereich in Bergstrecke, Längsschnitt in [mm]
Abbildung 141: Oberleitung - Doppelspur in [mm]
Abbildung 142: Oberleitung - Quertragwerk mit 3-Spuren (schmal) in [mm]
Abbildung 143: Oberleitung - Quertragwerk mit 3-Spuren (breit) in [mm]
Abbildung 144: Oberleitung - Quertragwerk mit 4-Spuren in [mm]
Abbildung 145: Oberleitung - Quertragwerk mit 5-Spuren in [mm]
Abbildung 146: Oberleitung - Quertragwerk mit 2-Spuren, Bahnsteig mittig in [mm]
Abbildung 147: Oberleitung - Quertragwerk mit 2-Spuren, Bahnsteig mittig mit Dach in [mm]
Abbildung 148: Oberleitung - Quertragwerk mit 2-Spuren, Bahnsteige aussen in [mm]
Abbildung 149: Oberleitung - Quertragwerk mit 2-Spuren, Bahnsteige aussen mit Vordach in [mm]
Abbildung 150: Oberleitung - Quertragwerk mit 4-Spuren, Bahnsteigen in [mm]
Abbildung 151: Oberleitung – 2 Quertragwerke mit 4-Spuren, Bahnsteigen mit Dach [mm]
Abbildung 152: Oberleitung – Fahrdraht mit Hängeträger aufgehängt in [mm]
Abbildung 153: Oberleitung – Fahrdraht mit Richtdraht und Seitenhaltern aufgehängt in [mm]
Abbildung 154: Oberleitung – Abspannung Oberleitung hinter Tunnelportal in [mm]
Abbildung 155: Oberleitung – Fahrdraht mit dickem Draht oder Lochband weiterführen in [mm]
Abbildung 156: Oberleitung – Unter Brücke mit Tragseil in [mm]
Abbildung 157: Oberleitung – Unter Brücke ohne Tragseil in [mm]
Abbildung 158: Draht Abbildung 159: Litze
Abbildung 160: Beispiel eines sauber aufgebauten Anschlussnummernplans für eine einfache Modellbahnanlage
Abbildung 161: Leuchtenklemmen z. B. von WAGO, 2-,3- und 5-polig, Foto Marc Senn
Abbildung 162: Stromversorgung bei einer Wendeschlaufe mit Dreileitergleisen, Keine Kurzschlussgefahr
Abbildung 163: Stromversorgung bei einer Wendeschlaufe mit Zweileitergleisen, Achtung Kurschluss!
Abbildung 164: LED-Liste von Viessmann, Foto Marc Senn
Abbildung 165: FALLER, Beleuchtungssockel mit LED, Fotos © Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 166: Position der Signale bei Einzel- oder Doppelgleisen in [mm]
Abbildung 167: Position der Signale bei einem Fahrleitungsträger (Bespiele) in [mm]
Abbildung 168: Position der Signale bei einer Signalbrücke, beidseitige Fahrtrichtung (Bespiele) in [mm]
Abbildung 169: CVD-Sockel, Foto MicroScale
Abbildung 170: Beispiel Signalisierung verminderte Geschwindigkeit
Abbildung 171: Beispiel Signalisierung Langsamfahrstelle
Abbildung 172: Schlusslichter
Abbildung 173: Normalprofil Ausserorts mit gerader Linienführung in [mm]
Abbildung 174: Normalprofil Ausserorts mit gebogener Linienführung in [mm]
Abbildung 175: Normalprofil innerorts in [mm]
Abbildung 176: Schiebebühne von Märklin, Foto Märklin
Abbildung 177: Drehscheibe von Roco, Foto Roco
Abbildung 178: Abmessungen Bahnsteighöhe in [mm]
Abbildung 179: Detail Bahnsteig
Abbildung 180: Abmessungen Laderampenhöhe in [mm]
Abbildung 181: Detail Laderampe
Abbildung 182: NOCH: Alugewebe, Foto Marc Senn
Abbildung 183: NOCH: Vergrösserung Alugewebe, Foto Marc Senn
Abbildung 184: NOCH: Krepp, Foto Marc Senn
Abbildung 185: NOCH: Vergrösserung Krepp, Foto Marc Senn
Abbildung 186: NOCH: Gipsbinden, Foto Marc Senn
Abbildung 187: NOCH: Montage Spachtel, Foto Marc Senn
Abbildung 188: NOCH: Acrylfarben, Foto Marc Senn
Abbildung 189: NOCH: Gras Master 2.0, Foto Marc Senn
Abbildung 190: NOCH: Landschaftsbau – Kleber- und Sprühflasche, Foto Marc Senn
Abbildung 191: NOCH: Landschaftsbaukleber, Foto Marc Senn
Abbildung 192: NOCH: Felsspachtel „Granit“ und „Sandstein“, Foto Marc Senn
Abbildung 193: NOCH: Acrylspray (schwarz, elfenbein und cocker), Foto Marc Senn
Abbildung 194: NOCH: Water- Drops, Foto Marc Senn
Abbildung 195: NOCH: Water-Drops „Color“, Foto Marc Senn
Abbildung 196: NOCH: Waser- Effekte, Foto Marc Senn
Abbildung 197: Figuren Menschen, Foto Marc Senn
Abbildung 198: Figuren Tiere 1, Foto Marc Senn
Abbildung 199: Figuren Tiere 2, Foto Marc Senn
Abbildung 200: Roco; SBB Reinigungswagen für Schienen (2-Leitergleise) mit Schleifstück, Foto Marc Senn
Abbildung 201: LUX: Gleisstaubsaugerwagen, Foto Marc Senn
Abbildung 202: LUX: Schienenschleiferwagen, Foto Marc Senn
Abbildung 203: LUX: Mittelleiterreinigungswagen, Foto Marc Senn
Abbildung 204: Lok-Prüfstand zum Beispiel von Lok-Gallery, Foto Lok-Gallery
Abbildung 205: Lok-Prüfstand zum Beispiel von Lok-Gallery auch für sehr lange Doppellok geeignet, Foto Lok-Gallery
Abbildung 206: Lok-Liege lang zum Beispiel von Lok-Gallery, Foto Marc Senn
Abbildung 207: Lok-Drehliege, zum Beispiel, Proses PLB-902 Lok, Foto Marc Senn
Abbildung 208: Microfaser-Reinigungstuch zum Beispiel von Lok-Gallery
Abbildung 209: Druckluftreiniger zum Beispiel von vivanco, Foto vivanco
Abbildung 210: Berechnung des Kreisbogens
Abbildung 211: Berechnung Übergangsbogen mittels Klothoide
Abbildung 212: Übergangsbogen Konstruktion der Klothoide
Abbildung 213: Berechnung Steigung (Gefälle)
Abbildung 214: Berechnung vertikale Ausrundungen in Kuppen oder Wannen
Abbildung 215: Die Fälle von Ausrundungen
Abbildung 216: Vertikale Ausrundung für Bahn bei Kuppen, Übergang Rampe (Fall Kuppe)
Abbildung 217: Vertikale Ausrundung für Bahn bei Kuppen, Übergang Rampe (Fall Wanne)
Abbildung 218: Beispiel für die Bemessung des Unterbaus aus Sperrholz in [mm]
Abbildung 219: Sperrholz, zum Beispiel Birken 15 mm mit 11 Funierlagen kreuzweise verleimt, Foto Marc Senn
Abbildung 220: Anlagenbereich Abschnitt 1, Gleisbau und Kieswerk, Foto smilestones
Abbildung 221: Anlagenbereich Abschnitt 1, Festung Munot, Foto Marc Senn
Abbildung 222: Anlagenbereich Abschnitt 1, Rheinfall, Foto Marc Senn
Abbildung 223: Anlagenbereich Abschnitt 1, mit Faller Car System, Foto Marc Senn
Abbildung 224: Anlagenbereich Abschnitt 1, Burg Hohenklingen, Foto smilestones
Abbildung 225: Anlagenbereich Depot Erstfeld, Foto Marc Senn
Abbildung 226: Anlagenbereich Strecke nach Wassen, Foto Marc Senn
Abbildung 227: Anlagenbereich mit Blick Richtung Süden, Foto Marc Senn
Abbildung 228: Anlagenbereich mit Blick Richtung Norden, Foto Marc Senn
Abbildung 229: Elektrische Güterzugslock Be 6/8 II Nr. 13254 Krokodil, Baujahr 1920, Gewicht 120 t, Foto Marc Senn
Abbildung 230: Dampflokomotive C 5/6 Nr. 2965 Elefant, Baujahr 1916, Gewicht 128 t inkl. Tender, Foto Marc Senn
Abbildung 231: Anlagenbereich der Ebene 1 mit BH St. Jakobstadt, Foto Marc Senn
Abbildung 232: Anlagenbereich der Ebene 1 mit BH St. Jakobstadt und im Hintergrund BH Graberegg, Foto Marc Senn
Abbildung 233: Anlagenbereich der Ebene 2 mit Ortschaft Kaeserberg, Foto Marc Senn
Abbildung 234: Anlagenbereich der Ebene 0 mit Schattenbahnhof und Gleise für Unterhalt und Reparatur, Foto Marc Senn
Abbildung 235: Fahrsimulator der SBB-Lokomotive Ae 6/6, Nr. 11409, Kanton Basel Land, Foto Marc Senn
Abbildung 236: Automobil (Patent-Motorwagen Nummer 1) von Carl Benz im Jahre 1886, Foto 14C1228_01 © DAIMLER
Abbildung 237: Rillenfräse, Foto Marc Senn
Abbildung 238: Forstnerbohrer Holz Ø25 mm, z.B. von wolfcraft, Foto Marc Senn
Abbildung 239: Lineal und flexibles Kurvenlineal, Foto Marc Senn
Abbildung 240: Paintmarker weiss (Lackmarker), Foto Marc Senn
Abbildung 241: Holzspiralbohrer Ø 3 und Ø 10 mm, Foto Marc Senn
Abbildung 242: Minifarbroller, Foto Marc Senn
Abbildung 243: Spachtel Breite 10 cm, Foto Marc Senn
Abbildung 244: Kunststoffbecher, Foto Marc Senn
Abbildung 245: Car System Digital Master, Foto © Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 246: Systemübersicht FALLER Car System Digital 3.0, Foto © Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 247: Erweiterungsmodul, Foto © Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 248: Schnitt durch Abzweigung in [mm]
Abbildung 249: Schnitt durch Stopp-Stelle in [mm]
Abbildung 250: Schnitt durch Parkplatz in [mm]
Abbildung 251: Satellit, Foto © Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 252: Fahrzeug Digital 2.0 (analog), Foto Marc Senn
Abbildung 253: Unterseite eines Fahrzeuges Digital 2.0 (analog), Foto Marc Senn
Abbildung 254: Oberseite eines Fahrzeuges Digital 2.0 (analog), Foto Marc Senn
Abbildung 255: Umrüst-Kit (digital) für Bus- und LKW-Fahrzeuge, © Foto Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 256: Ladegerät für Analog-Fahrzeuge (230 V), Foto Marc Senn
Abbildung 257: Ladegerät für alle Fahrzeuge (230 V), Foto © Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 258: Lastwagen Kategorie C im Modell 1:87, Foto Marc Senn
Abbildung 259: Personenwagen in [mm]
Abbildung 260: Transporter in [mm]
Abbildung 261: Lastwagen in [mm]
Abbildung 262: Lastwagen in [mm]
Abbildung 263: Bus in [mm]
Abbildung 264: Car in [mm]
Abbildung 265: Sattelschlepper in [mm]
Abbildung 266: Lastwagen mit drei Achsen in [mm]
Abbildung 267: Lastwagen mit drei Achsen und Anhänger in [mm]
Abbildung 268: Unterhaltsfahrzeug in [mm]
Abbildung 269: Notruf in [mm]
Abbildung 270: Feuerwehr in [mm]
Abbildung 271: Müllwagen in [mm]
Abbildung 272: Traktor mit Anhänger in [mm]
Abbildung 273: Lastwagen mit Ladekran und offener Ladefläche in [mm]
Abbildung 274: Lastwagen mit Mulde in [mm]
Abbildung 275: Sattelschlepper mit Mulde in [mm]
Abbildung 276: Sattelschlepper mit Auflieger in [mm]
Abbildung 277: Voller Einschlag bei Standardbus
Abbildung 278: Voller Einschlag bei Sattelschlepper
Abbildung 279: Voller Einschlag bei Lastwagen mit Anhänger
Abbildung 280: Massstabgetreue Abbildung eines Fahrzeuges in H0, Foto Marc Senn
Abbildung 281: Begrenzung der Fahrzeuge in [mm]
Abbildung 282: Oberbau mit 3mm Sperrholzplatte in [mm]
Abbildung 283: Oberbau ohne zusätzliche Sperrholzplatte in [mm]
Abbildung 284: Geländebauweise (Hanglage) in [mm]
Abbildung 285: Statisches System Einfeldträger
Abbildung 286: Beispiele Einfeldträger
Abbildung 287: Statisches System Durchlaufträger
Abbildung 288: Beispiele Durchlaufträger
Abbildung 289: Statisches System Bogen oder Gewölbe
Abbildung 290: Beispiele System Bogen oder Gewölbe
Abbildung 291: Statisches System geschlossener Rahmen
Abbildung 292: Beispiele geschlossener Rahmen
Abbildung 293: Statisches System offener Rahmen
Abbildung 294: Beispiele offener Rahmen
Abbildung 295: Statisches System Rohr- oder Maulprofil
Abbildung 296: Beispiele Rohr- oder Maulprofil
Abbildung 297: Viaduc d’Yverdon, Foto Marc Senn
Abbildung 298: Lichtraumprofil bei gerader Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 299: Lichtraumprofil bei gerader und doppelspuriger Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 300: Lichtraumprofil bei gebogener Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 301: Lichtraumprofil bei gebogener und doppelspuriger Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 302: Tunnelprofil bei gerader Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 303: Tunnelprofil bei gerader und doppelspuriger Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 304: Tunnelprofil bei gebogener Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 305: Tunnelprofil bei gebogener und doppelspurigen Fahrbahnführung in [mm]
Abbildung 306: Kurvenverbreiterung einer Fahrspur in [mm]
Abbildung 307: Kurvenverbreiterung einer Doppelspur in [mm]
Abbildung 308: Kurvenverbreiterung eines Sattelschleppers bei einer Fahrspur in [mm]
Abbildung 309: Schleppkurven eines Sattelschleppers bei Doppelspur in [mm]
Abbildung 310: Schleppkurven eines Sattelschleppers beim Wenden in [mm]
Abbildung 311: Beispiele von optimierten Kurvenverbreiterungen in [mm]
Abbildung 312: Übergangsbogen als Klothoide mit Kurvenverbreiterung in [mm]
Abbildung 313: Einmündung T-Knoten 90° und 45° für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 314: Einmündung T-Knoten mit Linksabbiegespur für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 315: Kreuzung für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 316: Kreuzung mit Linksabbieger für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 317: Kreuzung mit Rechtsabbieger für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 318: Kreuzung mit Links- und Rechtsabbieger für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 319: Fahrbahnbreiten nach Kreiseldurchmessern für alle Fahrzeugtypen [mm]
Abbildung 320: Kreisel Innerorts bis 10 m-LW
Abbildung 321: Kreisel innerorts für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 322: Kreisel ausserorts für alle Fahrzeugtypen in [mm]
Abbildung 323: Wendeschleife links für PW und LW bis 115 mm-Lastwagen in [mm]
Abbildung 324: Wendeschleife links für Sattelschlepper und Busse [mm]
Abbildung 325: Wendeschleife symmetrisch für bis 115 mm-Lastwagen in [mm]
Abbildung 326: Wendeschleife mit Parkplätzen für bis 115-mm-Lastwagen in [mm]
Abbildung 327: Fahrbahnhaltestelle in [mm]
Abbildung 328: Fahrbahnhaltestelle mit Insel (Überholen verboten) in [mm]
Abbildung 329: Busbucht in [mm]
Abbildung 330: Fussgängerübergang in [mm]
Abbildung 331: Fussgängerübergang bei Doppelspur in [mm]
Abbildung 332: Fussgängerübergang mit Fussgängerschutzinsel in [mm]
Abbildung 333: Fussgängerübergänge mit Insel und Fahrbahnhaltestelle in [mm]
Abbildung 334: Laser-Street Fahrbahn Gerade 425 x 50 mm (2x), Foto Marc Senn
Abbildung 335: Laser-Street Fahrbahn Gerade 212.5 x 50 mm (4x), Foto Marc Senn
Abbildung 336: Laser-Street Fahrbahn Bogen 45° R 268 x 50 mm (4x) und R 218 x 50 mm (4x), Foto Marc Senn
Abbildung 337: Laser-Street Fahrbahn Flexibel 250 x 50 (2x), Foto Marc Senn
Abbildung 338: Laser-Street Abzweigung und Einmündung 45° 212.5 x 102.5 mm, Foto Marc Senn
Abbildung 339: Laser-Street T-Kreuzung 90° 425 x 312.5 mm (1x), Foto Marc Senn
Abbildung 340: Laser-Street Parkharfe Basis 873 x 320 mm (1x), Foto Marc Senn
Abbildung 341: Laser-Street Parkharfe Ergänzung 411 x 320 mm (1x), Foto Marc Senn
Abbildung 342: Laser-Street Busbucht 425 x 133 mm (1x), Foto Marc Senn
Abbildung 343: Laser-Street Wendeschleife 411 x 320 mm (1x), Foto Marc Senn
Abbildung 344: FALLER - Rillenfräse, Foto Marc Senn
Abbildung 345: FALLER - Fräse, Fräskopf, Foto Marc Senn
Abbildung 346: FALLER - Spezialfahrdraht, Foto Marc Senn
Abbildung 347: FALLER - Strassen- und Geländebaumasse, Foto Marc Senn
Abbildung 348: FALLER - Strassenfarbe, Foto Marc Senn
Abbildung 349: Normalprofil ausserorts mit gerader Linienführung in [mm]
Abbildung 350: Normalprofil ausserorts mit gebogener Linienführung in [mm]
Abbildung 351: Normalprofil innerorts in [mm]
Abbildung 352: Längsmarkierungen
Abbildung 353: Quermarkierungen
Abbildung 354: Einspur- und Richtungspfeile
Abbildung 355: Parkplatz für Personenwagen und Behindertenparkplatz
Abbildung 356: Parkplatz Car / Bus und LKW
Abbildung 357: Vortrittssignale
Abbildung 358: Gefahrensignale
Abbildung 359: Vorschriftssignale
Abbildung 360: Wegweisungssignale
Abbildung 361: Ortschaftsignale
Abbildung 362: Autobahn- und Autostrassensignale
Abbildung 363: Weitere Hinweissignale
Abbildung 364: LED-Lichtsignale (3-Phasen grün/gelb/rot) mit Steuerungsbox, Foto © Gebr. FALLER GmbH
Abbildung 365: Kandelaber ohne Ausleger, Höhe 100 mm in [mm]
Abbildung 366: Kandelaber mit Ausleger, Höhe 100 mm in [mm]
Abbildung 367: Kandelaber mit Ausleger (angewinkelt), Höhe 100 mm in [mm]
Abbildung 368: Kandelaber mit einseitiger Anordnung, Abstand 300 mm in [mm]
Abbildung 369: Kandelaber mit beidseitiger, versetzter Anordnung, Abstand 300 mm in [mm]
Abbildung 370: Kandelaber für Platzbeleuchtung, Höhe 140 mm in [mm]
Abbildung 371: Moderner Kandelaber(LED) und Powermodul gegen Lichtflackern von Viessmann bei Anschluss mit Wechselspannung, Foto Marc Senn
Abbildung 372: Car-Liege zum Beispiel von Lok-Gallery, Foto Marc Senn
Abbildung 373: Berechnung des Kreisbogens
Abbildung 374: Berechnung Übergangsbogen mittels Klothoide
Abbildung 375: Übergangsbogen Konstruktion der Klothoide
Abbildung 376: Berechnung Steigung (Gefälle)
Abbildung 377: Berechnung vertikale Ausrundungen in Kuppen oder Wannen
Abbildung 378: Die Fälle von Ausrundungen
Abbildung 379: Vertikale Ausrundung für Car bei Kuppen, Übergang Rampe (Fall Kuppe)
Abbildung 380: Vertikale Ausrundung für Car bei Kuppen, Übergang Rampe (Fall Wanne)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht der schweizerischen Vorbilder für die Modellbahn
Tabelle 2: Einteilung der Gleise
Tabelle 3: Höchstgeschwindigkeiten
Tabelle 4: Höchstgeschwindigkeiten CH-Loks
Tabelle 5: Übersicht Spur H0, gemäss MOROP NEM 010
Tabelle 6: Werkzeugliste
Tabelle 7: Werkzeugliste für den Gleisbau
Tabelle 8: Messwerte des PIKO Messwagen
Tabelle 9: Messwerte des PIKO Messwagen
Tabelle 10: Abmessungen des PIKO Messwagen
Tabelle 11: PIKO ANALYST, Übersicht Befehle
Tabelle 12: Umrechnung von Prozent in Millimeter
Tabelle 13: Code und Profilhöhe, gemäss MOROP NEM 120 (Code 83/100) und besondere Systeme NEM 340 (Märklin)
Tabelle 14: Übersicht übliche Kupplungen in der Schweiz
Tabelle 15: Übersicht Kupplungsarten gemäss MOROP NEM 351
Tabelle 16: Gleiselemente in H0
Tabelle 17: Strom- und Gleissystem
Tabelle 18: Vor- und Nachteile Gleissysteme
Tabelle 19: Übersicht Dreileitergleis mit und ohne Bettung
Tabelle 20: Übersicht Dreileitergleis (Märklin) Gleiselemente
Tabelle 21: Übersicht Zweileitergleis mit Bettung
Tabelle 22: Übersicht Gleiselemente Zweileitergleise mit Bettung
Tabelle 23: Übersicht Zweileitergleis ohne Bettung
Tabelle 24: Übersicht Gleiselemente Zweileitergleise ohne Bettung
Tabelle 25: Flexzahnradstange, Foto Marc Senn
Tabelle 26: Maximale Steigungen für Zahnradstrecken
Tabelle 27: Zweileitergleis mit Flexzahnradstange aufgeklebt auf Holzschwellen, Foto Marc Senn
Tabelle 28: Übersicht Zweileitergleis mit Zahnstange
Tabelle 29: Übersicht Bezeichnungen Lok Wechselstrom (AC)
Tabelle 30: Übersicht Bezeichnungen Lok Gleichstrom (DC)
Tabelle 31: Kosten der Zentrale
Tabelle 32: Technische Daten Zentrale von Märklin
Tabelle 33: Übersicht Anschlüsse Rückseite
Tabelle 34: Technische Daten Zentrale von ESU
Tabelle 35: Übersicht Anschlüsse Rückseite
Tabelle 36: Technische Daten Zentrale von Fleischmann und Roco
Tabelle 37: Bauformen Stellwerke
Tabelle 38: Rückmeldetypen
Tabelle 39: Übersicht gängige Computersoftwaresteuerungen
Tabelle 40: Epochen in der Schweiz, gemäss MOROP NEM 804 CH
Tabelle 41: Anlagearten
Tabelle 42: Gleisplanprogramme und Kosten
Tabelle 43: Sperrholz Birke, Stärke und Kosten
Tabelle 44: Sperrholz, char. Konstruktionswerte
Tabelle 45: Vollholz, Stärke und Kosten
Tabelle 46: Vollholz, char. Konstruktionswerte bei relativer Luftfeuchtigkeit 65% und Temperatur von 20 °C
Tabelle 47: Kosten Korkrollen
Tabelle 48: Kosten Korkbettungsstreifen H0
Tabelle 49: Kosten Gleisschotter H0
Tabelle 50: Farben Gleisschotter H0
Tabelle 51: Übersicht Zweileitergleis mit Bettung
Tabelle 52: Erweiterung E in Abhängigkeit des Radius in [mm], gemäss MOROP NEM 103
Tabelle 53: Schweizer Bauweisen von Brücken
Tabelle 54: Häufigste Tragwerksysteme von Brücken in der Schweiz
Tabelle 55: Gleisabstand in Abhängigkeit des Radius in [mm], gemäss MOROP NEM 112
Tabelle 56: Gleisüberhöhungen in [mm]
Tabelle 57: Gleisabstand in Abhängigkeit des Radius in [mm]
Tabelle 58: Masten
Tabelle 59: Lötöl von Sommerfeldt Nr. 082, Foto Marc Senn
Tabelle 60: Varianten von elektrischen Leitern (isoliert mit Kunststoffummantelung) Spannungseinstellungen
Tabelle 61: Varianten von elektrischen Leitern (isoliert mit Kunststoffummantelung), Ampereeinstellungen
Tabelle 62: Varianten von elektrischen Leitern (isoliert mit Kunststoffummantelung)
Tabelle 63: Beispiel Farbsystem der elektrischen Leitungen
Tabelle 64: Beispiel eines sauberen aufgebauten Anschlussnummerntabelle für ein einfache Modelbahnanlage
Tabelle 65: Lichtquellen und ihre Farbtemperatur in Kelvin (K)
Tabelle 66: Signale der Zugfahrten in [mm]
Tabelle 67: Preise Signale Hersteller MicroScale
Tabelle 68: Weitere Signale in [mm]
Tabelle 69: Kosten Drehscheibe
Tabelle 70: Bahnhofs- und Stationsarten in der Schweiz
Tabelle 71: Kosten Gestaltungsprodukte
Tabelle 72: Kosten Figuren
Tabelle 73: Übersicht Reinigungsvarianten der Anlage und Kosten
Tabelle 74: Übersicht Lok-Wartung
Tabelle 75: Lok Prüfstand
Tabelle 76: Übersicht Kosten Lok-Liegen
Tabelle 77: Übersicht Kosten Lok-Drehliege (Wartungsbank)
Tabelle 78: Übersicht Kosten Lok-Reinigung
Tabelle 79: Beispiel einer Kostenschätzung
Tabelle 80: Berechnung der Längenwerte der Einheitsklothoide
Tabelle 81: Ausrundungen in Abhängigkeit des Fahrzeugtyps und der Geschwindigkeit [mm]
Tabelle 82: Berechnung 3-Felder
Tabelle 83: Berechnung 4-Felder
Tabelle 84: Berechnung 5-Felder
Tabelle 85: Berechnung 6-Felder
Tabelle 86: Berechnung 7-Felder
Tabelle 87: Knickwiderstand Druckstäbe
Tabelle 88: Übersicht der schweizerischen Vorbilder sowie die grössten Carunternehmen in der Schweiz
Tabelle 89: Werkzeugliste
Tabelle 90: Werkzeugliste für den Fahrbahnbau
Tabelle 91: Erforderliche Komponenten von FALLER für das Car System Digital 3.0
Tabelle 92: Weitere Komponenten von FALLER für das Car System Digital 3.0
Tabelle 93: Sensoren
Tabelle 94: Übersicht Bezeichnungen
Tabelle 95: Fahrzeugkategorien und reduzierte Deichsellänge in mm
Tabelle 96: Einschlagwinkel in Grad [°] und Einschlagkreise in [mm] von Fahrzeugtypen
Tabelle 97: Beispiel für eine Bewertungstabelle nach Kriterien und Gewichtung
Tabelle 98: Verschiedene Lizenztypen
Tabelle 99: Schweizer Bauweisen von Brücken
Tabelle 100: Häufigste Tragwerksysteme von Brücken in der Schweiz
Tabelle 101: Abhängigkeiten von der Kurvenverbreiterung in [mm]
Tabelle 102: Kurvenverbreiterung der Kategorie A in [mm]
Tabelle 103: Kurvenverbreiterung der Kategorie B in [mm]
Tabelle 104: Kurvenverbreiterung der Kategorie C in [mm]
Tabelle 105: Kurvenverbreiterung der Kategorie D in [mm]
Tabelle 106: Kurvenverbreiterung der Kategorie A in [mm]
Tabelle 107: Abmessungen Kreiseltypen und Durchmesser in [mm]
Tabelle 108: Übersicht Laser-Street Fahrbahnelemente und Kosten
Tabelle 109: FALLER - Rillenfräse
Tabelle 110: Spezial-Fahrdraht
Tabelle 111: FALLER Strassen- und Geländebaumasse
Tabelle 112: FALLER - Strassenfarben
Tabelle 113: Markierungen
Tabelle 114: Markierungen
Tabelle 115: Übersicht Reinigungsvarianten der Anlage
Tabelle 116: Beispiel einer Kostenschätzung
Tabelle 117: Berechnung der Längenwerte der Einheitsklothoide
Tabelle 118: Ausrundungen in Abhängigkeit des Fahrzeugtyps und der Geschwindigkeit [mm]
1 Vorwort
Liebe Freunde der Modellbauer!
Die Erstausgabe ist sehr gut bei euch Leser angekommen und daher habe ich mich entschieden für eine überarbeitete Auflage. Zum Thema Modelleisenbahn wurde das Car System von Faller umfassend erweitert und ins Buch integriert. Ich hoffe Ihr habt jetzt noch mehr anwendbares Wissen für das schönste Hobby der Welt!
Die Empfehlungen in diesem Handbuch sind nicht verbindlich. Es ist eine Planungs-grundlage, mit dem Ziel, Erfahrungen in der Planung von Modellanlagen weiterzugeben, um Fehler zu vermeiden. Demzufolge sind nicht alle Detailplanungen abgedeckt und sie sind je nach Hersteller oder System unterschiedlich. Die Benutzung dieses Handbuches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter grösster Sorgfalt erarbeitet. Der Verlag und der Autor übernehmen jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Jegliche Verantwortung und Haftung von Autor und Verlag werden ausgeschlossen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen.
2 Norm der Modellbahn
Der Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas (MOROP) ist der europäische Dachverband und besteht aus vielen Mitgliedsverbänden aus verschiedenen Ländern in Europa. Der Verband verfolgt die Ziele für Ausarbeitung, Überarbeitung und Erneuerungen von Normen Europäischer Modellbahnen in allen Modellgrössen. Die Norm nennt sich NEM und ist auf der Homepage von MOROP kostenlos erhältlich.
3 Vorbild
Als Vorbild dient die Schweiz mit den bekannten Bahnunternehmen SBB und BLS. Das schweizerische Modellhandbuch soll möglichst diese Bahnunternehmen näher an die Modellbahn bringen und verschiedene technische Sachverhalte klarstellen. Daher sind diese Empfehlungen vorwiegend eine Annäherung an das Vorbild und können von der Norm NEM leicht abweichen. Bei der Modellbahn ist immer die Norm NEM massgebend. Für die Modellbahn und deren Produkte ist sehr wichtig, die Vorschriften von den einzelnen Herstellern zu berücksichtigen und zu befolgen.
4 Geschichte der Bahn
4.1 Die Entstehung der Eisenbahn
Die Geschichte der Eisenbahn begann im Jahr 1784 und hatte ihren Ursprung in England. Das erste Versuchsmodell für ein Lokmobil stammt vom englischen Ingenieur William Murdock. Damals baute er einen gleislosen Dampfwagen. Erst viele Jahre später, um 1804, erfand ein Engländer, Richard Trevithile, die erste funktionsfähige Dampflok auf Schienen.
Die erste Eisenbahnstrecke wurde erst 1845 auf Schweizer Boden eröffnet und führte von St. Louis zum französischen Bahnhof Basel. Die Strecke zwischen Zürich und Baden gilt als erste Schweizer Eisenbahnstrecke. Die Strecke wurde von der Eisenbahngesellschaft „Schweizerische Nordbahn“ betrieben und betrug 23 Kilometer. Sie erhielt ihre Bezeichnung von einer Badener Spezialität, den spanischen Brötli. Am 7. August 1847 wurde die Einweihung festlich gefeiert und erweckte in der Schweiz die Zuversicht vom technischen Fortschritt.
4.2 Die Entstehung der Modellbahn
Das erste Kind, das nachweisbar eine Modellbahn besass, war 1859 der kaiserliche Prinz von Napoleon III in Frankreich. Es war die erste dokumentierte und nachgewiesene Modellbahnanlage (Gartenmodellbahn) der Welt. Die erste elektrische betriebene Eisenbahn mit Zweileiter-Gleissystem erschien im Jahr 1883.
Abbildung 1: Erste Modellbahnanlage von Napoleon III in Frankreich, Foto Lizenzfrei, nicht urheberrechtlich geschützt
Erst einige Zeit später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurden die Anlagen kompakter, damit diese in einem Wohnzimmer Einzug nehmen konnten. Auch wurde mit der Spur H0 die optimierte Modellbahngrösse auf den Markt gebracht, die auch für die Masse einer preisgünstigen Variante entsprach. Die Spur H0 ist bis heute weltweit die populärste Modellbahngrösse geblieben.
4.3 Die Vorbilder der Modellbahn in der Schweiz
Die drei bekanntesten und grössten Bahnunternehmen mit Schienennetz in der Schweiz:
Tabelle 1: Übersicht der schweizerischen Vorbilder für die Modellbahn
Neben den drei genannten Bahnunternehmen gibt es in der Schweiz noch weitere kleine und private Bahnunternehmen. Auch ausländische Bahnunternehmen sind auf dem Gebiet der Schweiz zu finden, wie die Deutsche Bahn oder die französische SCNF.
5 Einführung
5.1 Definitionen
Analog
Die Analogtechnik ist die klassische Art, eine Modelleisenbahn zu steuern. Bei einer analogen Modellbahn werden die Loks über die anliegende Fahrstromspannung mittels regelbarem Transformator gesteuert. Je mehr Strom – desto schneller fährt die Lok. Es können nur sehr wenige Loks gleichzeitig gesteuert werden. Die Steuerung der Weichen und Signale erfolgt von Hand über einen Schalter.
Anlage
Als Anlage wird die Gesamtheit, in der Regel der Unter- und Oberbau inkl. Landschaftsausbau, bezeichnet. Die Schienenfahrzeuge gehören nicht zur Anlage.
Anschlussgleis
Ein Anschlussgleis ist an einen Bahnhof oder an die Strecke ange-schlossen für Industrieanlagen und Lagerplätze.
Auflagerreaktionen
Ein Tragwerk oder eine Brücke ist immer auf Auflagern gelagert. Die Auflager tragen die die Lasten. Die an den Auflagern einwirkenden Kräfte (vertikal und auch horizontal) werden als Auflagerreaktionen bezeichnet. Ein festes Auflager kann vertikale sowie horizontale Kräfte aufnehmen und ein freies Auflager nur vertikale. Ein Tragwerk oder eine Brücke hat also immer ein festes Auflager und ein oder mehrere lose Auflager.
Bahnanlagen
Zu den Bahnanlagen gehören alle baulichen Elemente, die für den Bahnbetrieb und seine Sicherung notwendig sind; dies können zum Beispiel Bahnhöfe, Strecken, Oberleitungsmasten oder Signale sein. Bei Bahngebäuden spricht man vielmals von Immobilien (Bahnhof-gebäude, Servicegebäude und dgl.)
Bahnhof
Ein Bahnhof ist eine Verkehrs- und Betriebsanlage einer Bahn. Züge können abfahren und ankommen. Reisende haben Zugang zu den Zügen.
Bahnhofbenutzer
Passagiere der Bahn.
Bahnkörper
Der Bahnkörper bildet die Fahrbahn. Der Bahnkörper kann in zwei Bauten aufgeteilt werden in Ober- und Unterbau. Zum Bahnkörper gehören auch Dämme, Einschnitte sowie Brücken und dgl.
Betrieb (-sanlage)
Es geht um den vorbildgerechten Betrieb einer Modellbahnanlage. Dies bedeutet, dass die Züge eine Aufgabe in einer bestimmten Zeit, also gleich wie im Vorbild, erfüllen müssen. Zum Beispiel muss eine Dampflok aus dem Depot zuerst die Wasser- und Kohlestationen anfahren, dann die Wagen ankuppeln gehen, zum Bahnhof fahren, Passagiere laden und eine bestimmte Strecke fahren und so weiter. Die Güterzüge müssen zum Beispiel Ladungen abholen und an einen bestimmten Ort auf der Anlage transportieren und entladen. Es handelt sich hierbei um sehr realitätsnahe Aufgaben, die wie im Vorbild nachzuahmen sind und verschiedene Fahrmöglichkeiten auf der Modellbahnanlage durchführen.
Biegung
Ein Bauteil wie ein Träger wird auf Biegung beansprucht infolge einer Krafteinwirkung. Im Trägerquerschnitt treten sowohl Druck- als auch Zugspannungen auf. Durch die Krafteinwirkung wird sich der Träger biegen.
Block
Ein Block ist ein Streckenabschnitt eines Gleises auf der Modellbahn-anlage, in der nur jeweils ein Zug einfahren darf. Die Blöcke sichern so die Zugfahrten. Ein Block ist mindestens so lang wie der längste Zug auf der Modellbahnanlage; in den Betriebsanlagen können auch nur sehr kurze Blöcke für eine Lok realisiert werden.
Booster
Ein Booster ist ein elektrischer Signalverstärker für digitale Modell-bahnanlagen. Bei hoher Anzahl von Loks sinkt der Fahrstrom und die Signalübertragung einer Zentrale, aber mit solchen Boostern kann das Problem behoben werden. Die Modellbahnanlage kann zudem in verschiedene Boosterabschnitte resp. Stromversorgungsabschnitte aufgeteilt werden.
Decoder
Ein Decoder decodiert die digitalen Steuerbefehle der Zentrale und muss mit dieser kompatibel sein. Die Decoder haben eine Adresse und können von der Zentrale entsprechend angesteuert werden. Es wird unterschieden in zwei verschiedene Decoder, den Lokdecoder und den Schaltdecoder. Der Lokdecoder ist so gesehen der Lokführer und leitet die Funktionen an die Motor-, Licht-, Sound-, und anderen Lokkomponenten weiter, damit der Fahrbetrieb gewährleistet ist. Der Schaltdecoder schaltet die Weichen in die richtige Stellung oder schaltet die Signale ein und aus und ist sozusagen die Person im Stellwerk.
Druck
Ein Bauteil wie eine Stütze wird auf Druck beansprucht. Das Bauteil wird im inneren quasi durch die Druckspannung zusammengedrückt. Durch die äussere Krafteinwirkung verkürzt sich das Bauteil.
Bogen
Ein Bogen ist eine horizontale gleichmässige Kurve und wird durch seinen Radius bestimmt.
Brücken
Eine Brücke ist ein Bauwerk für die Bewältigung von Tälern oder anderen Hindernissen wie zum Beispiel Flüssen. Eine Brücke hat mindestens ein tragendes Feld (Einfeldträger) über eine bestimmte Spannweite mit zwei Auflagern. Eine Brücke weisst also ein Tragwerkssystem auf und kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
Digital