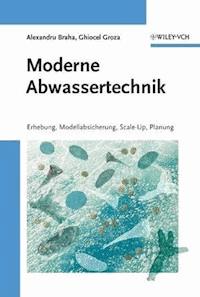
149,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch vermittelt wichtiges Fachwissen der Ökobiotechnologie für die Vermeidung von Fehlplanung und unnötigen Folgekosten beim Bau und Betrieb von Klär- und Abwasserbehandlungsanlagen. Für Verfahrenstechniker immer wichtiger werdende Modellrechnungen und Simulationsmethoden für die Abwasserreinigung werden hier didaktisch aufgearbeitet und präsentiert. Der Autor schlägt eine Brücke zwischen den biologisch-chemischen und verfahrenstechnischen Seiten der modernen Abwasserbehandlung, sodass sowohl Chemiker, Biotechnologen und Biologen wie auch Ingenieure, Verfahrenstechniker und Anlagenplaner jeweils das Fachfremde im Gesamtzusammenhang erläutert finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung: Abwassertechnik – Stiefkind der Verfahrenstechnik?
Danksagung
1 Mikrobiologische Grundzüge in der Bioverfahrenstechnik
1.1 Form und Gestalt der Mikroorganismen in Ökosystemen und in der industriellen Biotechnologie
1.2 Bioverfahrenstechnische Aspekte des Stoffwechsels
Literaturverzeichnis Kapitel 1
2 Verfahrenstechnische Überlegungen zur Modellbildung in der biologischen Abwasserbehandlung
2.1 Reaktionstechnisches Verhalten von Bioreaktoren mit suspendierter Biomasse
2.2 Reaktionstechnisches Verhalten von Reaktoren mit immobilisierter Biomasse
2.3 Erkundung des Temperatureinflusses auf die biokinetischen Geschwindigkeitskoeffizienten
2.4 Kinetik des Sauerstofftransports
2.5 Zwischenbemerkungen zu Bioreaktor und Modellbildung
Literaturverzeichnis Kapitel 2
3 Statistische Datenauswertungsverfahren
3.1 Statistische Kennwerte und Prüfverfahren
3.2 Regressionsrechnung
3.3 Zwischenbemerkungen zu statistischen Auswertungsverfahren
Literaturverzeichnis Kapitel 3
4 Bakterienmischpopulationen und Stoffumwandlungsprozesse bei multiplen Abwassersubstraten
4.1 Biomassenzuwachs/Bestimmungsverfahren
4.2 Multiple Substrate und deren analytische Bestimmung
4.3 Allgemeine Bemerkungen zur Anwendung von Summenparametern bei der Modellbildung
4.4 Kinetik mikrobieller Prozesse bei suspendierter Biomasse
4.5 Tropfkörper – Kinetik mikrobieller Prozesse bei auf Füllkörpern immobilisierter Biomasse
Literaturverzeichnis Kapitel 4
5 Durchführung kinetischer Untersuchungen mittels Laborund Halbtechnikums-Belebtschlammreaktoren
5.1 Versuche in einstufigen Halbstechnikums-Belebtschlammreaktoren
5.2 Versuche in einer Halbtechnikums-Mischbeckenkaskade
5.3 Schlussfolgerungen zur Modellerstellung/-übertragung auf Bioreaktoren in der Klärtechnik
Literaturverzeichnis Kapitel 5
6 Das Lawrence-McCarty-Modell
6.1 Das Schlammalter als Planungs-und Betriebsregelgröße
6.2 Modell-Erweiterung und Fallstudien bei Ingenieur-Büros
6.3 Schlussbetrachtungen zum Schlammalter-Modell
6.4 Automatische Betriebsführung auf der Grundlage reaktionstechnischer Modelle
6.5 ABF – IASI – Bemerkungen/Ausblick
Literaturverzeichnis Kapitel 6
7 „State of the Art“ in der Klärtechnik und Bio-Verfahrenstechnik
7.1 Einleitender Überblick
7.2 Kommentar/Ausblick
Literaturverzeichnis Kapitel 7
8 Fest-Flüssig-Trennung in statischen Klärern und Eindickern
8.1 Abwassertechnische Klassifizierung von Suspensionen
8.2 Modellerstellung für Fest-Flüssig-Trenneinheiten
8.3 Zwischenbemerkungen/Ausblick
Literaturverzeichnis Kapitel 8
9 Gleichmäßiges Absetzen versus Fluidisation
9.1 Theoretische Grundüberlegungen
9.2 Modellansätze bei Absetz-/Fluidisierungsprozessen
9.3 Bemerkungen zu „zone-settling“ und Fluidisierungsansätzen
Literaturverzeichnis Kapitel 9
10 Die „limiting-solids-flux-theory“ – Fallstudien
10.1 Theoretische Aspekte
10.2 Sedimentation-Fallstudien
10.3 Schlussbemerkungen zur Modellerstellung mittels Sedimentationsversuchen
Literaturverzeichnis Kapitel 10
11 Einbindung der Flockenkompression bei Belebtschlämmen in die Massen-Flux-Theorie
11.1 Schlammkompression – State of the Art
11.2 Aufgabenstellung
11.3 Versuchsplanung und -durchführung
11.4 Theoretische Grundüberlegungen
11.5 Diskussion der Ergebnisse
11.6 Dimensionierung eines statischen Eindickers
11.7 Schlammkompression – Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis Kapitel 11
12 Schlusswort – Ausblick
Stichwortverzeichnis
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Hellmann, D.-H., Riegler, G. (Hrsg.)
Maschinentechnik in der Abwasserreinigung
Verfahren und Ausrüstung
2003, ISBN 3-527-30606-4
Wiesmann, U., Choi, I. S., Dombrowski, E.-M.
Biological Wastewater Treatment
Fundamentals, Microbiology, Industrial Process Integration
2006, ISBN 3-527-31219-6
Oppenländer, T.
Photochemical Purification of Water and Air
Advanced Oxidation Processes (AOPs): Principles, Reaction
Mechanisms, Reactor Concepts
2003, ISBN 3-527-30563-7
Autoren
Prof. Dr.-Ing. Alexandru Braha
Konrad-Adenauer-Str. 66
30853 Langenhagen
Deutschland
Prof. Dr. Ghiocel Groza
TU für Bauwesen und Maschinen
Blv. Lacul Tei 128
Bukarest
Rumänien
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliographische Informationen der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 9783527312702
Epdf ISBN 978-3-527-60861-4
Epub ISBN 978-3-527-66029-2
Mobi ISBN 978-3-527-66028-5
Vorwort
Mit vor allem in Wirtschafts- und Geisteswissenschaften gängigen Begriffen wie „Theorie“ oder „Theoretisches Modell“ (wo sich dies meistens auf ungeprüfte Spekulationen, Annahmen und Vermutungen und manchmal, naturbedingt, sogar auf überhaupt nicht prüfbare Hypothese bezieht) haben nicht wenige auf dem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Bereich tätige Akademiker so ihre Schwierigkeiten. Bereits das Wort „Modelldenkweise“ als solches gilt nicht wenigen von ihnen als suspekt, und dies trotz der ganz verschiedenen Grund(be)deutung in diesen den exakten Wissenschaften zuzurechnenden Disziplinen, bei denen diese Begriffe in der Regel ein fachlich-kohärentes System von bereits verifizierten oder zumindest noch immer verifizierbaren Hypothesen und Phänomenen bezeichnen.
Allerdings ist die Neigung vieler Wissenschaftler allein der Ratio das wissenschaftlich-technische Agieren zuzuschreiben sicherlich falsch, da „reine“ (nur) Rationalität lediglich einen jener vielen allgemeinen Faktoren erfasst, welche das menschliche Agieren bestimmen und bedauerlicherweise nicht einmal der dominierende. Hinzu kommt, dass wir im Bereich des wissenschaftlich-technischen Denkens, obwohl häufig mit sich rasch wandelnden Situationen konfrontiert, viel eher dazu neigen, uns nicht nur an unseren Denkschemata festzuhalten und sogar neue Informationen zu verdrehen, um sie in diese Schemata einzupassen, als dass wir bereit wären, unsere Denkweise zu ändern; das abwassertechnische Gebiet bildet hinsichtlich der hierfür benötigten Akzeptanz des Neuen überhaupt keine Ausnahme. Beispielhaft hierfür möge eine Wiedergabe der Auffassungen weltbekannter Siedlungswasserwirtschaftler wie W. v. d. Emde, W. Gujer, L. Huber, K. H. Krauth und P. Schleyen aus dem führenden Abwasser-Standardwerk in Deutschland aus dem Jahr 1990 dienen [1].
„In der Arbeitsgruppe bestand sofort Übereinstimmung, dass die maßgebende Bemessungsgröße für Anlagen zur Nitrifikation/Denitrifikation das Schlammalter (tS) ist. Eine Bemessung nach der Stickstoff-Schlammbelastung ist daher nicht zielführend. Für die Berechnung des Rauminhaltes von Belebungsbecken dienen jedoch weiterhin die BSB5-Schlammbelastung BTS und die BSB5-Raumbelastung BR.“
In ihrer 1970 abwassertechnisch als bahnbrechend zu bezeichnenden Veröffentlichung [2] räumten Lawrence und McCarty bis dahin existierende Unklarheiten über die Definition des Schlammalters aus, und erwähnen mit Weitsicht
In essence, the models presented herein are only a mathematical formalization of what has been observed to be the important parameters by designers, operators, and investigators in the past. Such formalization, hopefully, will furnish relationships with predictive value to serve not only in the design and control of existing treatment processes, but also will aid in the biological processes for other purposes, such as denitrification... “
Bei gemeinsamen Systemeigenschaften Großmaßstabsreaktor ↔ Labor-Pilotreaktor kann dann viel leichter (und viel preiswerter) das Modell geprüft und zu einer statistisch abgesicherten Modell-Voraussage für die Großanlage eingesetzt werden [2]. Dabei setzen die Scale-up- und Optimierungsprobleme solcher Stoffumwandlungsprozesse eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Siedlungswasserbauern und Verfahrenstechnikern einerseits und Mikrobiologen sowie (Bio)-Chemikern andererseits voraus. Eine gemeinsame Sprachregelung bei allen diesen mitwirkenden Disziplinen führt unweigerlich dazu, dass bei den Ingenieurwissenschaftlern Grundzüge der Mikrobiologie und bei den Naturwissenschaftlern ein gewisses Verständnis für technische Zusammenhänge in immer größer werdendem Ausmaß benötigt werden. Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es daher, die zur Zeit relativ schmale Brücke zwischen diesen sich noch abgrenzenden Fachgebieten zu erweitern, um über gemeinsames Denken in Modellkategorien eine Querverbindungen zwischen Natur- und Ingenieurwissenschaften zu schaffen.
Um dieser Situation Rechnung zu tragen, werden auf der Basis schon im Labormaßstab zu planender Versuchsdurchführung nicht nur die Modellbildung an sich sondern auch in der Theorie oft angewandte mathematische „Tricks“ detailliert beschrieben, die das statistisch abgesicherte Herausfinden der auf die Prozessmechanismen einzeln einwirkenden Parameter wesentlich transparenter gestalten.
Trotz der nach „viel Theorie“ lautenden Thematik ist das Handbuch dank der vielen darin präsentierten realen Fallstudien stark an der Praxis orientiert und verzichtet auf langwierige theoretische Herleitungen. Dem Anwender, seien es Studierende oder in Entwicklung Tätige, kommen zahlreiche grapho-analytische Lösungen sowie sich daran anschließende Computersimulationen entgegen, die seinen künftigen Umgang mit statistisch abgesicherten Datenreihen, deren Einsatz ins Modell und dessen Prüfung auf Adäquatheit immer vertrauter machen. Kritisch eingestellten Lesern würden die Autoren für jede Anregung dankbar sein, denn auch was eventuell Gutes kann zum Feind des Besseren werden...
Literaturverzeichnis
1 Imhoff, K., Imhoff. R: Taschenbuch der Stadtentwässerung, Oldenbourg-Verlag, 27. Auflage, München (1990), S. 222.
2 Lawrence, A. W., McCarty, P.: Unified Basis for Biological Treatment Design and Operation. Journal of San. Eng Div., SA 3, June (1970), S. 757/778.
EinleitungAbwassertechnik – Stiefkind der Verfahrenstechnik?
Als Hauptaufgaben der Klärtechnik gelten die Abwasserreinigung vor dem Ableiten in natürliche Gewässer und die Behandlung der dabei anfallenden, überwiegend organisch belasteten Abwasserschlämme. Dies erfolgt in so genannten mechanisch-biologisch-chemischen Kläranlagen, in denen das Abwasser mehreren Reinigungsstufen unterzogen wird. In den „mechanischen“ Reinigungsstufen werden zuerst grobe, im Abwasser schwimmende/schwebende Feststoffe durch einen Siebvorgang entfernt; dies wird von so genannten Rechenanlagen getätigt. Eine zweite Gruppe zu entfernender Stoffe umfasst sandartige, von Fetten und Ölen verschmutzte Teilchen (Sandfanggut), vorwiegend mineralischer aber auch organisch-ausflockender Natur; da sie in der Regel eine größere Dichte als das Abwasser haben, sinken sie in so genannten Sandfängen zu Boden, wo sie mit geeigneten Vorrichtungen beseitigt werden. Drittens werden fettige und ölige Bestandteile, die normalerweise schwimmen, entweder in auch mit Lufteinblasung versehenen Spezial-Sandfängen, oder in Fett- und Ölabscheidern ausgetragen, um eine mögliche Öl-Anhaftung an der Biomasse nachfolgender biologischer Reinigungsstufen (luft-undurchlässiger Oberflächenfilm) weitestgehend zu vermeiden [1, 2]. Der vierte Schritt der Fest-Flüssig-Trennung wird in Klärern (Vorklärbecken – VKB) vollzogen, da sich im Abwasser noch viele feinstdispergierte, lediglich durch die durch mehrstündige Aufenthaltszeiten geförderte Konglomeratbildung, sedimentierfähige Teilchen befinden. Zur Anhebung der Trennleistung wird mancherorts ein kleiner Teil des Rücklaufschlammes (Überschussschlamm) in die Vorklärbecken zurückgeführt oder dem Vorklärbecken eine FlockungsFällstation vorgeschaltet. Dadurch wird ein Teilchen-Ausflockungseffekt im Vorklärbecken hervorgerufen und die biologische Stufe entlastet [2, 3]. In der nachfolgenden aeroben biologischen Abwasserreinigung werden bei Durchlauf-Anlagen für die Reagenzien Abwasser Biomasse Luftsauerstoff zwei Arten von Kontaktverfahren angewandt, um die bakterielle Umwandlung gelöster organischer Abwasser-Substratkomponenten in (Biomasse)Schlamm-Zuwachs zu bewirken. Diese zwei Bioreaktor-Arten kann man als (1): Bioreaktoren mit suspendierter Biomasse (suspended growth) und (2): Bioreaktoren mit immobilisierter Biomasse (attached growth) definieren. Nach der erfolgten Reaktion benötigt aber der Bioreaktor-Abfluss beider diesen Kontaktverfahren eine Fest-Flüssig-Trennung (Biomassezuwachs sowie biologisch-resistente ur-gelöste Teilchen), die wiederum andere Klärer, so genannte Nachklärbecken (NKB), erzwingen. Je nach der Art der Biomassebeteiligung, suspendiert oder an Trägern immobilisiert, haben solche NKB sehr unterschiedliche Biomassenströmen und Substrat-Restkonzentrationen zu „bewältigen“. Deshalb sollten kurz einige technologisch-anlagenmäßig spezifische Aspekte solcher Bio-Kontaktverfahren beschrieben werden [1, 4, 5].
Bei den Verfahren mit suspendierter Biomasse (Belebungsanlagen) bildet die durch Luftzufuhr aufgewirbelte Biomasse im Abwasser des Belebungsbecken eine Suspension heraus (Abwasserschlammgemisch), die nach Verlassen des Bioreaktors (Belebungsbeckens) den nach geschalteten Nachklärbecken (NKB) zufließt. Demnach haben die Nachklärbecken abwassertechnischer Belebungsanlagen als wichtigste Aufgabe, durch Sedimentation feine/feinste Teilchen des belebten Schlamms vom biologisch gereinigten Abwasser zu trennen. Danach kann der NKB-Ablauf, an sich ein voll biologisch-mechanisch gereinigtes Abwasser, in ein natürliches Gewässer abgeleitet werden. Daher ist der Abscheidegrad im Nachklärbecken entscheidend für die Reinigungsleistung der ganzen Belebungsanlage. Von dem in den NKB abgesetzten Belebtschlamm wird der größte Teil als Rücklaufschlamm in das Belebungsbecken zurückgeführt, ein viel kleinerer Anteil wird als so genannter NKB-Überschussschlamm, selten separat vom VKB-Schlamm (Primärschlamm), zu den statischen Eindickern gefördert [1, 4, 5]. Hieraus wird ersichtlich, dass die Nachklärbecken bei Belebungsanlagen, neben erwähnter, weitestgehender Biomasse-Trennung, ein zufrieden stellendes Aufkonzentrieren des abgesetzten Belebtschlamms zwecks benötigter Rückführung in das Belebungsbecken, mitsamt Sammeln/Zwischenspeichern dieses Belebtschlamms, als zusätzliche Aufgabe übernehmen und erfüllen müssen. Bei anhaltendem Regenwetter, d. h. zu hoher hydraulischer NKBOberflächenbelastung, kann es passieren, dass das Abwasserschlammgemisch aus dem Belebungsbecken den abgesetzten, abgespeicherten Schlamm aus den Nachklärbecken verdrängt. Die Folgen sind, der Rücklaufschlamm wird dünner und über den NKB-Ablauf kann ein massiver Schlammabtrieb einsetzen.
In der Regel wird die Belastbarkeit einer Belebungsanlage mit organischen Schmutzstoffen vom Gehalt an aktivem Schlamm im Belebungsbecken maßgebend bestimmt, da der Schlammgehalt im Belebungsbecken stark von der Funktionstüchtigkeit des Nachklärbeckens bei wechselnder hydraulischer Belastung und von der Schlammrückführung abhängt. Da insbesondere kleine Kläranlagen durch organische Stoßbelastungen gefährdet sind, ist es für deren Betrieb günstiger, ein größeres Belebungsbecken mit geringerem Schlammgehalt und dafür ein entsprechend kleineres Nachklärbecken zu wählen, als ein kleineres Belebungsbecken mit größerer Nachklärung einzusetzen. Dadurch wird auch der Erscheinung entgegengewirkt, dass es durch zu lange Aufenthaltszeiten in der Nachklärung zu unkontrollierten Denitrifkationsvorgängen und damit zum Schlammauftreiben kommt.
Andererseits begrenzt eine klein gehaltene Nachklärung die Mitbehandlung von Regenwasser, dem versucht man in der herkömmlichen Planung mit meist unangemessen groß gewählten Sicherheitskoeffizienten entgegenzuwirken, damit auch bei Regenwetter der Schlammspiegel in der Nachklärung nicht so weit ansteigt, dass größere Mengen Belebtschlamm verloren gehen. Können das Nachklärbecken und die Rücklaufsteuerung nicht so ausgelegt werden, dass die erforderliche Regenwassermenge mitbehandelt werden kann, muss ein anderes Reinigungsverfahren, z. B. die Abwasserreinigung in Pflanzen-Kläranlagen mit richtigen Öko-Teichen, gewählt werden (dies würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen, da deren ingenieurmäßige Umweltproblematik ganz andere Bereiche anspricht).
Besteht der Bioreaktor aus Tropfkörpern (Füllkörperkolonnen) oder aus rotierenden Scheibentauchanlagen (deren Füllkörper als Fläche zur Bildung des sich aus dem organischen Abwassersubstrat herausbildenden Biofilm/-Rasens dienen), so wird das Anhaften der Biomasse (des Biorasens) erheblich erleichtert. Daher beschränkt sich die Aufgabe der Nachklärung bei Bioreaktoren mit immobilisierter Biomasse darauf, aus der biologischen Stufe anfallende, technischabsetzbare Partikel auf die für die Einleitung in den Vorfluter zulässige Menge zu verringern. Zusätzliche Aufgaben, wie Biomasse-Rückführung, Abspeicherung und Aufkonzentrierung des Schlammes, fallen bei solchen Anlagen aus. Hinzu fallen bei der Nachklärung von Tropfkörpern/Scheibentauchkörpern verfahrenstechnisch-bedingt auch wesentlich geringere Zulaufkonzentrationen an Suspensa an; lediglich einige Hundert Milligramm/Liter. Daraus resultiert auch eine an sich weitgehend geringere Fest-Flüssig-Trennproblematik. Einerseits trennen sich zugewachsene, abfallende Rasenteilchen/-Konglomerate im Vergleich zu Belebungsanlagen viel leichter/schneller vom gereinigten Abwasser, andererseits fließt das meist darin nur teil-biologisch gereinigte Abwasser in der Regel einer nach geschalteten zweiten Bioreinigungs und Nachklärstufe zu [1, 4, 5].
Abwassertechnische Anlagen mit immobilisierter Biomasse werfen bei deren Planung /Betrieb kaum ähnlich schwerwiegende Probleme des Biomasse-Verhaltens auf, da deren Nachklärbecken um eine Zehnerpotenz niedriger liegende Biomasse-Volumenströme zu bewältigen haben und wegen fehlender Biomasserückführung kaum noch eine starke Schlammaufkonzentrierung oder -speicherung zu gewährleisten haben.
Insofern ist für den Planer/Forscher die Erkundung der Absetzcharakteristika der Biomasse in Konzentrationsbereichen ab Hunderten Milligramm/Liter entscheidend, daher sollte die Bestimmung der Flockenabsetzeigenschaften auch in Suspensaschwärmen und nicht nur in Konzentrationsbereichen von einigen Milligramm/Liter erfolgen.
Merksatz: Verfahrenstechnisch zeichnet sich hierbei allerdings ab, dass letztendlich das ganze Biomasseverhalten, also modellmäßige Koppelung der Biomasse-Reaktionsgeschwindigkeit mit ihren Absetzcharakteristika in einem System: Bioreaktorart – Nachklärbecken angestrebt werden sollte.
Literaturverzeichnis
1 Schneider, Dries, Roth, Baumann, Drobig: Grundlagen für den Betrieb von Belebungsanlagen mit gezielter Stickstoff-und Phosphorelimination, Verlag ATV-DVWK, Stuttgart (2004).
2 Bischofberger, W., Ruf, M., Hruschka, H, Hegemann, W.: Anwendung von Fällungsverfahren zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit biologischer Kläranlagen Teil II, Berichte aus Wasserquotewirtschaft und Gesundheitsingenieurwesen, München (1978), H 22.
3 Wolter C., Hahn, H, H: Absetzvorgange in Vorklärbecken und deren Einflüsse auf die Leistung der biologischen Stufe, KA Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001(48) Nr. 3, S 541/348.
4 Benefield, L., D. and Randall, C., W.: Biological Process Design for Wastewater Treatment, Prentice-Hall, Inc., NJ 07632 (1980), S. 201/210.
5 Metcalf and Eddy: Wastewater Engineering, McGraw-Hill Book Company. Sec. Edition, New York (1979).
Danksagung
Besonders herzlicher Dank, Anerkennung und Wertschätzung gelten dem früheren BASF-Direktor, Herrn Dr. rer. nat. Joachim Frost. Er erkannte schon Ende der 70er Jahre, dass die BASF Ludwigshafen zunehmend mit Problemen des allgemeinen Umweltschutzes konfrontiert werden würde. Seiner Weitsicht waren im Zusammenhang mit der Errichtung des mechanisch-biologischen BASF-Großklärwerks (1971) einige abwassertechnische Feld-Pilotvorhaben zu verdanken, die wiederum zu einer Reduzierung der geschätzten Investitionssumme von 220 Mill. DM führten. Meinen Kollegen, den BASF-Mitarbeitern Dipl.Math. Rolf Bautsch und Dipl.Math. Ferdinand Hafner, danke ich (Braha – damals frisch gebackener BASF-Mitarbeiter) herzlich für ihre kollegiale Haltung und die vielen Denkanstöße während unserer Zusammenarbeit bei der Durchführung dieser Feld-Pilotvorhaben.
Die aus diesen Arbeiten resultierenden Fachpublikationen erregten das Interesse des Verfahrenstechnikers Professor Dr.-Ing. Udo Wiesmann (TU Berlin), er ermöglichte mir (Braha) eine Promotion als externer Doktorand. Seiner anspruchsvollen Durchsicht der Dissertationsthese sowie dem wohlwollenden Einsatz seiner Feder ist es zu verdanken, dass die Dissertation (1986) nichts an Glanz und Deutlichkeit verlor.
Nicht weniger Anerkennung gebührt dem Wasserchemiker Dr. Nowak, Ottersberg, für die Zusammenarbeit bei Planungsaufträgen zur Klärwerkmodernisierung mehrerer städtischer Gemeinden und Industrien. Dabei kam die Modelldenkweise zur Anwendung und es wurde mit Mikropilotanlagen im Labormaßstab gearbeitet.
Anerkennung gebührt auch dem Bukarester Institut für Erforschung von Industrie-Abwässern (I.C.P.E.A.R), dessen Mitarbeiter die neue Methode des Denkens, Forschens und Auswertens in Modellkategorien schnell auffassten und ihren Studien für die neuen rumänischen Großklärwerke in Bukarest und Iasi zugrunde legten. Vor allem in die Bemessung der Belebungsanlagen flossen diese neu erworbenen Erkenntnisse ein.
Besonderer Dank gilt dem damaligen Dekan der Fakultät für Hydrotechnik (Bukarest), Professor Dr.-Ing. Dan Stematiu (heute zum TU-Oberrektor nominiert), einer wahrlich außergewöhnlichen Persönlichkeit. Ihm gelang es mit unglaublichem Erfolg einen Interprofessionalitätsaustausch zwischen dem Verfahrensingenieur Braha (Gastprofessor an der Bukarester TU für Bauwesen und Maschinen (1991)) und dem Mathematiker Dr. Ghiocel Groza (damals Assistent, heute Ordentlicher Professor für Angewandte Mathematik, TU Bukarest) einzuleiten, der zu einer langjährigen Kooperation führte. Dieser langjährigen Zusammenarbeit sind über 20 gemeinsame Fachpublikationen entsprungen, so auch das in Ihren Händen liegende Handbuch.
Schlicht menschlich betrachtet verdanken wir Autoren unseren Ehefrauen Ioana Braha und Maria Groza doch wohl alles, da sie während all dieser Jahre dieses, einem alles abverlangende, Kreationsfeuer mit liebevollem Verständnis unterstützten, und nicht zuletzt, weil bei nicht wenig Gezeichnetem und Geschriebenem, deren Glanzschliff ihren Federn entsprang!
Ihnen widmen wir Autoren dieses Buch.
Langenhagen, im Juni 2006
Die Autoren
1
Mikrobiologische Grundzüge in der Bioverfahrenstechnik
Eine Einführung in die Bioverfahrenstechnik ohne Bezugnahme zur Mikrobiologie und zur Biochemie ist undenkbar. Obwohl die biologische Verfahrenstechnik auf den Prinzipien der allgemeinen Verfahrenstechnik und gleichzeitig auf der damit verbundenen Tradition der Siedlungswasserwirtschaft, d. h. auf deren ungeheuren Mengen an empirischem Datenmaterial und Beobachtungen aufbaut, sind es doch gerade die aus dem Verständnis für die Mikrobiologie sowie aus dem Zusammenwirken von Biologie und Verfahrenstechnik abgeleiteten Besonderheiten, die das Gebiet der Bioverfahrenstechnik so anspruchsvoll, aber auch so interessant machen. Um biologische Verfahrenstechnik betreiben zu können, ist ein grundlegendes Verständnis der spezifischen mikrobiologischen und biochemischen Faktoren und Anforderungen notwendig, welches diesen neu entstandenen Zweig „Bioverfahrenstechnik“ prägt und ihn von der chemischen oder mechanischen Verfahrenstechnik unterscheidet. Es wäre an dieser Stelle verfehlt, all diese Aspekte umfassend zu behandeln. Dafür gibt es Monographien aus berufener Feder, wie u. a. [3–5]. Vielmehr werden hier zweckgerichtet jene mikrobiologischen Aspekte angesprochen, die für die später behandelten verfahrenstechnischen Zusammenhänge relevant sind. Der Biochemiker oder der Mikrobiologe möge diesen Abschnitt überspringen; der angehende Siedlungswasserbauer oder Verfahrenstechniker sowie auch der Entwicklungsingenieur und der Apparatebauer, welcher zum ersten Mal mit technischer Biologie konfrontiert wird, mag darin Erläuterungen finden, welche seinen Aufgaben dienlich sein können.
1.1 Form und Gestalt der Mikroorganismen in Ökosystemen und in der industriellen Biotechnologie
Aus der Sicht der Mikrobiologen lassen sich hierzu folgende Aspekte nennen, die für den Bioverfahrenstechniker von Bedeutung sein können: Form und Gestalt der Mikroorganismen, der Stoffwechsel und die Energetik mikrobieller Stoffumwandlungsprozesse, Bakterienwachstum und die Regulation biologischer Vorgänge [3]. So lassen sich die Mikroorganismen aufgrund ihrer Zellstruktur in zwei abgrenzbare Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe umfasst höher, d. h. stärker differenzierte Mikroorganismen, die Eukaryoten, deren Zellorganisation derjenigen der Tiere und Pflanzen gleicht. Hierzu gehören Algen, Pilze und Protozoen. Die zweite Gruppe wird von den niederen Mikroorganismen, den Prokaryoten, gebildet; zu diesen gehören die Bakterien, denen aufgrund ihrer erheblichen Bedeutung in der Ökobiotechnologie der Schwerpunkt nachfolgender Ausführungen eingeräumt wird.
1.1.1 Eukaryotische und prokaryotische Zellen und ihre Struktur
Es gibt eine große Anzahl verschiedener Arten von Eu- und Prokaryoten, die zusammen eine systematische Ordnung bilden. In den Prokaryoten hat man Relikte aus der Frühzeit der organischen Evolution zu sehen und ihre Entwicklung zu den Eukaryoten stellt die größte Diskontinuität in der Evolution der Organismen dar [3]. Die prinzipielle Struktur der Prokaryoten und der Eukaryoten ist aus Abb. 1–1 und Abb. 1–2 zu ersehen.
Abb. 1–1: Schematisches Längsschnittbild einer prokaryotischen Zelle (Bakterienzelle) und die Typen der intracytoplasmatischen Membranstrukturen. Cm - Cytoplasma-membran; Cp - Cytoplasma; Ge - Geißel; Gly - Glykogengranula; Ka - Kapsel; Li - Lipidtropfen; N - Nucleus oder Kern; PHB - Poly-β-hydroxy-buttersäure; Pi - Pili; Pl - Plasmid; Po - Polyphosphatgranula; Rb - Ribosomen und Polysomen; S - Schwefeleinschlüsse; Zw -Zellwand; nach [3].
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























